

Nymphentanz am Wahrheitsberg
Der Schriftsteller und Diplomat Werner von der Schulenburg kam 1919 auf den Monte Verità, zu einer Zeit, als Gusto Gräser bereits nach Deutschland weggezogen war. Er mietete den Dichterturm, das sogenannte „Roccolo“, einen ehemaligen Vogelfängerturm, den vor ihm schon die Puppenmacherin Käthe Kruse, die Schriftstellerin Franziska zu Reventlow und der Dramatiker Reinhard Göring bewohnt hatten.
Schulenburg ist entzückt von der Landschaft, für ihn „die schönste der Welt“, und begeistert sich für die Geschichte des Orts. Er hört sich um unter den Menschen, die die erst kürzlich abgeschlossene Geschichte der Siedlung miterlebt haben. Aus den Erzählungen der Zeugen gewinnt er eine Fülle von Bildern und verwebt sie in einen Roman mit dem Titel ‚Tre Fontane‘ – Drei Brunnen. Er handelt davon, wie die ursprünglich wasserlose Siedlung zu Wasser kommt, wie auch die trockenen Brunnen im Dorf Ascona wieder zu sprudeln beginnen.
In die Mitte seiner Erzählung eingewoben sind mehrere Szenen, in denen ein „Täufer“ und „Wanderer“ aber auch „Tomatendieb“ genannter Mann in Erscheinung tritt. Eine Gestalt, die wie Johannes der Täufer gekleidet ist, die das Pentagramm zeichnet und in einer Felsgrotte wohnt. Schulenburg hat gesammelt, was ihm die Leute von Gusto Gräser erzählten und hat ein dichterisches Bild von ihm geschaffen, das hier in Ausschnitten vorgestellt werden soll.
Auf einer von Felsen umgebenen Waldwiese in der Umgebung des Monte Verità beobachtet sein Protagonist eine seltsame Szene:
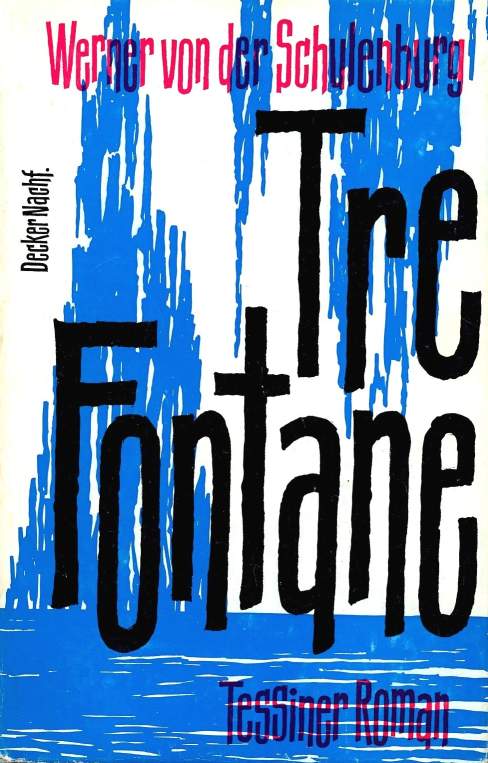 Am
folgenden Morgen stieg der Fremde langsam zum ‚Gipfel des
aktiven Skeptizismus’ empor. …
Am
folgenden Morgen stieg der Fremde langsam zum ‚Gipfel des
aktiven Skeptizismus’ empor. …
Ein Fußweg, überwuchert und seit langem nicht mehr begangen, führte über Wurzeln. Er schien gar nicht auf ein besonderes Ereignis hinzuleiten, bis er scharf um einen Felsen bog und auf einer Waldwiese endete. Der Fremde war fast erschrocken, als er an der anderen Seite der Wiese Leonore von Perugia erblickte, die, unter einer großen Eiche kauernd, die Arme um die Knie geschlungen hatte, den Stiel einer Nelke zerbiß und dem Ankommenden ruhig entgegensah. Neben der Tänzerin erhob sich ein Altar aus Felssteinen, umstanden von großen Heliotropbüschen. Ein hoher Tonkrug von griechischer Heiterkeit der Maße, war an den Altar gelehnt. Er schien Wasser zu enthalten, denn das lichte Braunrot war am Rande dunkel geworden, als ob die Flüssigkeit beim Ausgießen auch das Äußere des Gefäßes benetzt hätte. (65f.)
„Heute ist das Fest der Madonna della Fontana. Ich werde hinabsteigen. Kommen Sie mit?“ (67)
Vor der Kirche versammelte sich eine absonderliche Gemeinde. Die Frauen der Religiösen in violetten Gewändern bekränzten einen erhöhten Stuhl mit Blumen. Dazu sangen sie einen Hymnus unter beständigen Anrufen von Dionysos, der Jungfrau Maria und Buddha. Viele dürre Arme reckten sich wie ein Drahtverhau in die Höhe, und in den Gesang waren seltsame tierische Laute gemischt. Sie starrten einem Zug entgegen, der langsam um die Kirche bog. Voran schritt Leonore mit ihrem bösartigen Madonnengesicht; sie trug ein Kind auf den Armen, das von einer unglücklichen Kontoristin geboren war und dessen Vater als religiöses Kollektivum betrachtet wurde. Der Tomatendieb schritt würdig hinter Leonore her; er war Täufer in Haltung und Kleidung. …
Dann begann ein milder Reigen, ein Nymphenhymnus auf die Quellgöttin und die Fruchtbarkeit im allgemeinen; Palmblätter blitzten wie Schwerter auf und wurden wieder Fächer; die zurückgewiesenen Magdalenen bewegten sich anfangs gleichgültig, bis der allgemeine Taumel sie hinriß. (74 f.)
Der Fremde stand ruhig, den Strohhut in der Hand, im Schatten des Hauses. Er ehrte diesen Ausdruck reinen Glaubens, weil er noch einen Rest von Milde barg, weil er sich nicht fanatisch, würgend bot, nicht in hassender Liebe die Schwerter zückt, Menschen verbrennt und Geister zwingt, und unter dem Zeichen eines Gottes die Erde entvölkert. (73)
Die Liebe des Fremden flammte auf wie ein Stern, der noch nie geleuchtet hat. Die Liebe zum Land und die Liebe zu den Menschen verschmolz in ein großes Gefühl, Teil zu sein allen Lebens. Ganzes zu sein im Ganzen, Mensch zu sein ohne Gotteskrücke. (78)
Langsam stieg er vom Gipfel herab dem Wald der Romantik zu. Die Bäume umfingen ihn, fast abwehrend, mit der Kühle des Spätherbstes. Sie warfen keinen Schatten, aber sie gaben dafür feuchten, kalten Atem. Als er auf den Tanzplatz kam, bemerkte er Leonore, die am Altar betete. Ehe er still vorübergehen konnte, war sie aufgestanden und auf ihn zugetreten.
„Ihr Werk ist groß“, sagte sie.
„Ich hoffe, daß es gut ist.“ (106)
Innerhalb von Schulenburgs Erzählung bildet die Waldfestszene scheinbar nur eine Episode am Rande. Blickt man aber genauer auf die Absichten des Verfassers, dann entpuppt sich die Waldprozession als die Schlüsselszene des Romans. Das wird vollends klar, wenn man einen Brief von Schulenburg liest, den er 1920 an einen asconesischen Freund, den Schriftsteller Bruno Goetz, geschrieben hat:
Brief von Schulenburg an Bruno Goetz vom 27. 10. 1920:
Nichts scheint mir heute wichtiger zu sein als der Kampf gegen das perfide Christentum. In ihm, wie es heute da steht, stecken alle Fäulnisbakterien, die den europäischen Käse heute so angenehm durchsetzen. Das, was an Christus nicht Christentum ist, - und es ist wohl mehr, als man gewöhnlich glaubt – wird mit allen Mitteln einer überlegenen Rabulistik bei Seite geschoben.
In: Friedrich Glauser, Briefe an Elisabeth von Ruckteschell, S. 108f.
Was ist an Christus nicht Christentum? Sicher der noch von keiner Dogmatik, Philosophie oder Mythologie verkleidete Jesus von Nazareth, ein Jesus ohne Paulus und Johannes. Einen solchen Menschen suchte Schulenburg in der Gegenwart. In dem seltsamen Täufer und Einsiedler in der Felsgrotte von Arcegno scheint er zeitweise eine Hoffnungsgestalt gesehen zu haben.
Die nährende Wasserspende ist Thema seines Romans. Ein zugereister Fremder, Ingenieur und Offizier, baut eine kühne Zuleitung von fernen Berggipfeln, die den trockenen Monte Monescia, Sitz der Reformersiedlung, mit dem unentbehrichen Lebensstoff versorgt. Blickt man auf die zentrale Waldszene des Romans, dann kann man zu dem Ergebnis kommen, dass nicht so sehr oder nicht nur der Baumeister Spender des lebendigmachenden Wassers ist, sondern im Hintergrund eher der Täufer. Neben den felsigen Altar, zu dem die religiösen Frauen wallfahren, ist mit auffälliger Betonung ein Tonkrug, eine klassische Amphore gestellt, die Wasser enthält: das Lebendige im bändigenden, Maß gebenden Gefäß.
Ein hoher Tonkrug von griechischer Heiterkeit der Maße, war an den Altar gelehnt. Er schien Wasser zu enthalten, denn das lichte Braunrot war am Rande dunkel geworden, als ob die Flüssigkeit beim Ausgießen auch das Äußere des Gefäßes benetzt hätte. (65f.)
Wasser wurde ausgegossen, wurde gespendet. Die Tänzerin übergießt sich damit, wie eine spätere Szene zeigt.
Schulenburgs Haltung gegenüber den „Religiösen“ ist zwiespältig. Er ist auch „angewidert … von der Prozession“ (76). Sein Standpunkt ist der eines “aktiven Skeptizismus“. Er traut weder den Künstlern noch den Religiösen noch den Bürgern, er setzt auf die vernünftige, hilfreiche Tat. Sein Held ist Offizier und Ingenieur, ist ein Baumeister.
Doch immer wieder brechen in seinem Roman mythisch-symbolische Bilder durch. Sein Protagonist, „der Fremde“ genannt, verirrt sich am Ende in der Dunkelheit einer feuchten Felsgrotte, einer Höhle. Ein Mann, der als “Wanderer“ bezeichnet wird - wer könnte das sein? -, kommt ihm entgegen, hilft ihm lachend heraus und weist ihm den Weg zu einem Künstlerfest.
„Sie kennen den Weg sehr genau.“ (sagt der Fremde)
„O ja“, antwortete der Mann im Steigen, „ich gehe hier jeden Tag“.
„Und die Dunkelheit macht Ihnen gar nichts aus?“
„Nein, ich bin blind.“ (112)
In einer blumengeschmückten Halle wird der Abschluss der Wasserbauarbeiten gefeiert. Ein gütiger Berggeist tritt dort dem Fremden entgegen, weißbärtig, “umgeben von Göttern und Nymphen“ (113). Der Darsteller des Apoll greift zur Geige und begleitet das Melodram mit seiner Musik; sie mündet am Schluss in eine Fuge von Bach. „Drei Quellnymphen produzierten einen bewegten Tanz“ (116).
Es handelt sich um Theater, um Künstlertheater. In einem Spiel verbildlicht sich die Vision des blinden Wanderers in der Felsgrotte von Arcegno.
Dem Fremden wurde bei diesem kleinen Götterspiel religiös zumute. Er lachte, aber es war nicht das Lachen über einen scharfen Witz, sondern es war eines mit der tiefen, bejahenden Heiterkeit, die von dieser räumlich kleinen und sich geistig ins Endlose weitenden Bühne ausging. (115)
Der Blinde hatte dem Fremden den Weg ins Götterspiel gewiesen. Der lachende Wandrer, Täufer und Tomatendieb: ein blinder Seher.