Landkarte 1 - Die Haupt-Siedlungszentren
Deutschsprachiger im 19. Jahrhundert in Brasilien
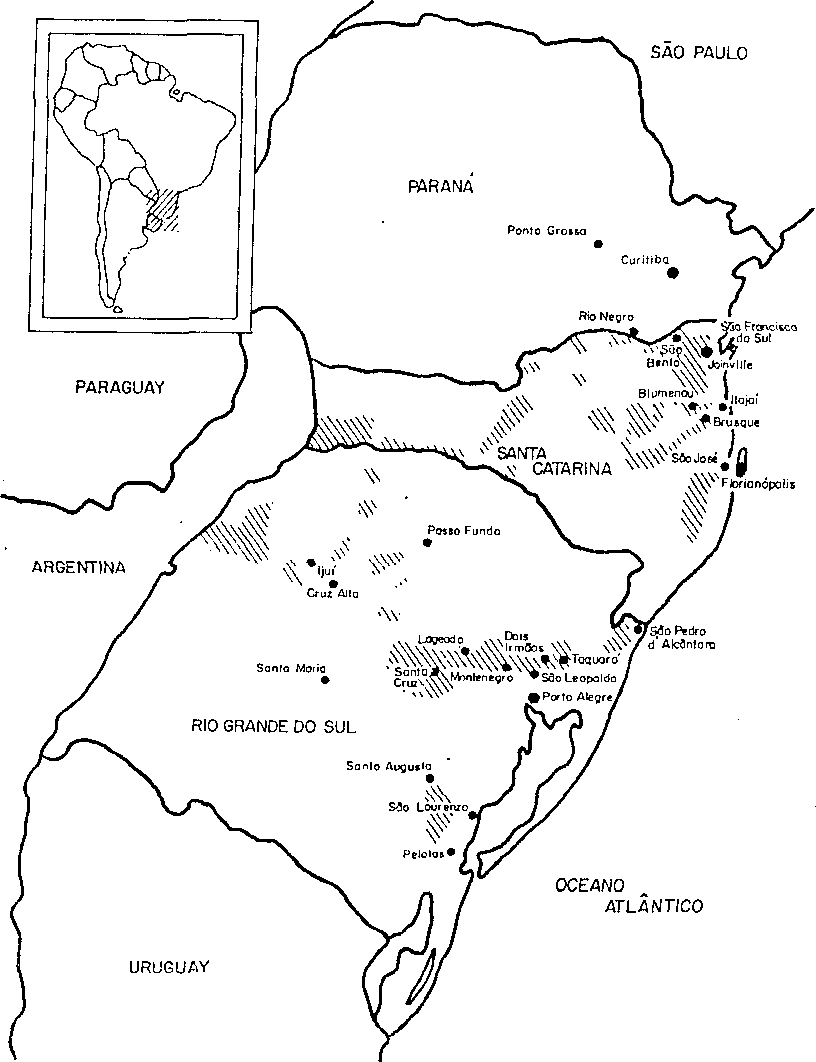 |
|
Dieses Dokument wurde von Marcus
Leicher bei einer Recherche zum
C.v.Schmidtz-Verlag in Ascona entdeckt und von Reinhard Christeller aus dem PDF umgewandelt und in der
deutschen Version weitgehend korrigiert, wobei
portugiesische und andere Zitate unbearbeitet
bleiben. Die portugiesische Version kann vielleicht im Antiquariat gefunden werden. |
Marionilde Dias Brepohl de Magalhães
DEUTSCHLAND, FERNES MUTTERLAND:
PANGERMANISTISCHE UTOPIE IM SÜDEN BRASILIENS
Dissertation zur Erlangung des Doktors
der Geschichte
Universidade Estadual
de Campinas
1993
INSTITUTO DE FILOSOFIA
E CIENCIAS
HUMANAS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
An Francisco, Maitê
und Daniel, in Liebe
Die abgeschlossenen Überlegungen dieser
der Universidade Estadual de Campinas vorgestellten
Doktorarbeit forderten von Seiten der Verfasserin eine mühsame
Analyse, die genauso die politische Geschichte Deutschlands
wie die von Brasilien berücksichtigen sollte. Und wie die
Haupthändler der hier untersuchten Ereignisse auch ich musste
von einem Land zum anderen; und dies brachte mir eine grosse
Annäherung mit meinem Forschungsobjekt.
Dieser Weg wäre nicht möglich, wenn ich
nicht die Hilfe von Freunden, Kollegen und Institutionen
rechnen könnte. Denen möchte ich hier in dieser Version auf
Deutsch meiner Arbeit meinen Dank ausdrücken.
Zuerst den Professoren Dr. Edgar S. de
Decca und Dr. Klaus Tenfelde,
bzw. Berater und Mit-Berater meiner Doktorarbeit. Beide
reizten mich an, die Forschungen in Deutschland und auch die
Untersuchungen in den Archiven der deutschen Einwanderung in
Brasilien zu unternehmen, ausserdem besprachen sie mit mir die
theoretischen Punkte, die diese Analyse orientierten.
Bei meinem Aufenthalt in München hatte
ich die Ehre Professor Dr. Martin Broszat,
vom Institut für Zeitgeschichte, kennenzulernen. Mit ihm
teilte ich einige meiner Gedanken in Bereich der
Historiographie sachgemäss dieser Thematik. Von dieser
Begegnung, leider durch seinen plötzlichen Tod unterbrochen,
blieb mir das Bild eines Intellektuellen, dessen persönliche
Unbescholtenheit und akademische Gelehrsamkeit uns junge
Historiker herausfordert, seinen Weg zu machen.
Mein ehrlicher Dank an Professor Dr.
Christian Meier, von der Universität München, dem ich meine
Ratlosigkeit angesichts der neuen und alten Nationalgefühle
äusserte.
Ich möchte auch noch gern Dr. Klaus
Richter, vom Staatsarchiv Hamburg erwähnen, Dr. René Gertz,
von der Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Rosalind Arndt-Schug,
Forscherin der Geschichte der deutschen Einwanderung in
Brasilien, die Angestellten des Instituts Hans Staden und Tereza Böbel, vom Arquivo Histórico de Joinville, welche mir in
verschiedenen Stufen der empirischen Forschung halfen.
Christiano und Angelika German waren
meine Familie, als ich in Deutschland wohnte, und Ellen Drünert, meine deutsche Schwester in
Brasilien.
Milda Gevert
Brepohl und Ingrid Enke leisteten
eine entscheidende und unerlässliche Hilfe bei der Version
dieser Arbeit in deutscher Sprache. Sie sind die tatsächlichen
Verantwortliche für die eventuellen Errungenschaften zugehörig
dem Abenteuer des Umformens von den in meiner Muttersprache
formulierten Ideen in anderer Sprache, hauptsächlich wenn es
sich um die deutsche Sprache und Sozialwissenschaften
handelte.
Endlich äusserte ich meine Dankbarkeit
dem Deutsche Akademische Austauschdienst - DAAD, der in
Zusammenarbeit mit dem Comissão
de Aperfeigoamento de Pessoal do Ensino
Superior - CAPES, mein Studium in Deutschland im Jahr 1988
finanziell unterstützte.
I. DIE EINWANDERER DEUTSCHER HERKUNFT IM
SÜDEN BRASILIENS
Neue Immigranten aus einem neuen Land
Die
Einwanderung zur Zeit der Republik
II. BILDER AUS DEN DEUTSCHEINWANDERERN IN
DER BRASILIANISCHEN LITERATUR
Der
Deutsche als Verkörperung des Deutschtums
Der Deutscheinwanderer und der Zweite
Weltkrieg: aus dem Traum zum Alpdruck
HI. ALTE UND NEUE NATIONALISTEN: HEIMAT UND
VATERLAND
Das
Deutschtum und das Auslandsdeutschtum
Das Deutschtum in der Öffentlichkeit: der Krieg
1917
Allgemeine Betrachtungen
IV. DAS DEUTSCHTUM UND DER
NATIONALSOZIALISMUS
V.
PIETISMUS, PATRIOTISMUS UND NATIONALSOZIALISMUS
Die
Evangelische Kirche deutscher Herkunft in Brasilien
QUELLEN UND LITERATUR
Eine der beunruhigendsten
Neuigkeiten der derzeitigen politischen Geschichte ist
zweifellos das Wiederaufleben der Konflikte wegen der
Nationalitäten, In diversen Ländern verfolgen zahlreiche
Völkerschaften, die sich selbst als Minderheiten darstellen,
im Namen ihrer völkischen Kultur oder ihrer Religion.
Projekte, die für ihre politische Emanzipation und die
Gründung neuer Nationen - eben der ihren - kämpfen. Im
Neu-Beleben des Wir-Gefühls gibt es durch ihre Übergeordneten
viel Unterdrückung; dennoch gibt es ihrer Meinung nach die
Möglichkeit, einen neuen sozialen Pakt gründen zu können, der
- nach ihren Vorstellungen - frei von politischer Macht derer
sein sollte, die eines Tages ihr Land annektieren würden.
Wie bereits im 19. Jahrhundert lehnen
diese Konflikte, die die Stabilität der offiziellen
Machtstellungen direkt angreifen, die Gesetze und Forderungen
der zweckmässigen Bestimmungen zugunsten der Gewalttätigkeit
und Sabotage ab; Taktiken, die unter anderen, die verwirrenden
Experimente des Neonazismus auszeichneten.
Es sind dies die Neu-Romantiker, die mit
denselben Waffen, die schon in der Vergangenheit jenen
dienten, die die modernen Staaten aufbauten, Reden und
Vorsätze aufstellen, die sich planmässig nach alten Prinzipien
der nationalen Vereinigung ausrichten. Aber - im Gegensatz zu
ihren Urhebern, die sich fest an die Vergangenheit hielten -
muss man doch sagen, dass dieser zeitgenössische Mythos
auszulegen ist als ein Beruhigungsmittel, das dazu dient, die
Angst vor der Zukunft zu nehmen.
Ganz gleich ob zu dieser oder jener
Jahrhundertwende, die utopischen Energiequellen, aus denen
sich diese politischen
Bewegungen nähren, sind die gleichen: der
Nationalismus, ein festgemauertes Gefühl, vielgestaltig und
unabänderlich auf einem allgemeinen Nenner. Ein Gefühl, das, -
nach Aussage von Snyder - indem es zum privilegierten Substrakt
der Politik wird, mobilisierende Kräfte entwickelt, die sowohl
zur Verteidigung der Friedensideen, Verbrüderlichung
und Gleichheit beitragen, wie auch zur Absonderung von
Andersdenkenden, Vorherrschaft und Krieg.
In der derzeitigen Zivilisation der
Technik, der Homogenisierung der Kultur durch die Mittel der
Massenkommunikation, der Internationalisierung der
Produktions- und Konsum-Normen und durch den scheinbaren
Triumph einer intimen Gesellschaft, zirkulieren, durch die
Winkelzüge öffentlicher Stellen, Mitglieder dieser neuen
Kaste, um Missklänge der Modernisierer-Utopien anzustimmen, -
sie selbst, wie eine der vielen Facetten der Modernität.
Diese allgemeine Bestürzung machte mich
aufmerksam auf ein Phänomen, das mit neuzeitlichen Ereignissen
sehr verwandt ist: den Pangermanismus, so wie er sich im Süden
Brasiliens abzeichnete; eine Bewegung, die sich am
Nationalismus inspirierte und in dem sich viele Träume der
Separatisten betreffs der Vereinigung widerspiegelten: eine
Bewegung, die tief in der deutschen Romantik verwurzelt ist,
jedoch auch mit Pragmatik an die imperialistischen Vorhaben
der Ausdehnung der Absatzmärkte und der Landaufteilung
verknüpft ist; eine Bewegung die zurückgriff auf juristische
und kulturelle Prinzipien, aber die den Hass und die
Gewalttätigkeit gegen seine Widersacher nicht ausliess; und
die, ähnlich seiner Urheber in Europa, zum Entstehen eines der
einzigartigsten Kapitel der deutschen Geschichte beitrug: dem
Nazismus.
Wie konnten sich nun die Eingewanderten
immer stärker zu treuen Bürgern der deutschen Nation
entwickeln, einem Land, das über 10.000 Km entfernt lag und
dessen Regierende ihnen wenig oder nichts für ihre täglichen
Notwendigkeiten garantierten? Warum sollten sie eine scheinbar
uninteressierte Liebe nähren für' Führungskräfte, die sie
selbst meist nicht mal wählen konnten?
Es waren die Mittel der
Massenkommunikation, die zu dieser Zeit der Technologie zur
Verfügung standen und die es ermöglichten, die Entfernung
zwischen dem Vaterland diesseits und jenseits des Ozeans zu
reduzieren. Schriften und Flugblätter in deutscher Sprache,
mit den verschiedensten Themen für die verschiedensten
Ansprüche verbreiteten sich immer stärker und sandten - mehr
oder weniger deutlich - eine Botschaft aus, die man unter
einem Motto zusammenfassen kann: "Vergiss nie, dass du ein
Deutscher bist!"
Indem man die Erst-Eingewanderten mit
der Beschuldigung des Vergessens quälte, garantierten die
Pangermanisten nicht nur die Festigung einer imaginären
Vorstellung der deutschen Nation über die Grenzen hinaus;
vielmehr förderten sie auch die Idee der sozialen Vereinigung
zwischen den Bewohnern der Kolonien, die zum Teil sehr
verstreut und isoliert lagen, begrenzt in ihrer kleinen Welt,
mit ihren eigenen heldenhaften Geschichten, ihrem beengten
Blickfeld über öffentliche Wirkungskreise, ihrer
schwerfälligen intellektuellen Denkungsweise, aber auch - wie
Walter Benjamin in Bezug auf den Provinzdeutschen bestätigt -
"mit lebhafter Innigkeit und edler Selbstgefälligkeit".
Unter diesen Bedingungen war grosse
Überredungskunst nicht erforderlich: aus ihrem Zustand der
Isolierung fanden sie leicht zur Disposition irrationaler
Träume; von ihrem pietistischen Erbe zur Wahrnehmung der
Lektüre, nicht als Behauptung, die angeklagt
würde, sondern als Offenbarung anzusehen; vom
Nicht- Vorhandensein der Veränderungen, rezeptives Betrachten
der verführerischen Propaganda; von Bauern, kleinen
Landbesitzern und Handwerkern begannen sie, sich in erster
Linie als Deutsche in Brasilien anzusehen.
Aber wenn der Alldeutscher Verband,
verantwortlich für die meisten Initiativen, die die
Ausbreitung der deutschen nationalistischen
Gesinnung zum Ziel hatten, ihnen die finanzielle Unterstützung
und die politische Ausdrucksweise lieferte, so provozierten
die Diskriminierungen der deutschen Immigranten und ihrer
Nachkommen aufgrund des Mythos der "deutschen Gefahr" in ihnen
die Überzeugung, dass sie eben effektiv Ausländer in Brasilien
waren; Diskriminierungen, die immer gegenwärtig waren, wenn
auch in
gedämpfter Form,
von Anfang des Einwandererprozesses an, einfach durch die
Tatsache, dass diese Deutschen die protestantische Religion
verkündeten, eine fremde Sprache benutzten oder eben nur
Handwerker waren.
Mit dem Aufkommen der nationalistischen Idee bei
der brasilianischen Elite, die durch die republikanische
Bewegung entstand, und besonders mit Ausbruch des ersten
Weltkrieges offenbarte sich das anti-germanische Denken sehr
aggressiv; in den Kriegsjahren zerstörte man "im Namen der
Vaterlandsverteidigung" Geschäfte, deutsche Vereine und Klubs,
zerbrach die Bilder ihrer Nationalhelden, zerriss ihre Fahnen
und verbot den Druck ihrer Zeitungen. In den meist
verbreiteten Zeitschriften beglaubigte und stimulierte man
diese Vergeltungsmassnahmen: die Deutschbrasilianer wurden als
Spione verurteilt, als Verräter und Feinde
aller anderen
Völker, die eine gerechte
Strafe verdienten:
"Es lebe Brasilien, nieder mit Deutschland?". So grölte das
Volk auf den Strassen.
Seit dieser Erfahrung schlossen sich die
Einwanderer und ihre Nachkommen zusammen in dem gleichen
Gefühl der Niederlage ihrer deutschen Landsleute: sie zogen
sich in ihre Vergangenheit zurück' und bestätigten ihren
Pangermanismus in der Mission, ihn zu vertreten. Sie halten
sich für missverstanden und verachtet und prangern den
Charakter der Gleichschaltung mit den von ihnen als Luso-Brasilianern bezeichneten in den
offiziellen Berichten an. Ihre Sprache vereinheitlichend
fühlen sie mehr denn je die Notwendigkeit, ihre innere
Einstellung und ihre Ausdrucksweise nach aussen hin zu
bestätigen. Und je mehr sie sich ihrer Vergangenheit bewusst
werden, desto mehr distanzieren sie sich von Brasilien und
sehnen sich nach einer Rückkehr ins Vaterland; bis - nach
Auslegung der Pangermanisten - sie der deutschen Nation näher
kommen würden, was für sie einen endgültigen Sieg bedeute.
Diese Ereignisse stellen das Objekt
dieser Forschungsarbeit dar; der Pangermanismus in Süden
Brasiliens von seinen ersten Schritten der Entstehung bis zum
Beginn des zweiten Weltkrieges, entnommen aus der Literatur,
die von Journalisten, Politikern und Schriftstellern
geschrieben wurde, die sich auf diese Lehre festgelegt hatten.
Diese Unterlagen werden von uns jedoch nicht angesehen als
reine historiografische Quelle, sondern ein auf sich
beruhendes Ereignis, ausschlaggebend für den hier zu
behandelnden historischen Prozess. Ich verstehe darunter, so
wie Jürgen Habermas, dass die Wandlungen, die die
Öffentlichkeit in den letzten zwei Jahrhunderten durchmachten, in
festem Zusammenhang stehen mit der Kommerzialisierung und der
Ausbreitung der "Massenmedien", welche sich an eine
Verbrauchergesellschaft wenden, die immer gieriger das
geschriebene Wort aufnimmt und dadurch zur
Bildung ihrer Meinung über Politik, Gesellschaft und Kultur
gesteuert wird. Aus diesem Grund halte ich Abstand zu den
Auslegungen, die das für die Masse Gedruckte als reines
Phänomen der politischen und ideologischen Entwicklung
verstehen. Man muss den besonderen Gehalt dieser schriftlichen
Unterlagen erforschen, oder die Kultur als soziale Erfahrung sehen
und in Anbetracht dessen den verschiedenen Solidaritäten
innerhalb der Kultur, der Politik, und der Persönlichkeit
eines jeden Aufmerksamkeit schenken, Solidaritäten, die aus
dem kommunikativen Handel hervorgehen und durch die Sprache
vermittelt werden.
Und zu diesen oben erwähnten Dingen füge
ich meine Überlegungen denen von Hannah Arendt
und Theodor Adorno bei, Schriftsteller, die sich sehr
gründlich damit beschäftigten, die Massenkultur 2u enthüllen und eine ihrer wichtigsten
Entfaltungen: das Phänomen des totalitären Staates, in dem die
aufgeklärten Utopien mundtot gemacht werden durch die
Verführungskunst der Worte.
Im 1. Teil meiner Arbeit, die in drei
Kapitel unterteilt ist, versuche ich, das Erscheinen der
pangermanischen Kultur im Süden Brasiliens und seine
Interferenzen im journalistischen Diskurs der
Deutschbrasilianer zu erklären.
Die Zeitungen und literarischen Texte,
die für diese Analyse ausgewählt wurden, unterliegen den
Publikumskriterien, das heisst, sie waren die vom Konsumenten
"Leser" meist gelesenen. Es erscheint mir auch als wichtig,
die von diesem Gedruckten ausgeübten Funktionen zu erwähnen,
die diese zu den verschiedenen Zeitabschnitten, in denen sie
verbreitet wurden, hatten.
Ich möchte ausserdem das von den
intellektuellen Brasilianern angefertigte Image über die deutschen Einwanderer
hervorheben, wenn ich mich hierbei auch auf Autoren sehr
hochgestellter Gedanken in Brasilien beschränken muss. Dieses
Kapitel bezweckt, die Darlegungen des Mythos der deutschen
Gefahr zu analysieren, angesichts der begrifflichen
Verarbeitungen, die nach dem Aufbau der nationalen Identität
verlangten - einem wichtigen Teil zur Bestätigung einer
allumfassenden Politik, die im Auge hatte, den Staat als
Zentrum für Auseinandersetzungen von Privatinteressen
anzusehen.
In diesem Vorgang muss man erkennen,
dass die verschiedenartigen Kulturen und politischen
Überzeugungen, die aus diversen Einwanderergruppen stammen,
ausgelegt wurden als "die anderen" dieser Gesellschaft, von
ihnen selbst als Luso-brasilianisch
benannt,
einer homogenen Bezeichnung mit der man beabsichtigte, das
ganze Kulturgebiet zu umfassen, einem wichtigen Dokument der
offiziellen Politik, die vorhatte, sich zu legitimieren.
Im 2. Teil meiner Arbeit beschäftige ich
mich mit der Einmischung der nationalsozialistischen Bewegung
in den Pangermanismus Südbrasiliens. In diesem Zusammenhang
versuche ich, nicht nur die Rolle der Presse als Instrument
der politischen Propaganda einzuschätzen, sondern auch die
daraus entstandene religiöse oder weltliche Literatur. Ich
analysiere ausserdem die Strategien, die die Nazisten zur
Ausbreitung ihrer Lehre einsetzen und in welchem Umfang diese
von der Leserschaft aufgenommen wurden. Um meine Erkenntnisse
zu gewinnen, habe ich nicht nur die Zeitungen und andere
Veröffentlichungen in Brasilien untersucht, sondern auch die
direkt von der nationalsozialistischen Partei kommenden,
welche sozusagen als Sprachrohr der Anführer des Regimes
agierten. Diese Dokumentation integriert die gesamte
Korrespondenz und die offiziellen
Veröffentlichungen der NSDAP für das Ausland, Abteilung
Lateinamerika, einem Kontinent, der das Interesse des
nationalsozialistischen Militärs verdiente, einerseits wegen
der hier ansässigen deutschstämmigen Bevölkerung, andererseits
wegen der vermeintlichen Treue derselben zu ihrem
Herkunftsland.
Zum Schluss analysiere ich die
feststehenden Bindungen zwischen der religiösen Ausdrucksform
(der Protestantismus), dem Pangermanismus und dem Nazismus,
von einem methodologischen Verhalten an, was sich von den
vorhergehenden Kapiteln unterscheidet. Ich lasse mich dabei
leiten von den Schriftstücken eines einzigen Autors, einem
protestantischen Pastor, der auf einzigartige Weise diverse
Ereignisse der deutschen Geschichte miterlebte und der 1925
nach Brasilien auswanderte, wo er als Journalist, Prediger,
Schriftsteller und freiwilliger Vertreter nationaler
Interessen für seine immigrierten Landsleute tätig war.
Zusammen mit ihm versuche ich, die
Wechselseitigkeit zwischen der weltlichen und der religiösen
Ausdrucksweise festzustellen, die Konflikte zwischen den
Nazisten und den Pangermanisten, den Prozess der
Verweltlichung des Pietismus und der Sakralisation
der weltlichen Werte. Aber vor allem - im Gegensatz zu den
vorangegangenen Analysen, in denen man die Beziehung zwischen
der Presse, der Vorbilder und der öffentlichen Meinung zu
beweisen suchte - ist mir hierbei wichtig, die vielfältigen
Ausgangspunkte zu erforschen, die den Einzelnen an die
Gesellschaft fesseln, in die er sich einfügt, die Gründe
seiner Handlungen, die Beziehungen seiner inneren Gedanken zu
seinem ausgesprochenen Wort, seiner kulturellen Mentalität,
die sich im Moment eines Konfliktausbruchs in eine politische
Gesinnung verwandelt - ein überaus wichtiger Faktor, um
diejenigen zu verstehen, die sich zu totalitären Bewegungen
und Ausdrucksformen hinreissen liessen.
DIE EINWANDERER DEUTSCHER
HERKUNFT IM SÜDEN
Wir riefen Arbeitskräfte und Menschen kamen.
Max Frisch
Während des ganzen 19. Jahrhunderts
verliessen ca. 57 Millionen Europäer ihre Länder und Hessen
sich in Amerika nieder, um dort zu bleiben und einen neuen
Überlebensraum zu schaffen. Bauern und Handwerker, Arbeiter
und Intellektuelle, die durch politische oder religiöse Gründe
diskriminiert wurden, kamen in die "Neue Welt", um ein neues
Leben zu beginnen und somit ein neues Kapitel in der sozialen
Geschichte einzuleiten.
Diese Initiativen wurden durch eine
intensive Propaganda begünstigt, die durch das Interesse der
Elite der aufnahmebereiten Regionen veranlasst wurde, um neue
Bevölkerungsgruppen für einen Aufschwung in der
Agrarproduktion, für eine planmässige Besetzung des Landes und
als Nachschub von qualifizierten Arbeitskräften in den
aufkommenden Industrien zu gewinnen.
Die ersten Masseneinwanderungen nach
Brasilien hatten in der grossen Mehrheit die Lohnarbeit in den
grossen Hauptstädten als Ziel, wo die Industrialisierung
langsam aufkam, oder in den Kaffeepflanzungen, als Ersatz für
die Sklavenarbeit.
Im Süden haben die Einwanderer
unabhängig von der zentralen Ökonomie
Bewirtschaftungen
betrieben, indem sie sich fast ausschliesslich der
Landwirtschaft auf kleinem Raum gewidmet haben. Diese neuen
Siedlungen sollten die leeren Grenzgebiete bevölkern, um sie
dem Land zu erhalten und um den Markt im Inland' mit
Nahrungsmitteln zu versehen.
Dadurch wurde die Einwanderungspolitik
in Zusammenhang mit der Niederlassung von Kolonisten auf
kleinen Besitzen oftmals mit der Kolonisierung verwechselt, da
es sich nicht um eine selbständige Bewegung handelte, sondern
von offiziellen Mächten bestimmt, sei es von der zentralen
oder von der regionalen Regierung (ROCHE, 1969). Die
Einwanderer erhielten normalerweise durchschnittlich 25 Hektar
Land, in praktisch unbewohnten Gegenden, um sich der
Landwirtschaft zu widmen, ohne dass sie von Sklaven Gebrauch
machen konnten.
Was deutschsprachige Einwanderer
anbelangt, steht Brasilien an 2. Stelle in Amerika, als Land,
das diese Einwanderer aufgenommen hat. An 1. Stelle stehen die
Vereinigten Staaten, wie es aus der nachstehenden Tabelle zu
entnehmen ist:
TABELLE 1 -
Empfangsländer der deutschsprachigen Einwanderer
|
|
Canada Argentinien |
|
|
QUELLE: MARSCHALCK, 1973, S. 50
Obwohl Brasilien mit dem Ziel der
deutschsprachigen Einwanderer in Amerika an 2. Stelle steht,
haben diese sich in der Zeit der grossen transkontinentalen
Immigrationen nicht inmitten anderer Einwanderungsgruppen
hervorgehoben. Obwohl dieses die 1. Gruppe der in Massen nach
Brasilien eingewanderten ist, macht sie nur 9% der ganzen
Einwanderer aus zum Beispiel waren in Curitiba nur
13,3% deutscher Herkunft, während zwischen 1886 und 1939 die
Polen 49% der Einwanderer ausmachten. (BIDEAU u. NADALIN,
1988). In Porto Alegre waren es im Jahre 1920 nur 12% der
ganzen Bevölkerung. Und in Rio Grande do Sul, dem
Staat, der die meisten Einwanderer deutscher Herkunft bekam,
machen sie in den 30er Jahren nur 19,3 % der Bevölkerung aus
(GERTZ, S.20).
Indessen, wenn der numerische Anteil,
verglichen mit anderen Einwanderungsgruppen, klein ist, heben
sie sich andererseits hervor durch die demographische
Konzentration in bestimmten Gebieten, summiert zu der hohen
Fruchtbarkeitsrate (im Durchschnitt 8 bis 9 Kinder bei Frauen,
die zwischen 15 und 19 Jahren heiraten, und 7 Kinder bei
denen, die zwischen 20 und 24 Jahren heiraten (BIDEAU u.
NADALIN, 1988, S.1049). Dieses Wachstum bestimmte die
Vergrösserung der Kolonien, sowie auch Übersiedlungen in nahe
oder weiter entfernte Regionen von Rio Grande do Sul, Santa Catarina
und Paranä.1
Während der kaiserlichen Regierung die
Einwanderung deutscher und italienischer Herkunft anregte, um
unter anderem den kleinen Landbesitz zu stimulieren, und da
diese Länder keine imperialistischen Kolonien in Amerika
besassen, bedeutete das dann auch kein Risiko für die
portugiesische Oberherrschaft, aber die herrschenden Klassen
des Landes waren dagegen. Sie sahen in der
Einwanderungspolitik die Ankündigung der Abschaffung des [2]
Sklaventum und in der Landaufteilung eine
Bedrohung ihrer eigenen Gebietsausbeute in grosser Skala.
Seitens der preussischen Regierung konnte man auch keine
günstige Haltung
gegenüber der
Auswanderungen nach Brasilien beobachten. Ihr Interesse
beschränkte sich ausschliesslich auf den Handel von
Rohstoffen, da auch die brasilianischen Grenzen noch nicht
festgelegt waren, was ein schwerwiegendes Risiko für eine
stabile Kolonisierungspolitik bedeutete. Die Nachrichten über
die Behandlung der freien Arbeiter, die in der europäischen
Presse durch Schriftsteller wie Davatz
[3]
verbreitet wurden und die Aufrechterhaltung des
Sklaventums waren massgebende Gründe, um die Einwanderungen zu
verhindern. Auch der katholische Glaube, als offizielle
Religion, beschränkte die Rechte der Einwanderer anderer
Konfessionen, indem sie rechtmässiges Heiraten und so auch die
Regelung von Erbschaften verhinderte. Das waren, unter
anderem, die Gründe, die 1859 zur Herausgabe des "Dekrets von
Heydt" geführt haben, das den Immigrationsagenten verbat,
preussische Bürger nach Brasilien anzuwerben (BRUNN, 1971).
Zu Bismarcks Zeiten hat sich die
offizielle Haltung kaum geändert. Für den Kanzler gehörte
Brasilien unter Nordamerikas Einfluss, zu dem er weiterhin,
für eine bessere Durchführung der geschäftlichen Verbindungen,
gute diplomatische Beziehungen pflegen wollte. Ausserdem fand
er, dass Deutsche, die ihr Land verliessen, richtige Verräter
wären. Seiner Ansicht nach:
Ein Deutscher, der sein Vaterland
abstreift wie einen alten Rock, 1st für mich kein Deutscher
mehr, Ich habe kein landsmannschaftliches Interesse mehr für
ihn. (apud BRUNN, 1971, S.127)
Trotz der offiziellen Einschränkungen
sind etliche Gruppen deutscher Abstammung nach Brasilien
eingewandert, sei es durch Initiative der brasilianischen
Regierung, die bis 1830 ca. 6.000 Deutsche nach São Leopoldo
in Rio Grande do Sul brachte und auch kleinere Ansiedlungen
in anderen Staaten gründete, sowie auch durch
Privatinitiativen (BRUNN, S.4).
Um die Opposition, die die
brasilianische Elite auf die kaiserliche Regierung ausübte, zu
umgehen, wurde 1824 eine Zusatzverordnung eingeführt, die den
Provinzen die Initiativen gab, die Einwanderungen selbständig
zu fördern. In den darauffolgenden Jahrzehnten verfügen Santa
Catarina und Rio Grande do Sul über
eine Gesetzgebung, die das Kommen ausländischer Arbeiter
offiziell begünstigt. Ab 1882 wurde ausser den
Provinzregierungen auch den Bürgermeisterschaften das Rechte
zur autonomen Kolonisierung ihrer Ländereien gegeben (DREHER,
1984, S.34).
Der Staat Rio Grande do Sul hat die offizielle deutsche Einwanderung am
meisten gefördert, an 1. Stelle wegen des Erfolges der ersten
Erfahrungen und an 2. Stelle, weil es den Interessen der
Viehzüchter entsprach, die in der Mehrheit im Süden der
Provinz waren. Da die Abnehmer ihrer Produkte sich im Norden
des Landes befanden, gewährte ihnen die Besetzung dieses
dazwischenliegenden Gebietes eine bessere Infrastruktur für
den Transport ihrer Produkte; der Wald wurde abgeholzt und
Wege wurden durch die Einwanderer geschaffen, die dann auch
selbst zu Abnehmern ihrer Produkte wurden. Ausserdem sicherte
diese totale Besetzung des Landes die einigen Grenzen. Dadurch
gründete die Regierung von Rio Grande do
Sul zwischen
1849 und 1918-22 Kolonien mit deutschsprachiger
Bevölkerung.
In Santa Catarina war
die offizielle Initiative viel weniger ausgeprägt. Es hat sich
nur die Kolonie São Pedro de Alcantara hervorgehoben,
die 1829 noch durch die zentrale Regierung gegründet wurde,
und Brusque, die
1961 9.000 Kolonisten in dieses Gebiet brachte. Die
wichtigsten Kolonien dieses Staates sind der privaten
Initiative zu verdanken, wie die des Hermann Blumenau's, der 1848 eine Agrarkolonie
gründete, die seinen Namen erhielt, und später auf seine Bitte
offizialisiert wurde und die Unterstützung von deutschen
Privatunternehmen erhielt.
Zu dieser Zeit, politisch wie auch
ökonomisch gesehen, kam die wichtigste Unterstützung für Santa
Catarina aus Hamburg. Dort beginnt, im Gegensatz
zur offiziellen preussischen Politik, die Privatinitiative
ihre Aktivität, um Kolonisten in Brasilien anzusiedeln, die
nicht einmal durch die deutsche Vereinigung unterbrochen wird.
Es handelt sich um d i e "Kolonisationsgesellschaft von
Hamburg", der sich dafür eingesetzt hat, von 1850 bis 1888
17.408 Kolonisten nach Joinville und Umgebung zu bringen. Ab
1887 schloss sich dieser Verein an Bankiers und Industrielle
aus dem Rheinland und Berlin an, unter der Führung von Carl
Fabri, einem enthusiastischen Nationalisten, der die utopische
Vorstellung hatte, in Santa Catarina eine
teuto-brasilianische Republik zu
gründen und somit die deutsche Anwesenheit in Latein-Amerika
zu garantieren. Seiner Meinung nach hätten die Einwanderer
dieser Herkunft dafür schon eine autonome Gruppe in der sie
aufnehmenden Gesellschaft gebildet und besassen, laut Fabri,
eine höhere Kultur als die bereits Ansässigen. Er hoffte, dass
sie sich natürlicherweise den Interessen des Deutschen Reiches
anschlossen und dadurch einen Abnehmermarkt
grossen Ausmasses schufen.
Der Norddeutsche Lloyd aus Bremen, als
grösste transatlantische Schifffahrtsgesellschaft in
Deutschland, war seinerseits verantwortlich für die
Einwanderung von 47.000 Menschen' im Jahre 1890. Es handelte
sich um ein grosses Geschäft, das durch Propaganda und durch
verschiedene Einwirkungen öffentlicher Stellen angespornt
wurde. Daraus entstand der Zusammenschluss von der
Kolonisationsgesellschaft von Hamburg mit dem Norddeutschen
Lloyd und der Südamerikanischen Dampfschifffahrtgesellschaft,
was die "Hanseatische Kolonisationsgesellschaft'’
hervorbrachte, und die dann nicht nur für den Transport der
Immigranten verantwortlich waren, sondern auch für den Kauf
der Ländereien und für die Organisation der Kolonien in Santa
Catarina (RICHTER, 1986).
Dieses sind die ausdrucksvollsten
Beispiele der Initiativen, die die deutsche Einwanderung nach
Brasilien angespornt haben. Sie gehören zu den Massnahmen, die
durch öffentliche und private Initiativen in Amerika und in
Europa begonnen wurden, die die Bevölkerung in eine "teure
Ware verwandelte; eines Geschäftes, das Banken,
Transportgesellschaften und Makler mit verwickelte und zu
gleicher Zeit das Problem der überflüssigen Arbeitskraft in
Europa und der fehlenden Arbeitskraft in Amerika löste.
Dennoch geschah die Auswanderung nicht
immer aus zwingenden Gründen. Viele Europäer verliessen ihr
Herkunftsland auf der Suche nach neuen und besseren
Lebensbedingungen und in der Hoffnung, ihr Kapital zu
vergrössern, oder aber - im Falle vieler deutscher
Immigranten- war die Abwanderung eine Strategie der Auflehnung
gegen die Proletarisierung. Dirk Hörder, (1988, S.391- 425),
weist daraufhin, dass etliche Facharbeiter Deutschland verliessen, in Amerika autonome Fortbestehungsformen in
Handwerksbetrieben neu zu schaffen. Nach Ansicht des Autors
handelt es sich hierbei nicht um Völkerwanderungen zwischen
verschiedenen Ländern, sondern zwischen Arbeitsmärkten, welche
seit jener Zeit als internationaler Austausch einfach
notwendig sind.
Die Schlussfolgerungen von Hörder werden
durch die empirischen Forschungen über die ersten Einwanderer
von São Leopoldo bestätigt. Obwohl sie nach dorthin
auswanderten, um sich ausschliesslich landwirtschaftlichen
Tätigkeiten zu widmen, ist zu beobachten, dass ca. 60% von
ihnen nebenher auch noch anderen Beschäftigungen nachgingen.
Diese wurden ganz offen angeben in der Absicht, ihren
eigentlichen Beruf zu erwähnen. Die von ihnen entwickelten
Arbeitstechniken wurden vom Vater an den Sohn weitergegeben -
ein Überbleibsel aus der deutschen Kultur des Mittelalters,
und die ihnen ein zusätzliches Einkommen brachten und
gleichzeitig einen besseren Status verlieh als den
Ungelernten. Diese Spezialisierungen, wie zum Beispiel
Tischler, Metzger, Weber, Müller usw. erleichterte ihnen
garantiert den Anschluss an das Stadtleben, während viele
andere wegen der Landzersplitterung durch Erbschafts-
Aufteilungen wieder ausgewandert sind (WEIMER, 1979).
In den Dokumenten über die ersten
Einwanderer in Brasilien steht, dass diese Gruppen in ihrer
grossen Mehrheit aus heimatlichen Landgebieten kamen, die
schon zu stark besiedelt waren. Sie sahen in Amerika die
Möglichkeit der Verwirklichung ihrer Träume von der "Neuen
Welt", in der es keine Könige, Feudalherren und Knechtschaft
gab. sondern jede Menge Land und Arbeitsmöglichkeiten:
Aqut näo podemosflcar Aqui
não podemos
volver Pois
os Hassten
e os notaries
Nos tiram a malar parte [4]
Vamos parttr agora Para
o belo pais
America Coda qual
amt me
sua trouxa So as diDldas deLxamos aqui [5]
[6]
Adeus pdtrta mal agrndecida Vamos para uma outra
terra Vamos para
o Bras/I
Partimos com a mulher e aßlharada Emtgramos para a terra promettda
All se encontra ouro coma
areia Logo, logo, estaremos no
Brasil 3
Diese Lieder verdeutlichen die Haltung
der Immigranten ihrem Herkunftsland gegenüber und ihre
Erwartungen, die sie dem neuen Ziel entgegenbringen. Diese
Erwartungen entstanden durch die Propaganda der
Kolonisationsbetriebe oder durch Nachrichten von Verwandten
und Freunden, die schon ausgewandert waren. Im Gegensatz zu
der Literatur, die sich dem Leben der ersten Auswanderer
widmet, zeigen diese Lieder, dass die Vaterlandsliebe und die
Gewissenhaftigkeit, die deutsche Rasse fortzusetzen, kein
Bestandteil mehr dieser sozialen Gruppen waren, was sie jedoch
nicht
hinderte, dass sie Traditionelles aus der
Vergangenheit holten, was dem Nationalismus ihrer Nachkommen
eine Ehrung erweisen würde.[7]
In der grossen Mehrheit waren es Bauern,
die selten dem staatlichen Leben verbunden waren. Obwohl sie
den König und seine Sinnbilder vergötterten, war ihr
patriotisches Gefühl nur an die Erde und den Ort, wo sie mit
ihren Familien und Nachbarn wohnten, gebunden und nicht an ein
weites Land, das man eine Nation nennen konnte.
Wenn sie sich in andere Regionen
begeben, holen sie ihre ursprünglichen Traditionen wieder
hervor, die sich mit denen der Empfangsgesellschaft
vermischen, wie Goethe es in dem nachfolgenden Vers
symbolisiert:
Ficar. Ir, ir.ßcar
Seja tgual para o homem
capaz
Onde produzlmos
algo ütil
Este 6 o lugar que methor
nos siwa. [8]
Ab 1848 kommen zu den Auswanderern, die
ihre Länder aus ökonomischen Gründen verlassen, die Verbannten
und die, die freiwillig wegen politischen Gründen auswandern.
Es sind die sogenannten ”1848er. Kinder", die
"Märztage-Männer", oder volkstümlicher noch, die "Brummer".
Ausser ihren Frustrationen über den Misserfolg im Zusammenhang
mit der Entwicklung jener politischen Bewegung, unterscheiden
sich diese liberalen, romantischen Nationalisten oder
Sozialisten von den Pionieren durch ihre beruflichen
Tätigkeiten: sie sind in der grossen Mehrheit
Handwerker, Intellektuelle oder in einer
kleineren Skala auch Angestellte. Die Tatsache, dass sie in
offiziellen Statistiken als Bauern erscheinen, wird den
Bedingungen zugeschrieben, die den Auswanderern gestellt
wurden - es sollten vorwiegend Landwirtschaftsarbeiter sein.
Um die Auswanderungsrechte zu' erhalten, schrieben sie sich
als Bauern ein, und sobald sie angekommen waren, siedelten sie in die
nächstliegenden Städte um. Wenn das nicht möglich war,
betrieben sie neben der Landwirtschaft auch noch irgendein
kleines Handwerk, was dann langsam für das Erschein von den
ersten kleinen und mittleren städtischen Siedlungen in diesen
Regionen verantwortlich war.
Aus den Dokumenten, die ich über die
ersten Einwanderer der Kolonie "Dona Francisca" fanden, welche
von der Hanseatischen Kolonisationsgesellschaft organisiert
wurde, lässt sich die Existenz von mindestens 40 Berufen, die
dem städtischen Milieu entsprechen, feststellen. Tischler,
Schneider, Schuster, Mechaniker, Schlachter, Bierbrauer,
Müller, Bäcker, Klempner, Buchdrücker, unter anderen, sind die
Berufe, die mehr als die Hälfte der Einwanderer dieser Kolonie
zwischen 1852 und 1864 ausüben.[9]
In diesen Dokumenten stellt man auch fest, dass diese
Facharbeiter nicht länger als ein bis zwei Jahre in dieser
Gegend blieben und dann nach Curitiba, Porto
Alegre oder São Paulo umsiedelten.
Weimer hat das Verhältnis zwischen dem
Beruf der Immigranten und der Gesellschaft des Landes in São
Leopoldo ausführlicher studiert. Er stellte fest, dass
zwischen 1845 und 1899 sich 46% dem landwirtschaftlichen
Milieu widmeten, während 53,9% im städtischen
Bereich waren, wo die beruflichen Qualifikationen
zu dieser Zeit spezialisierter waren und durch das relative
Wachstum des Abnehmermarktes begünstigt. Obwohl der Autor
seinen Artikel mit As
profissões dos imigrantes alemães
no Rio
Grande do
Sul
(Berufe der
deutschen Einwanderer in Rio Grande do Sul) bezeichnet,
bezieht er selbst in diesen auch Menschen aus Holland, der
Schweiz, Schweden, Dänemark, Österreich, Serbien, Mähren und
Russland mit ein; eine wichtige Bemerkung. um die
homogenisierenden Analysen, die über diese Bevölkerung gemacht
wurden, zu bestreiten (WEIMER, 1979, S. 307-19).
Die Beziehung von den "Brummern" zu den
ersten Einwanderern war auch nicht einfach. Sie wurden als
Intellektuelle Stadtmenschen gesehen, deren Sprache beinahe so
unverständlich wie die portugiesische Sprache war. Langsam
unterschieden sie sich auch durch ihre Kaufkraft und bald auch
dadurch, dass sie sich leichter in das öffentliche Leben
einfügten. Durch diese Unterschiede wurden sie bald zu
Vertretern dieser Gruppe, wie zum Beispiel Männer wie Karl von
Koseritz in Porto Alegre und Ottokar Dörffel
in Joinville. Ersterer war Journalist, Verleger, staatlicher
Abgeordneter und Verwalter der Interessen der deutschen
Bauern, was ihr Grundvermögen anbetraf. Der andere war Gründer
der Zeitung "Kolonie", der erste Zeitung in deutscher Sprache,
und er war auch der erste Bürgermeister der Stadt.
Diese beiden Abschnitte der Einwanderung
stellen die erste Phase der Besetzung mit europäischer
Bevölkerung, die deutsch sprachen, im Süden dar, die trotzdem
untereinander bedeutende interne Unterschiede aufweisen, die
erst im Laufe der Zeit durch den sozialen Umgang gemildert
wurden. Die generische Bezeichnung "Deutsche" oder "Landwirte"
muss durch eine sorgfältigere empirische Nachforschung
klargestellt werden, die nicht versuchen sollte, in der
Vergangenheit ein Bild zu entwerfen, dass nur in
Äusserungen der Verteidiger oder Kritiker ihrer kulturellen
Organisation ab Beginn des 20. Jahrhunderts einen Sinn hätte.
[10]
Im Gegensatz zu den geläufigen
Behauptungen der traditionellen Historiographie hielten sich
dieses Eiwanderungsgruppen der erste' Phase nicht abseits der
Politik. Im Gegenteil: sie nahmen an der Politik teil, sowie
es zu ihrer Zeit und in ihrem Milieu möglich war. Sie
gründeten Vereine zur gegenseitigen Hilfe und zur Beschützung
ihrer Dörfer wie zum Beispiel die Schützenvereine. Mit eigenen
Mitteln gründeten sie Schulen und Kirchen, sowie auch
Freizeiteinrichtungen wie Verkaufsstände, Kneipen und
Bierstuben (AMADO, 1978). Ausserdem organisierten sie einen
Gemeindeart, der über interne Konflikte entscheiden und sie
den Autoritäten der Provinz übermitteln sollte. Sie blieben
relativ isoliert von der Gesellschaft ihres Einwandererlandes,
wegen der Unkenntnis der neuen Sprache und auch wegen der
geographischen Lage ihrer Ansiedlungen. Wenn sie in grössere
Zentren abwanderten, integrierten sie in die soziale Schicht,
die ihrer eigenen entsprach und traten unter grösseren oder
kleineren Schwierigkeiten den kulturellen Diskriminierungen
entgegen. Wie auch die Immigranten anderer ethnischer Gruppen
hielten sie eine gewisse Verbindung zum Herkunftsland aufrecht
durch Briefwechsel mit Freunden und Verwandten, aber sie
träumten nicht von einer Rückkehr, weil sie im speziellen Fall
der preussischen Regierung und der Junker, die die Oberhand
hatten, als Verräter, Deserteure und Verächter der
Lohnabhängigen angesehen worden waren. Sie
mussten sich an Amerika oder an ihre Kolonie, an den Kaiser
oder den Bürgermeister, ans Klima und an die Arbeit anpassen;
letzten Endes an ihre neue Heimat, soweit man diese nicht mit
dem Begriff von Nation und Regierung in Verbindung bringen
würde; und ihrer Meinung nach' passten sie sich gut an.
Neue Immigranten aus einem neuen Land
Ab 1870 kommen andere Arbeiter nach
Brasilien und mit ihnen ihre Erfahrungen aus ihrem Heimatland.
Bezüglich der deutschen Einwanderer sind es nicht nur
ehemalige Bauern aus kleinen Dörfern oder städtische
Angestellte, die aus der Proletarisierung flüchten; sie waren
inzwischen vielmehr "Bürger des Reiches", das ein vereintes
Deutschland war; und obwohl dieses zu der Zeit weiter
Arbeitskräfte hinauswirft, haben die Auswanderer doch immer
noch ein starkes Zugehörigkeitsgefühl, gefördert in
Grundschulen oder die Literatur, die einen immer grösseren und
anhänglicheren Leserkreis erobert.
Statistiken beweisen uns, dass im
letzten Drittel des 19. Jahrhunderts die Zahl der Immigranten
viel ausgeprägter ist als in den vorhergegangenen Jahrzehnten.
Dieser neue Impuls ist zurückzuführen auf die ökonomische und
politische Entwicklung beider Länder. Die starke
Industrialisierung in Deutschland, der relative Erfolg der
Einwanderer-Propaganda, teils durch die Presse, teils durch
die eigenen Ansiedler, oder deren Schriftwechsel mit der alten
Heimat, ziehen weitere Einwanderergruppen in diese Gegend an.
Hinzu kommen die hohe, ungesteuerte Wachstumsrate und die
Vielseitigkeit der Betätigungsmöglichkeiten, die sich aus dem
regional beobachteten wirtschaftlichen Wachstum ergaben. Zu
derselben Zeit kamen nach Curitiba
und in seine angrenzenden
Gemeinden eine Vielzahl von Rückwanderern, die sich diesen
Pionieren zugestellten.
Die Landkarte Nr. 1 und das Schaubild
Nr. 1 veranschaulichen uns das Anwachsen der Siedlungsgebiete
besser.
Landkarte 1 - Die Haupt-Siedlungszentren
Deutschsprachiger im 19. Jahrhundert in Brasilien
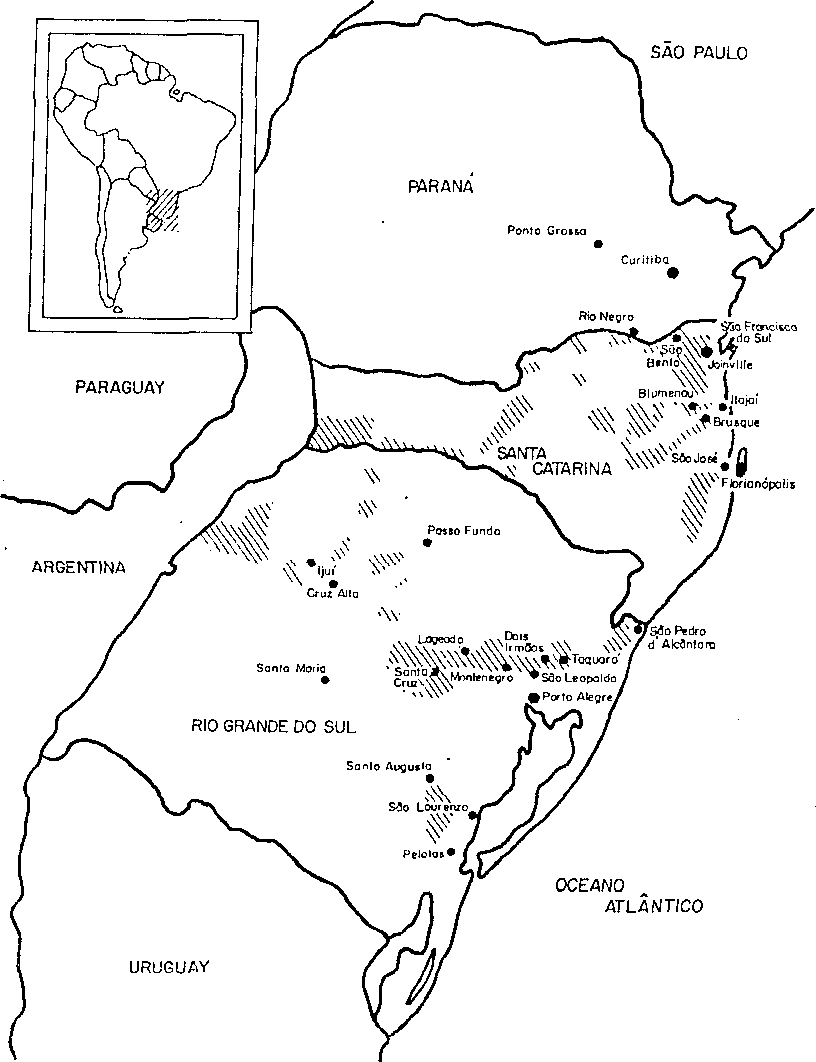 |
Schaubild 1- Die
Haupt-Siedlungszentren Deutschsprachiger im
19. Jahrhundert in Südbrasilien[11]
|
|
Kaiserliche und
|
|
|
|
Estrela (RS) |
1872 |
Wieder einwanderung |
Teutonia usw. |
|
Po$o das Antas
(RS) |
1875 |
Wieder einwanderung |
Teutonia usw. |
|
Sena Branca (RS) |
1875 |
Wieder einwanderung |
Santo Angelo und Santa Cruz |
|
Nova Patria (PR) * [12] |
1877 |
Privat |
Wolga (Russland) |
|
Campestre (RS) |
1885 |
Wieder einwanderung |
Teutonia u. a. |
|
Botucarai (RS) |
1890 |
Bundes-Regierung |
Santo Angelo und Santa Cruz |
|
Serra Ijui
(RS) |
1890 |
Staats-Regierung |
Santo Angelo, Santa Cruz u.a. |
|
Canoas (SC) |
1890 |
Wieder einwanderung |
São Leopoldo und Teutonia |
|
Barra do Colorado (RS) |
1897 |
Staats-Regierung |
Verschiedene Gebiete |
|
Boi Preto
(RS) |
1897 |
Staats-Regierung |
Verschiedene Gebiete |
|
Hansa-Humboldt (SC) |
1899 |
Staats-Regierung |
Verschiedene Gebiete |
|
Hansa (SC) |
1899 |
Wieder einwanderung |
Blumenau |
|
|
Quelle: DREHER. 1984.
WILLEMS, 1980. FUGMANN. 1929. GERTZ. 1987. FOUQUET.
1974. SEYFFERTH, 1988
Mit diesen neuen Zuwanderern kamen auch
Anhänger der verschiedenen protestantischen
Glaubensbekenntnisse, die zu der Zeit Sorgen um ihre Gläubigen
in der Diaspora hatten. Wenn bis dahin die protestantischen
Missionen sich besonders ihrem ausgewanderten Deutschen
innerhalb des Kontinents und in Nordamerika zugewendet hatten,
so wurde um 1870 auch Brasilien ihrer Aufmerksamkeit,
motiviert zum grössten Teil durch den Pietismus-Lehre ihre
Ernsthaftigkeit in der Evangelisationsaufgabe. Ihrer Ansicht
nach waren die Deutsch-Amerikaner schon in die Gesellschaft
der neuen Aufnahmegebiete integriert, und entsprechend der
Industrialisierung dieses Landes wurde ihre traditionelle
religiöse Ausübung schon schwächer. Die religiösen Absichten
waren übereinstimmend mit denen der protestantischen
Nationalisten - oder nationalistischen Protestanten - wie, zum
Beispiel, Carl Fabri, nach dessen Ansicht die germanischen
Einwanderer in Latein-Amerika als "Kulturdünger" anzusehen
waren, oder aber als potentielle Vermittler eines
Imperialismus, der die Eroberung von Gebieten erübrigte, wenn
er statt dessen treue Anhänger und Untertanen seiner
Interessen fand (PRIEN, 1989).
Die Ersteinwanderer und die ’’Brummer",
die diese Neuzuwanderer empfingen, harmonisierten anfangs
nicht miteinander, die sich selbst als "Reichsdeutsche"
bezeichneten. Sie hielten sie für zu gebildet, übertrieben an
ihrer heimatlichen Gegend hängend und als Verteidiger eines
Landes, dessen Geschichte sie direkt nichts mehr anging.
Ausserdem sprachen sie hochdeutsch, was ihren Landsleuten
hierzulande nur schwer verständlich war, denn bis 1870
sprachen die Bewohner der diversen kleinen Länder, die
zusammen Deutschland bildeten, nur ihre regionalen Dialekte.
Für diese Reichsdeutschen waren die
Deutschbrasilianer Ignoranten, Trinker, total assimiliert und
- nach Aussagen der Pastoren mit akademischer Ausbildung, die
in Brasilien ihr Amt ausübten - sich sehr wenig um ihre
religiösen Pflichten kümmernd. Im Gegensatz zu den ersten
Pastoren, die direkt in ihren Gemeinden gewählt worden waren,
sahen ihre Nachfolger sich als Autoritäten an, die nur der
deutschen Kirche gegenüber verpflichtet waren, was zahlreiche
Ablehnungen der Siedler zur Folge hatte. Die Pastoren
andererseits sahen die Siedler als undiszipliniert an, wenig
fromm und lediglich die religiösen Formalitäten erfüllend. Die
Siedler aber verstanden die Pastoren als Tadler ihrer
Festlichkeiten und sogar ihrer täglichen Gewohnheiten.
Ausser diesem Widerstand der
Volksschicht bekamen die neuen Pastoren die Opposition der
Atheisten und Liberalen zu spüren, die im Dasein der Pastoren
einen deutsch-imperialistischen Einfluss sahen und die
Bestärkung in einer Religiosität, die sie in Abrede stellten.
(SEYFERTH, 1981, S. 51).
Aber die Nachricht über ein vereintes
Deutschland hat doch viele Begeisterte zur Folge, besonders
bei den Liberalen, die 1848 wegen des zerstückelten
Vaterlandes weggingen (KUDER, 1937). Diese versöhnen sich nun
sentimental mit ihrem Vaterland, oder lassen sich, zum Teil,
davon überzeugen, dass man möglicherweise politische oder
ökonomische Vorteile von dort erwarten könne. Und in der Tat
hatte das seine Berechtigung, denn zur Jahrhundertwende wurden
bereits 45% Waren von Deutschland nach Rio Grande do Sul ausgeführt, während an 2. Stelle England mit nur
17% stand. Rio Grande do
Sul hingegen exportierte
19% seiner Produkte nach Deutschland, während der interne
Markt noch der grössere Abnehmer war (BRUNN. 1971, S. 151).
Wir können diese Tendenz nicht als
unumschränkt verallgemeinern, so wie wir nicht alle
Reichsdeutschen als leidenschaftliche Nationalisten bezeichnen
können. Man muss hervorheben, dass der preussische Staat
Bismarcks das Ergebnis einer Revolution "von oben" war, was
einen Abbruch der Beziehung zu' dieser Gesellschaft hervorrief
und sie * in ihrem Militärbereich - in zwei deutlich getrennte
Gruppen teilte: Reichsfeinde und Reichsfreunde (WEHLER, 1970,
S. 122). Von diesen ist natürlich die erste Gruppe am
Auswandern interessiert und im Gegenteil nicht daran, die
gleichen Gefühle wie die zweite Gruppe zu bewahren.
Die Dokumentation, in der die Existenz
der sozialdemokratischen Bewegung und anderer
linksgerichteter Tendenzen erwähnt wird, war in den Archiven
Brasiliens sehr gering und wurde nicht erhalten, weil
möglicherweise die ersten Gelehrten, die sich mit der
Einwanderung befasst haben, in ihrer Mehrheit schon festgelegt
waren auf eine feierliche und stolze Geschichte jener
Kontingente. Rene Gertz, (1985, S. 75-84), identifiziert
indessen eine der ersten Organisationen mit diesen Tendenzen
des Jahres 1892, die sich aus Arbeitern deutscher Abstammung
in Porto Alegre bildeten: aber man muss in Erwägung
ziehen, dass das Fehlen politischer Bewegungen dieser Art
damit Zusammenhängen kann, dass diese sich aus ethnischen und
sprachlichen Prinzipien heraus eben nicht bildeten. Wenn diese
Bewegungen sich in grössere Zentren verlegen und sich typisch
städtischen Aktivitäten zuwenden, verbinden sie sich eher
über-ethnischen Gruppen, denn sie müssen sich den gegebenen
Bedingungen anpassen zugunsten ihrer wirtschaftlichen oder
politischen Interessen, oder eben denen ihrer Klasse (HOERDER,
1988). Aber in kleinen oder mittleren Städten, in denen die
deutschstämmigen Gruppen den weitaus grösseren Teil der
Bevölkerung ausmachten, erhielt sich die
ethnische und kulturelle Identität, grösstenteils begünstigt
durch das Bestehen ihres Vereinswesens, durch die Bedingungen
ihrer religiösen Minderheit und durch die Schwierigkeit, die
Landessprache zu beherrschen.
Die Ausübung der Vereine bekommt in den
80er/90er Jahren ' einen beachtenswerten Impuls und sie
breiten sich in den folgenden Jahren immer weiter aus. Als
Mikronationen empfinden sie die Gleiche Notwendigkeit der
Bestätigung des Zugehörigkeitsgefühls und der zahlreichen
Formen der Solidarität - Charakteristiken, die zum Teil den
wirtschaftlichen Aufstieg vieler Immigranten erklären.
In Curitiba,
zum Beispiel, werden zwischen
1856 und 1926 ungefähr 50 Vereine gegründet, einige sind nur
von kurzer, andere von langer Dauer. Man schliesst sich
zusammen, um zum Beispiel eine Gruppe zu bilden, die die
Funktion der freiwilligen Feuerwehr ausübt, oder um
Institutionen zu bilden, die mit dem Gesundheitswesen zu tun
haben, wie unter anderen, die Gründung des "Deutschen
Krankenhauses"; um Interessenten an Garten- oder
Parkgestaltungen zusammenzuführen; zur Anlage und Pflege des
deutschen Friedhofs; ausserdem leistet man zahlreiche
Zuschüsse in Schulen und Kirchen, was einen intensiven
sozialen Austausch bedeutet. Musikanhänger schliessen sich
zusammen, Sport* oder Theater-Interessenten, oder man findet
sich einfach zur gemeinsamen Freizeitgestaltung.
Das am meisten hervorzuhebende Beispiel
dieser Vereine in Curitiba
ist der
"Handwerker-Unterstützungsverein", 1884 gegründet, der 1934
schon 3.000 Mitglieder zählte und zu dieser Zeit schon einer
der grössten dieser Art im Lande war. Inspiriert durch die
Thesen der Sozialdemokratie, richtete er seine Aufgaben
zugunsten des Gemeinwesens aus, das sich mit dem
Gesundheitswesen, der Erziehung und Freizeitgestaltung
befasste, auf der Suche danach, auf eine bestimmte Art die
diesbezüglichen Richtlinien des brasilianischen Staates zu
ergänzen mit denen, die sich im Herkunftsland entwickelten.
Wären diese erst einmal festgelegt, würde sich das Ansehen
seiner Existenz nicht nur durch seine Arbeiter und Handwerker
erhöhen, sondern auch auf anderen Gebieten, soweit sie die
Weltanschauung derer integrieren würden, die "am Beherrschen
der deutschen Sprache festhielten". Diese und andere
Institutionen verstanden sich also als affektive Vertretungen
eines intervenierenden Staates und taten alles für ihre
"Untergebenen", kümmert sich unter anderen um ihre Sicherheit,
ihre Erziehung und Ausbildung, ihre Gesundheit und
Arbeitsplätze. So verhält sich auch der "Deutsche Klub" in Curitiba, 1869 gegründet, nicht nur zum Zweck der
erholsamen Freizeitgestaltung, sondern übernimmt ab 1880 auch
Wohltätigkeitsaufgaben. In seinen Statuten ist eine
Finanzhilfe bis zu 12 Monaten vorgesehen für diejenigen
Mitglieder, die krank oder arbeitslos würden. Diese
Unterstützungen waren jedoch vom disziplinierten Benehmen der
Bedürftigen abhängig, was folgendermassen in den Satzungen
festgelegt war:
(...) diese Unterstützung wird nicht an
Mitglieder ausgezahlt, die ihre Beiträge seit 4 oder mehr
Monaten nicht entrichtet haben, oder an Kranke, deren Zustand
durch Streitigkeiten oder Trunksucht entstanden ist (...) (apud NADALIN, 1972, s. 9).
Aber auch wenn es nur die
Freizeitgestaltung betrifft, sind die Voraussetzungen in
diesen Vereinen dieselben wie oben erwähnt. So heisst es zum
Beispiel in den Statuten desselben Klubs weiter:
(...) Der Klub "Germania" erfüllt den
Zweck, seinen Mitgliedern erholsame Freizeltstunden in
erfreulicher und sittlicher Gesellschaft zu bieten, wie zum
Beispiel durch gemeinsamen Gesang, durch Lesestunden u.a.
Vergnügungen, die diejenigen bereichern, die wahrhaft danach
suchen (idem, 1972, s.9)
Der Germania-Verein, wie auch andere
Gesangs-, Theater- oder Sportvereine in Curitiba und
auch in anderen Städten, setzten also ''Moral" voraus,
angeregt durch das in den Vereinen sich entwickelte Gefühl der
harmonischen Einigkeit zwischen seinen Mitgliedern, die sich
als ein Teil desselben Organismus empfanden:
Man singt und macht überall Musik. In
den Kirchen singen die Gläubigen, in Ihren Körperschaften die
Studenten, beim Marschieren die Soldaten, auf ihren Wanderschaften die Handwerker. 10
Ausser dieser Art Vereinen gab es aber
auch korporative, die - wie die deutschen Zünfte - die
verschiedenen Berufssparten zusammenfassten, um deren
Interessen vor der Gesellschaft zu vertreten, während sie
gleichzeitig die Legalität des allgemeinen Verbrauchers eben
dieser Sparte in der Öffentlichkeit garantierten.
Kleine Zirkel, Körperschaften,
Freizeitzentren, in denen die Teilnehmer sich treffen und
gesehen werden wollen, Erhaltung der Sprache und Tradition der
Vorfahren - das alles entsteht in dieser Zeit, charakterisiert
durch die aus der Heimat mitgebrachten Erfahrungen, die - auf
örtlicher Ebene - ganz einfach übersetzt und neu herausgegeben
werden können, ungefähr im Sinne von "Einigkeit macht stark".11
Trotz der Einmischung der Pastoren der deutschlutherischen
Kirche sind doch in dieser Zeit alle Initiativen auf die
Urheberschaft der eigenen Einwanderer-Gemeinden
zurückzuführen. Erst etwas später werden sie von ausländischen
Institutionen unterstützt, deren Ausübungen nach dem Ausruf
der Republik grössere Relevanz erhalten. Und zusammen mit
ihnen entdecken und erkämpfen die brasilianische Regierung,
wie auch Deutschland, den [13]
[14]
Süden Brasiliens - und zwar beide unter derselben
sozial-politischen Vorstellung des Nationalismus.
Die
Einwanderung zur Zeit der Republik
Mit dem Ausrufen der Republik und dem
Ende der Sklaverei stellt die Emigration aus Europa eins der
Hauptthemen der Debatten um die Arbeitskraft-Nachfrage in der
Landwirtschaft dar, die erst die Voraussetzung der Ausfuhr
landwirtschaftlicher Erzeugnisse Brasiliens garantiert. Daraus
entstehen eine Menge Initiativen, alle mit dem Versuch,
Immigranten verschiedenster Herkunft in die wichtigsten
Wirtschaftszentren des Landes anzulocken. Auf Grund der daraus
entstehenden Bevölkerungsdichte, im Zusammenhang mit der schon
beginnenden städtebaulichen Gestaltung, ergeben sich Probleme
der Versorgung - eine neue politische Aufgabe, die durch die
Immigration überwunden werden muss. Zur Arbeit in der
Landwirtschaft kommt die Verteilung von Länderleien
landwirtschaftliche Produktion von Nahrungsmitteln im Innern
des Landes, oder besonders auch in der Nähe grosser Farmen,
die sich auf Monokulturen spezialisiert haben. Damit konnte
man die Kosten der Reproduktion verringern, andererseits -
falls nötig - das Kontingent der Arbeitskraft jener
produktiven Zentren erhöhen (STOLCKE & HALL, 1983. S.
80-120).
Es ergibt sich aus diesem Kontext, dass
das Kolonisations- System in den Südstaaten Brasiliens von den
Intellektuellen und Politikern der jungen Republik neu
bewertet wird; obwohl es sich weiterhin am vorhergegangenen
System ausrichtet in Bezug auf die Gründung von Siedlungen mit
kleinem Landbesitz, der sich - sozusagen als Zusatz - in die
Nationalökonomie integrieren muss, sei
es zur Zusatzversorgung von Verbrauchsgütern in
dynamischen Zentren, oder sei es als potentieller Lieferant
von Arbeitskräften durch interregionale Zuwanderung.
Es fiel, wie im Kaiserreich, den
Gouverneuren die Aufgabe zu, diese Siedlungszentren in ihren
Territorien zu gründen, wobei diese eine einzige
einschneidende staatliche Einmischung erdulden mussten, darin,
dass ein rigoroses Verbot bestand, das die Zusammenballung
ethnischer Gruppen in derselben Gegend untersagte, hingegen
gemischte Siedlungen vorschlug, vorzugsweise aus Ausländern
und Einheimischen bestehend. Diese Massnahme erklärt sich
unter anderen durch die Vorstellung der Ausbreitung der
"deutschen Gefahr", deren Anhänger in der ethnischen
Konzentration ein Risiko sehen wollten durch die Einmischung
in kulturelle, politische und territoriale Aspekte.
Die warnenden Hinweise auf dieses Risiko
hatten jedoch keinen Rückfluss der Einwanderung aus
Deutschland zur Folge. Wenn der Immigrationsrhythmus sich
verlangsamte, so kam das eher durch ökonomischen Zufall, von
denen die jeweiligen Regierungen abhängig waren, als vielmehr
durch die Wirksamkeit anti-germanistischer Reden; in Rio
Grande do Sul sind zu der Zeit die Abholzungen der
Waldgebiete der Hauptgrund der finanziellen Reduzierung des
Staatshaushalts für die Einfuhr von Arbeitskräften. In Santa Catarina werden zwar einige neue Siedlungen gegründet,
aber - aus ähnlichen Gründen wie den oben erwähnten - vergeben
die offiziellen Stellen Klein-Landbesitz lieber an Nachkommen
der Ersteinwanderer, infolge ihres beträchtlichen Wachstums.
Im Gegensatz dazu macht Paraná grosse Anstrengungen zur
Besiedlung seines Gebietes, anfangs die transkontinentale
Immigrationspolitik anwendend.
Im 20. Jahrhundert lassen sich in diesem
Staat die meisten europäischen und asiatischen Einwanderer
nieder, mit Ausnahme von Italienern, Spaniern und Portugiesen.
Es kommen ukrainische, russische, japanische, polnische und
deutsche Arbeiter, besonders eben Osteuropäer, die aus
wirtschaftlichen, politischen oder religiösen' Gründen aus
ihren Ländern auswandern. Zu ihnen gesellen sich diejenigen
anderer älterer Siedlungsgebiete, die wegen der Landaufteilung
aus Erbschaftsgründen ihre Gebiete verlassen und sich im
Norden der Südstaaten neu ansiedeln wollen.
Die Einwanderer aus Deutschland haben
allein in Paraná von der Jahrhundertwende bis zum Jahr 1953
dreizehn Landwirtschaftssiedlungen in verschiedenen Gegenden
dieses Staates geschaffen, wie aus der Landkarte 2 ersichtlich
wird.
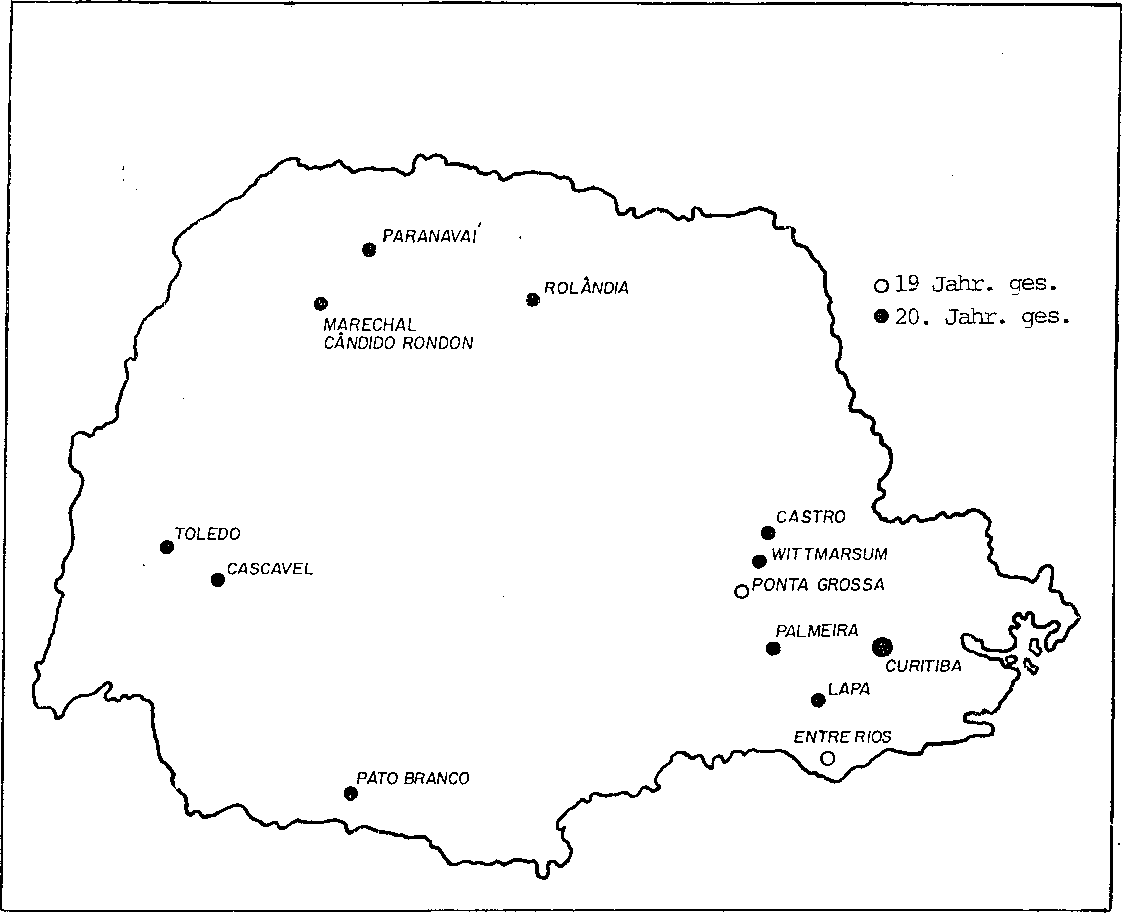
|
Landkarte 2 - Die Haupt-Siedlungszentren Deutschsprachiger im Paraná |
Wenn man diese Entwicklung von
Siedlungszentren genau betrachtet, kann man feststellen, dass
diese Land-Besetzung fast eine Herausforderung für die
jeweilige Landesregierung darstellt, die sich nur in eine
weitere Wirtschaftsplanung abändert, wenn der
Verwaltungsapparat andere Verpflichtungen eingehen muss, die
in seinen Kostenanschlägen aber mit der demographischen
Besiedlungen einhergehen; sobald der Eintritt, versucht man,
durch eine Reihe von Reden sein Verhalten zu rechtfertigen,
unter anderen, das der Bevorzugung nationaler Arbeitskräfte.
Auf Grund dieser Feststellung beurteilen wir die
Interpretation von Wilson Martins als unkorrekt, dessen Worten
nach dieser Neuorientierung sich auf patriotische Absichten
der Gouverneure zugunsten ihrer Landsleute bezog. Wir zitieren
hier das gleiche Beispiel von Martins, das nach den Worten von
Caetano Munhoz da Rocha, aus Paraná, in seiner Rede aus dem Jahr 1922 eine
nationalistische und fremdenfeindliche Haltung erkennen lässt.
Der Staatspräsident erklärt sich gegen die Einwanderung, wenn
sie aus öffentlichen Kassen bestritten worden muss.
(...) da es ihm weder gerecht noch
vertretbar erscheine, dafür Geldmittel zur Verfügung zu
stellen, die in den Schul- und Strassenbau gesteckt werden
könnten, zum Wohl der Nation und der wahren Bevölkerung dieses
Landes, nämlich den Wegbereitern des Landesinnern (apud MARTINS, 1989, S. 91).
Bald jedoch werden - zur Zeit derselben
Konjunktur und der ihr folgenden - andere Politiker und
Intellektuelle aus Paraná eine enorme Propaganda starten, um
europäische Immigranten anzuwerben, die entweder direkt aus
dem Ausland kommen, oder aus anderen brasilianischen Gebieten,
wie Söhne von Ausländern, die nur wenig der nationalistischen
Gesinnung unterliegen. Dieser zweite Gedankengang lässt sich
damit begründen, dass dies weniger kostspielig ist als die
Ansiedlung direkt aus Europa kommender Arbeitskräfte. So
besorgt - durch eine patriotische, in dem Augenblick günstige
Rhetorik - die jeweilige Landesregierung ihre notwendige
Arbeitskraft, ohne die gleiche Menge an Geldmitteln einsetzen
zu müssen wie die
Nachbarstaaten, was zur Erhöhung seiner Einnahmen beiträgt,
die sich aus der neuen wirtschaftlichen Entwicklung ergeben.
Nicht einmal der erste Weltkrieg konnte
die Politiker der Südstaaten beeinflussen, die für die
europäische, und ganz spezifisch für die deutsche Einwanderung
waren. Anhand der Tabelle Nr. 2 lässt sich ein starkes
Anwachsen der Immigration aus diesem Herkunftsland - im
Vergleich zu vorhergegangenen Jahren – feststellen.
Tabelle Nr. 2
-Einwanderer deutscher Herkunft in Brasilien -
|
Einwanderungsjahr |
|
1900-09 1910-19 1920-29 1930-39 TOTAL |
|
Zahl der Immigranten |
|
13.848 25.902 75.839 27.629 143.218 |
Quelle: GERTZ, 1987, a 15
Diese Angaben zeigen, dass auch im 20.
Jahrhundert die Gruppe von Immigranten deutscher Herkunft den
4. Platz belegt, nach den Italienern, Portugiesen und
Spaniern.
In der Zeit vor dem ersten Weltkrieg,
als der Mythos von der deutschen Gefahr mit grosser Intensität
durch die Presse, die Intellektuellen und den Nationalismus
der Politiker geschürt wird, begnügen sich die drei südlichen
Landesregierungen damit, Kampagnen zu starten, um für die
portugiesische Sprache zu plädieren und die Einschränkung
bekanntzugeben, dass Einwanderer nicht in öffentliche Dienste
treten dürfen; Massnahmen, die sich nach Kriegsende wieder
lockern. Die grösste Diskriminierung bis 1930 kommt von der
bürgerlichen Gesellschaft, die in den Immigranten nur den
Ausländer sieht. Diese Einstellung würde zu einem Klima der
Ablehnung dieser Schicht gegenüber beitragen, was zu
drastischeren Massnahmen seitens der offiziellen Stellen erst
während der neuen Staatsform führen würde. Aber bis dahin
nimmt die Zahl der Deutschstämmigen und Neueinwanderer noch
zu, und diese gemessen eine relative Autonomie in ihren
politischen Ausübungen. Ihre Zuwachsrate schwankt, wie die der
anderen Länder auch, was jedoch auf die wechselhafte
Regionalökonomie zurückzuführen ist.
Eine präzise Zahlenangabe der deutschen
in Südbrasilien und den anderen Staaten zu nennen, ist eine
sehr schwierige Aufgabe, denn die zur Verfügung stehenden
Angaben wurden meist von intellektuellen gemacht, die von dem
romantischen Begriff des Nationalismus und von der Idee
"Grossdeutschland’' eingenommen waren, was sie dazu führte,
nicht zu unterscheiden zwischen denjenigen, die schon Enkel
und Urenkel deutscher Einwanderer waren und völlig
assimiliert, und denen, die sich selbst hierzulande als
"Deutsche" ansahen, oder, die effektiv noch aus Deutschland
stammten.
Als eine Veranschaulichung erwähnen wir
die Forschungsergebnisse des Geographen Reinhard Maak, der
sich sehr eingehend mit der deutsch-stämmigen Bevölkerung in
Paraná, dem jüngsten Kolonisationsstaat, beschäftigt hat; er
stellte unter anderen fest, dass von den 126.000 deutscher
Abstammung allein 40.000 ihre Muttersprache schon nicht mehr
beherrschten (MAACK, 1939, S. 8 -28). Im Gegensatz dazu
erwähnt der Pangermanist Ghese
(1931), dass sich in demselben Gebiet zu der Zeit allein im
Süden 1.200.000 Deutsche befunden hätten, die alle in den
Interessen und Weltanschauung ihres Herkunftslandes
übereinstimmten.
Trotz dieser Ungenauigkeiten können wir
in Übereinstimmung der Nachweisquellen die von Gertz
angegebenen Zahlen akzeptieren, deren Berechnung für das Jahr
1935 aus der Tabelle Nr. 2 hervorgehen.
|
Staat |
Zahl der
Immigranten und Nachkommen |
|
Rio Grande do Sul |
600.000 |
|
Santa Catarina |
220.000 |
|
São Paulo |
90.000 |
|
Paraná |
70.000 |
|
Rio de
Janeiro |
25.000 |
|
Espírito
Santo |
15.000 |
|
TOTAL |
1.020.000 |
|
Quelle: GERTZ. 1987. S. 14 |
Bezüglich der Südstaaten stellen diese
Zahlen 19,62% der gesamten Bevölkerung von Rio Grande do Sul dar, 22% von Santa Catarina und
6,9% von Paraná.
Die Ursprungsgebiete der Immigranten des
20. Jahrhunderts sind ebenfalls schwer feststellbar, denn sie
kamen aus sehr viel verschiedenen Gebieten als ihre Vorgänger,
so wie auch die Gründe der Auswanderung andere waren, was erst
nach genaueren monografischen Studien kommentiert werden kann.
Es waren jedenfalls nicht wenige Deutsche, die aus den
ehemaligen afrikanischen Kolonien kamen, weil sie durch die
Vorherrschaft der Alliierten nach dem ersten Weltkrieg
vertrieben wurden (WILLEMS, S. 65). Wieder andere kamen aus
Russland, aus dem Wolgagebiet, verbannt oder vor der
Revolution geflüchtet, ein ähnlicher Prozess wie für
diejenigen, die wegen religiöser Verfolgung diese Länder
infolge des Pan-Slawismus des 19. Jahrhunderts verlassen
mussten (FUGAMNN & BREPOHL, 1927 und BREPOHL, 1929). Die
"Hanseatische Kolonisationsgesellschaft", früher
"Kolonisationsgesellschaft von Hamburg", setzt ihre
Aktivitäten im ersten Drittel dieses Jahrhunderts fort und
erreicht im Jahr 1924 eine Zusage durch die brasilianische
Regierung, 600.000 Hektar Land des Staates Santa Catarina zur Kolonisierung zu bekommen, woraus die Kolonie
"Ibirama" entstand (RICHTER,
1986). Jedoch, und unabhängig von den staatlichen
Interventionen, waren die beiden Weltkriege' ausschlaggebend
für viele Ausweisungen dieser Deutschstämmigen aus allen
Teilen Deutschlands.
Die Neu-Einwanderer, von den schon lange
hier lebenden "Neudeutsche" oder "Deutschländer" genannt, und
eben die Nachkommen deutscher Einwanderer, der Pioniere,
welche sich als "Reichsdeutsche" oder "Brummer" bezeichnen,
befinden sich in einer grossen Umbruchperiode, die sich durch
die schnelle sozio- ökonomische Struktur der Südstaaten
erklären lässt; wegen der Landzerstückelung und weiterer
Abwanderungen in die Städte, oder andererseits dem sozialen
Aufstieg einiger Deutscher entstehen eine Reihe von
Stadtzentren kleinerer oder mittlerer Bedeutung. Ausser Curitiba und Porto Alegre
entwickeln sich Blumenau,
Joinville, Ponta Grossa, São Leopoldo und Novo Hamburgo zu Produktionsstätten von
Manufakturen; sie bleiben also nicht nur Zwischenhändler
landwirtschaftlicher Erzeugnisse.[15]
In dieser Zeit gewinnen auch die
Vereins-Ausübung und die Erweiterung der deutschen Presse im
Lande an Bedeutung. Gesangs-,
Sport- und Freizeitvereine, Religionszentren und
Unterstützungs- Vereine, auch technische Beratungsstellen
organisieren sich sehr systematischen in fast allen Gemeinden
der Südstaaten, wo sich Einwanderer und Menschen deutscher
Abstammung befinden. Schulen und Kirchen werden gegründet um
die religiöse Identität und die Muttersprache, wie alles
Germanische überhaupt, zu erhalten. Die Tages- oder
Wochenzeitungen breiten sich zahlenmässig aus und ihr Inhalt
wird abwechslungsreicher. Nachrichten im Zusammenhang über
Ereignisse in Brasilien und Deutschland, religiöse
Orientierung oder solche für das Leben in der Familie,
Richtlinien für Jugendliche oder Anregungen für die Freizeit,
technische Hinweise, sowie Titel oder Besprechungen
didaktischer Bücher ziehen immer mehr interessierte Leser an.
Ausser diesen Zeitungen und didaktischen Werken, die die
Privatschulen in ihren Grundstufenprogrammen orientieren
sollen, sind informative Mitteilungen der Vereine und deren
Hinweise auf diverse festliche Gedenkakte zu erwähnen, wie
auch Geschichtsbücher und Literatur, die sich durch das Leben
der Immigranten inspirierte; dies alles brachten die
Druckereien in Umlauf (BREPOHL DE MAGALHÃES, 1989, s.77-112).
Man kann einen neuen Charakter in fast
allen Gesellschaftsformen und im öffentlichen Auftreten
feststellen; anders als zur vorangegangenen republikanischen
Epoche verfügt man über einen anderen allgemeinen Nenner,
ausser dem Gebrauch der deutschen Sprache: es handelt sich um
die Verteidigung und Verständlichmachung
der notwendigen Erhaltung der ethnischen Identität. Gleich ob
religiöse oder säkulare Schriften, alle waren sich darin
einig- ihre verschiedenen Proportionen und Objektive
vorbehaltend-, dass der Zusammenhalt dieser Gruppen als
ethnisches Prinzip nicht nur als kultureller, sondern auch als
politischer Faktor anzusehen sei.[16]
Diese Durchführungen dürften sich- als
eine Art Verteidigungsstrategie jener Schichten- durch die
Erfahrung mit dem ersten Weltkrieg verstärkt haben, nämlich
aufgrund der Repressalien ' durch die Tatsachen, dass ihr
Herkunftsland sich im Krieg mit Brasilien befanden. Es spielt
auch eine wichtige Rolle in der Verstärkung ihrer Kontakte zur
Gesellschaft des Einwanderungslandes -
Resultate des aufblühenden Städtebaus, was sogar latente
Differenzen zwischen den Immigranten und den Brasilianern
hervorrief. Aber grundlegend ist in dieser Analyse das
Verständnis für den grossen Einfluss der Mitglieder der
verschiedenen deutschen Vereine hierzulande, die an der
Auswanderung und den im Ausland lebenden Deutschen
interessiert waren, wie zum Beispiel dem "Alldeutscher
Verband", dem wichtigsten der Vereine, der "Deutschen
Kolonialgesellschaft", dem "Evangelischen Hauptverein für
Ansiedler und Auswanderer" und der "Hanseatischen Kolonisationsgesellschaft".
Diese sind die Hauptantriebskräfte der deutschen
Kolonisierungsbewegung, Ergebnis der Entwicklung eines
Spät-Imperialismus, dessen Anschauung über das Erhalten der
Identität als eine wichtige Strategie der Expansion seiner
wirtschaftlichen Vorherrschaft betrachtet wurde.
Laut Mercedes Kothe,
interessierten sich jene Organisationen dafür,
(...) den Einwandererstrom in die
Südstaaten zu lenken, in ein Gebiet, in dem der Immigrant auch
Konsument deutscher Erzeugnisse würde, und nicht ein
Konkurrent - wie es bei den Einwanderern in die USA der Fall
war (...) die Einwanderer in Gebieten anzusiedeln, wo sie
Gebräuche und Gewohnheiten erhalten und auch noch deutsche
Produkte verbrauchen würden: das wird die Regierungsaufgabe
sein im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts: oder in der
sogenannten Caprivi-Ära, eine Periode, in der Deutschland sich
den Absatzmarkt seiner Produkte sichern musste. (1990. S. 7)
Angeregt durch diese Ideologie üben
diese Gesellschaften starken Einfluss auf andere aus, sei es
in Form von Unterrichtsstätten, oder durch die Kirche, durch
Sport- und Erholungszentren, in Deutschland wie auch in
Brasilien. Um eine Idee der Bedeutung derselben zu bekommen,
erwähnen wir folgendes: 1910 sind auf einem Kongress über
Kolonialpolitik allein 106 deutsche Vereine vertreten,
gefördert durch den "Verein für das Deutschtum im Ausland -
VDA".
Der Alldeutsche Verband und der
Schulverein finanzieren den Bau von Schulen und Kirchen, sowie
den Druck von Zeitungen, in denen sie ihre Theorien von
"Grossdeutschland” weitergeben können, wobei die Hauptthemen
Endogamie, Rassen-Vorrang und die wirtschaftliche Entwicklung
ihres Landes sind. Einige dieser Idealisten des deutschen
Nationalismus, die meist aus der Mittelschicht stammen,
übersiedeln nach Brasilien, um dort neue Betriebe aufzuziehen,
denn sie rechneten - ihrer Interpretation nach - mit der Treue
ihrer Landsleute im Ausland. Oft verbündeten sie sich mit wohlhabenderen Schichten der
Deutschbrasilianer und schlossen mit ihnen Handelsverträge ab,
die unter anderen die Mithilfe zu Veröffentlichungen in
deutscher Sprache und die Zusammenarbeit mit [17]
den deutschen Vereinen, die schon seit dem 19. Jahrhundert
bestanden, vorsahen.
Diese ganzen Tätigkeiten erweckten die
Aufmerksamkeit der brasilianischen Intellektuellen, die darin
die Bestätigung ihres Verdachts der deutschen Gefahr sahen und
deren Strategie zu erkennen glaubten, sich in absehbarer Zeit
in Südbrasilien Land anzueignen. Als das nationalistische
Gefühl in Brasilien eins der wichtigsten Leitmotive der Elite
wird - besonders vor dem Ausbruch des zweiten Weltkrieges -
ergreift diese Kampagne der Nationalisierung diese oben
erwähnten Schichten ganz stark in Bezug auf ihre kulturellen und politischen
Tätigkeiten.
Aber, wie wir schon bestätigten, wird
der Zuwandererstrom der deutschen Immigranten auch durch diese
Landeskonjunktur nicht unterbrochen, 1930 wird das Einwanderungs-Verbot
infolge der
allgemeinen Wirtschaftskrise erlassen, und nicht aus
irgendeinem politischen Grund; als 1934 das Quotensystem
eingeführt wird, erlaubt die legale Massnahme die Aufnahme von
nur 2% jeder ethnischen Gruppe, die in den
letzten 50 Jahren einwanderte; das benachteiligte jedoch nur
asiatische und afrikanische Immigranten - was gar kein
unerwünschtes Resultat war -, denn die jährlich aus Europa
kommenden Immigranten überschritten nur sehr
selten diesen vorgeschriebenen Prozentsatz.
Nicht einmal die Vorschriften der
Tätigkeiten für Ausländer, die ihnen 1937 zum Beispiel Stellen in öffentlichen Dienstleistungsbetrieben
untersagten,
und die den Arbeitern des landwirtschaftlichen Sektors Vorrang
gaben (80% jeder Gruppe), beeinflusste den Eintritt dieser
Menschen ins Land negativ. Man nahm an, dass sich letzten
Endes Ausländer, die arm ins Land kamen, sowieso nur selten
für Dienstleistungsbetriebe interessieren würden; und die
Tatsache, dass sie sich bei der Einwanderung als Landwirte
eingetragen hatten, verbat es ihnen ja nicht, später auch
andere Aktivitäten auszuüben.
Obwohl der herrschende Nationalismus
schwerwiegend war und die anti-germanistischen Reden
akzeptiert wurden, konnte man doch nicht ableugnen, dass die
Immigranten weiss, diszipliniert und arbeitsam waren,
Charakteristiken, die absolut mit der eugenischen Politik
dieser Epoche harmonisierten (LENHARO, 1986). Der Regierung
blieb also nur übrig, die Immigranten zu "verbrasilianern",
was durch die Grundschulausbildung
geschehen würde, deren Lehrplan nicht nur den ständigen
Gebrauch der portugiesischen Sprache vorsah, sondern auch zum
Kult der staatsbürgerlichen Werte der Nation anhielt, der sie
von nun an dienen sollten.
Die bedeutsame Sympathieerklärung der
Deutsch-Brasilianer zur pan-germanistischen Kultur dieser Epoche, wie auch ihr
Enthusiasmus für den National-Sozialismus, lassen sich zum
Teil als eine Form der Resistenz gegen die Politik,
brasilianische Staatsbürger zu werden, erklären; sie lässt
sich zwar gleichschalten mit diesem historischen Moment,
erschöpft sich hier aber nicht. Es ist erforderlich, einen
diachronischen Ausschnitt zu machen, durch den verständlich
wird, wie der Mythos der irrationalen Einheit, das Bildnis des
Befreiers und das Bewusstsein der auserwählten Rasse sich zur
gleichen Zeit auch bei den Deutschbrasilianern einstellt, was
die Form der Resistenz gegen die Assimilation ans
Brasilianische noch vergrössert und - innerhalb der
Möglichkeiten - eine Art von Bürgerrecht anstrebt, das doch
sehr viel anders ist als in der Vorstellung der hiesigen
Verfechter des Estado
Novo (Neuen
Staates). Obwohl die Deutschbrasilianer radikal gegen die
anarchistischen und sozialistischen Bewegungen dieser Epoche
in Brasilien waren,
strebten sie doch - genau wie die Brasilianer -
die Teilnahme in öffentlichen Wirkungskreisen an. Sie
unterschieden sich jedoch von ihnen darin, dass sie kein
Projekt für die gesamte Nation besassen; sie sahen sich selbst
als eine Körperschaft innerhalb der anderen, welche, zwar
unterschiedlich, so doch dasselbe Recht zu existieren, zu
denken und zu handeln haben müsse, und zwar im Einklang mit
ihren herkömmlichen Werten. Sie fanden zur Zeit dieser
Forderungen den Moment passend für einen geschlossenen Einsatz
und versuchten, sich aus der politischen Isolierung zu
befreien, die für sie seit dem ersten Weltkrieg bestand. Sie
beanstandeten die Tatsache, auf politischer Ebene ignoriert
zu. werden, während sie andererseits als disziplinierte und
ordentliche Arbeiter anerkannt waren. In den Grenzen ihrer
Landesvertretungen glaubten sie an die Möglichkeit einer
Rückwanderung, oder einer Annektion
der hier von ihnen bewohnten und bearbeiteten Gebiete an
Deutschland, an eine definitive Heimkehr in ihr Vaterland.
Wegen diesem Traum entstand die Auflösung ihrer zahlreichen
Vereinstätigkeiten, sowie ihrer Kultur denn aufgrund der
durchgeführten Gegenpropaganda durch die Nationalisten
Brasiliens wurden ihre Ausübungen und Reden drastisch
unterbunden. Nach Beendigung des zweiten Weltkrieges kamen
etliche Kriegsteilnehmer und Flüchtlinge aus dem Ausland, um
sich jenen Deutschbrasilianer anzuschliessen, die sich bis zum
Ende der 50er Jahre in anderen, bis dahin unbesiedelten
Landstrichen, niederliessen und das Kontingent der
Industriearbeiter vergrössern halfen. Aber von da ab
verhielten sie sich schweigsam betreffs der Teilnahmen an
besonders wichtigen politischen Ereignissen, die die
Handlungen verschiedener Länder in der Mitte dieses
Jahrhunderts beeinflussten.
In diesem Kapitel durchstreifen wir die
Einwanderungspolitik, die als Resultat den Zustrom von
tausenden deutschsprachiger Menschen nach Brasilien zur Folge
hatte, bedingt durch die zum Teil utopische Vorstellung der
Arbeitergesellschaft, welche die Formulierung von Begriffen
wie "Neue Welt", "Landüberfluss" und "Reichtum durch Mut,
Disziplin und Unterwürfigkeit" anregte.
Wir haben gesehen, dass diese neuen
Bewohner Amerikas eben dorthin gingen mit der
Entschlossenheit, der Proletarisierung und dem Verlust ihrer
einigenden Kultur zu widerstehen; es waren grösstenteils
Bauern, Handwerker und Intellektuelle, die vor einem
ökonomisch und politisch autoritären System flüchteten, und
die in ihren Siedlungsgebieten Überlebens und kulturelle
Ausdrucks-Formen neu schufen, die in ihrem Gedächtnis fest
verankert waren, und die zu den Erfahrungen in ihrer neuen
Welt hinzukamen. Verstreut auf verschiedene Orte eines
Gebietes, das viel grösser als ihr Herkunftsland war, das aber
für die Hiesigen nur ein bedeutungsloses Grenzgebiet
darstellte, war es für die Eiwanderer doch nicht unmöglich,
dieses Landstück als das ihre zu betrachten, und es nach ihren
eigenen Wertvorstellungen, Gewohnheiten und Anforderungen des
materiellen Daseins zu strukturieren. Sie organisierten sich
politisch, soweit es zu dieser Zeit möglich war, das heisst
unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten war ja jede
Siedlergruppe - je nach ihren Erfahrungen - von der anderen
verschieden.
Diese Feststellungen brachten uns dazu,
mit einigen Autoren, die sich mit der traditionellen
akademischen Biographie befassten, nicht übereinzustimmen.
Diese Autoren sind hier durch das klassische Werk von Emilio Willems, (1980) vertreten, der bestätigte, dass
die deutschen Immigranten eine homogene Gruppe waren, die sich
von den anderen unterschied, weil sie sich von der restlichen
Gesellschaft absonderte und isoliert lebte. Aber eben diese
Isolierung, die Erhaltung ihrer Traditionen und das angebliche
Desinteresse am nationalen Leben des Einwandererlandes galten
auch für irgendwelche andere untergeordnete Schichten, wie vor
allen Dingen für die naturalisierten Ausländer, die kein
legales Recht hatten, am politischen Leben teilzunehmen. Ihre
Resistenz gegen die Assimilation ist, während dieser ganzen
Einwanderungszeit, absolut nicht total und nicht in jedem Fall
wahr; es ist wahrscheinlicher, dass sie sich vielmehr ihren
neuen Arbeitsformen anpassen mussten, die nicht immer denen ihres Herkunftslandes
ähnlich waren, die sie aber den von den Fabriken angebotenen
vorzogen. Die transkontinentale Abwanderung erlaubte ihnen die
Erhaltung einer viel weniger "ausländischen" Soziabilität, als
zum Beispiel die Migration aus einem kleinen deutschen Dorf in
Grossstädte wie Hamburg oder Berlin, wo die sozialen
Einrichtungen sie zu viel rigoroseren Änderungen in ihrem
täglichen Leben veranlassen würde.
Die Endogamie, die unter anderen von Nadalin (1977) stark hervorgehoben
wurde, war im 19. Jahrhundert nur von Bedeutung, wo in ihren
Kolonien Menschen derselben Herkunft lebten und ihr
Wirkungskreis nicht den Radius von 5-10 km überschritt, wie es ja in
der traditionellen Gesellschaft üblich war. Im 20. Jahrhundert
aber beginnt diese Isolierung sich zu lösen, unterstützt durch
erwähnenswerte Reden des Alldeutscher Verbandes, obwohl
tatsächlich weiterhin viele Siedlungen noch dieselbe Struktur
aufrecht erhalten wie in der vorgegangenen Epoche.
Wir stellen ausserdem fest, dass der
homogene Charakter, der diese Segmente prägt (ROCHE, 1969;
OBERACKER, 1968), nur akzeptierbar ist, wenn man ihn
anachronistisch betrachtet, durch die Brille des
Nationalismus, der die Jahrhundertwende und die
darauffolgenden Jahrzehnte charakterisierte, noch in der
Annahme, dass dieses Nationalgefühl alle gleichermassen und
mit derselben Absicht ansprechen würde, was eventuell zum
besseren Verständnis beiträgt, dass die Immigranten seit ehe
und je Pangermanisten waren - und blieben. Diese Auslegung
trübt das Verständnis ihrer internen Konflikte, in denen die
Äusserungen von Sozialisten, Anarchisten, Liberalen und
Nationalisten alle reduziert sind auf ein neurotisches Symptom
des Widerstands gegen die Anpassung an das Einwanderungsland.
Obwohl die Immigranten ihrer eigenen Meinung nach, unter sich
absolut verschiede waren, wurden sie von den brasilianischen
Politikern und Intellektuellen, sowie auch in einen guten Teil
der deutschen Literatur als "Gleiche" behandelt. Als diese
Literatur sich festigte, wurden sie treue Leser derselben; und
ob sie nun an deren Inhalte glaubten oder nicht, oder durch
ein Medium verführt worden waren, dass für heutige
Verhältnisse recht schwach, aber zu jener Zeit sehr wirksam
war, das können wir heute nicht mit Gewissheit sagen. Sicher
ist, dass sie viele Veröffentlichungen gelesen haben von den
wenigen Autoren, die zu der Zeit schrieben, aber doch jenes
Mal mehr schrieben. Und trotz ihres Verhältnisses und der
Anerkennung dieser nationalen Ideen verwandelten sich
dieselben in einen unbestreitbaren Beweis, dass ein
ausländischer Nationalismus, der sich in der Literatur der
Pioniere, im Deutschtum und im Nazismus herauskristallisierte,
die politische Vereinigung des
Auffanglandes bedrohte. Und gegen diesen
Nationalismus stellte sich ein anderer, der ihnen mit einem
einzigen Befehl entgegentrat: nämlich dem der Integration in
die Kultur, die Politik und die Wirtschaft Brasiliens.
II Bilder aus den Deutscheinwanderern in der
brasilianischen Literatur
Am Anfang dieses Jahrhunderts, 1902,
erscheint Graga Aranhas
berühmtester Roman, der Canaä er nennt sich, einer der ersten modernen
literarischen Werke in Brasilien.
Der Roman handelt von der Erfahrung
zweier Deutscheinwanderer, die nach Brasilien kamen, um die
"Versprochene Erde" zu finden; sie sind zu einer Kolonie in
Porto Cachoeiro in dem Staate Espirito Santo gefahren.
Das Bühnenbild der Erzählung bietet uns
eine Schätzung der brasilianischen Geschichte des 19.
Jahrhunderts an; die europäische Einwanderung, das Ende der
Sklaverei, die Konstruktion der brasilianischen Nation, die
Sorge um die wirtschaftliche Entwicklung.
Allerdings, ist Aranha nicht mit dem
Alltag der Bauern beschäftigt, weder mit ihren Kämpfen um zu
überleben oder ihre ersten Fortschritte. Es handelt sich um
einen Vorstellungsroman (romance de
ideias), mit typischen Fragestellungen für seine
Epoche; es ist der Mensch, der sehr bewusst ist ein
Individuum zu sein, der sich fragt, ob der Weg des
menschlichen Fortschrittes von der Vernunft oder von der
Leidenschaft, bei der Freiheit oder von der Unterdrückung
geführt wird. (ARANHA, S. 50-1)
Diese Überlegungen wurden von einem
Schriftsteller hervorgebracht, der, der deutschen gelehrten
Kultur zugetan war, weil er seine haupt-philosophischen
Referenzen im ihr gefunden hat, wie die Orientierung seines
Meisters Tobias Barreto, aus der "Recifense
Schule" i
Die Repräsentation der deutschen Kultur
wurde ihm nicht schwer noch wegen eines anderen Grundes: als
Richter, lebte er acht Jahre in Porto Cachoeiro,
eine kleine Stadt, wohin viele Deutscheinwanderer gekommen
sind; deswegen konnte er sich in ihren Alltagsleben, Sitten
und Volkskunde hineinfinden.
Die beiden Deutschen, die in dem Roman
die Protagonisten sind, kommen nicht aus den niedrigen
Schichten, wie die anderen Emigranten, und sie gehören auch
nicht zu ihrer Kultur. Aranha stellt sie als Intellektuelle
dar, und als Intellektuelle, halten sie die Realität fest, um
auch an ihre Vergangenheit nachzudenken.
Milkau kommt aus Heidelberg, Sohn eines
Schriftstellers und er selbst hat Literatur studiert. Idealist
und beschaulich, wanderte er aus seiner Heimat aus, weil er
sich sehr von der europäischen dekadentischen
Zivilisation enttäuscht fühlte. Er kam nach Brasilien um eine
neue Welt zu suchen, sein Canäa,
wie er es nannte. Er glaubte, dass in Brasilien, unter den
einfachen Leuten, er innerlichen Frieden und Harmonie finden
würde. Nach seiner Meinung, kann eine mestitzische
Gesellschaft viel zu der Kultur beitragen. Es ist zu bemerken,
zum Beispiel, die Rede zwischen Milkau und den luso-brasilianischem Richter Paulo Maciel, der sich sehr skeptisch über
die Zukunft Brasiliens äussert; Seines Erachtens, ist dieses
Volk unfähig eine einzige Kultur auszubauen; Es sind Erben
vieler Völker - [18]Rassen,
deswegen
haben sie keine Wir-Identität, und das soll bedeuten, keinen
gemeinsamen Willen; wegen ihrer intellektuellen Schwäche,
wurden sie eine unförmliche Menge; ..."Das ist eine Nation,
die vorbereitet ist, von autoritären Regierungen beherrscht zu
werden", behauptet der Richter.
Milkau, der Deutsche, antwortet:
No Brasil, ßque
certo, a cultura se Jam regularmente
sobre este
mesmo fundo
de populagão mestiga, porquejã
houve o toque dluino da fuSão criadora. Nada mais
pode embaragar
o seu üöo (...) E no futuro
remoto, a epoca
dos mulatos passarä
(...) (idem, S. 203)^
Milkau stellt auch den Deutschen dar,
der wegen seines Idealismus eine saubere und organisierte
Siedlung aufbaut, im Gegensatz des brasilianischen Volkes, der
von seinen Instinkten beherrscht wird. Ein Beispiel dafür ist
die Beschreibung einer Mulattin:
No batente da
porta sentnva-se uma mulata moga.
Toda ela
era a própria indol&ncta.
Os cabelos näo
penteadosjaziam pontas como
chtfres, a camisa
suja cata
'a toda no colo
desencamado e os peitos
de muxiba pendiam
moies sobre
o ventre. (ARANHA, J902, S.32)3.
Aber die deutschen Bauern, gehorsame und
hartnäckige, trotzdem wurden sie verarmt bei der Arbeit
geistlich; [19]
[20]
Via-se estampado
o pensamento üntco de cumprir o deuer prdttco, de camtnhar para a Jrente no
conjunto harmontoso
de um sd corpo. (S.39) [21]
Bilder und Vorstellungen wie diese
Beispiele haben vielen Lesern von Aranha geführt, ihm als
einen Verehrer des deutschen Einwanderungsprozesses zu
identifizieren. Es gibt aber in dem Roman eine andere Figur,
die uns besser seine politische Stellung beweist:[22]
es handelt sich um den zweiten Protagonisten, der sogenannte Lentz, der sich in eine andere Art von Deutschen
verkörpert: er ist stolz auf seine Rasse und will das mestitzische Volk beherrschen, durch
den Aufbau eines weissen Reiches in Brasilien. Nach seiner
Meinung,
Hri que se aceltar a lei da Vida, onde
o mais forte atrai o malsjraco;
o senhor arrasta
o escravo, o homem, a mulher.
Tudo 4 subordinagäo
e gouemo. (S.63)&
Sohn eines preussischen Generals, ein
Mann von Status und Reichtum, Lentz wanderte
aus seinem Heimatland aus, denn er verzichtete auf die Ehe; er
wurde von seiner Geliebten enttäuscht, weil sie seinen Namen
verlangte, um die christliche Sittenlehre zu
berücksichtigen, und aus ihm einen Sklaven zu
machen, laut seiner eigenen Worte (S. 58). In Porto Cachoeiro, hatte er vor, ein
Handelsmann zu werden, aber Milkau hat ihn überzeugt, eine aus
der Regierung zugestandene Scholle mit ihm zu teilen.
Lentz, wie Milkau, liebte seine Heimat und sah sie als
ein Vorbild der zivilisierten Gesellschaft; wie Milkau,
unterschied er die anderen Einwanderer durch seine gelehrte
Mentalität; er war nicht ein typischer Arbeiter, "der seine
Freiheit im Namen des Materialismus" opfert (S. 39). Die
Beiden glaubten an der Entwicklungstheorie, sowie an der
Überlegenheit der weissen Rasse. Allerdings, unterschieden sie
sich voneinander über den Weg und Weise um diesen Zweck zu
schaffen: Laut Milkau, konnte die zivilisierte Stufe nur durch
Solidarität und Liebe unter der Menschheit geschaffen werden,
und der Fortschritt ist eine Voraussetzung der Freiheit:
Quando a humanidade partiu do silencio das ßorestas para o tumulto
das ctdades, veto descrevendo uma longa pardbola
da maior escravldäo
ä maior liberdade.
Todo o alvo
humano e o aumento
da solidariedade. d a ligagäo do homem ao homem, diminuldas
as causas da separagdo. (S.
54) 7
Laut Lentz, nur wenn die Stärkeren den
Schwachen beherrschen, schaffen die Männer die Zivilisation,
und da ist das Schicksal der Deutschen in Brasilien. Nach
seiner Meinung, wird die Kultur des Mulatten immer niedrig sein, weil die Neger
in ihrem Blute die Bestialität tragen; so äussert sich Lentz;
[23]
Oßm de toda a sua vida
two 4 a ligagäo vulgar e mesqutnha entre os homens,
o que ele
busca no
mundo 4 realizar as
expressöes, as Inspiragöes da arte, as nobres,
Indomdueis energies,
os sonhos
e as visöes do poeta, para
conduzlr como
cheje, como
pastor, o rebanho.
Que importam
a solidaddade e o amor? Vlver a vlda na igualdade 4 apodrecer
num charco
(...) (S. 54) &
Dieser Gegensatz zwischen Milkau und Lentz * Liebe und Macht - äussert sich durch die ganze
Erzählung; Canaä stellt einen mikro- Kosmos dar, wo die
Einwanderer leben und über ihre alte und neue Welt sich
unterhalten. Milkau und Lentz
symbolisieren den
zivilisierten Mensch, der den Wilden besucht, eine kindliche
und naive Gemeinschaft, die keinen modernen Mechanismus
kennlernte. Gegen dieses romantische Vorbild, sagte Milkau
aus:
Realmente e um belo
quadro esse que
vemos, e o espetäculo
de um trabalho Uvre e individual nos embriaga de prazer,
mas nojundo
asststlmos a um co me go de
civiltzagäo; 4 o homem que
alnda näo
venceu grande parte dasjorgas da natureza
e estd ao
lado dela
numa postum humilde
e servil. (S.66) 9
Eine andere Darstellung könnte in diese Erzählung
formuliert werden; als einen Vorstellungsroman, wäre es nicht
unvernünftig zu [24]
[25]
vermuten, dass Milkau und Lentz eine
einzige Persönlichkeit repräsentieren, wie ein Geist in zwei
Körper geteilt. Wenn man diese Folgerung akzeptiert, dann kann
man ein Vorbild des Deutschen Geistes in der brasilianische
Kultur Anden. Einerseits, ist es der romantische und
idealistische Deutsche; andererseits benimmt er sich wie ein
Krieger, und seine Rationalität, welche nötig ist, kann seine
Empfindlichkeit unterdrücken. Sein Geist und seine Kultur
wurden deshalb sehr stark von seiner Urgeschichte imprägniert;
Philosophie und Kunst - die Liebe, gegenüber Krieg und
Beherrschung - der Macht, sind unter den Deutschen unbeugsam
verbunden.
Allerdings, gehöhrten Milkau und Lentz in Brasilien zu der Arbeiterklasse. Sie waren
Bauern, und trotz ihrer Ausbildung, mussten sie lästig
arbeiten. Unter dieser Bedingung, knüpften sie Kontakte mit
der einheimischen Bevölkerung, indem die Hauptkennzeichen des
"Deutschen" im Widerspruch zu den Charakter des Mulatten
gezeigt werden - die Faulheit des Mulatten im Gegensatz zu der
Arbeitsamkeit des Deutschen; der kleine und schwächliche
Statur des "Cearenses" zeigt sich
noch deutlicher gegen die Kraft und Grösse der Germanen (S.
73); die Naivität solcher einfache Leute erlaubte es nicht,
die Mitteilsamkeit der hoch europäischen Kultur, die jene
beiden Einwanderer besassen. Dazu noch empören sich die
protestantischen, asketischen und ungeschlechtlichen Deutschen
über die Sinnlichkeit und die Gaunerei der Brasilianer.
So haben wir ambivalente Gefühle und
Einstellungen gegenüber die "Deutschen" zu beobachten, sei es
ein einfacher Arbeiter oder ein Intellektueller; stark,
diszipliniert, Glied einer überlegenen Rasse, würde in der
brasilianischen Elite, die sich auf begieriger Weise den
Fortschritt wünschten, bewundert, ebenso aber auch verursachte
er auch ein Art Abneigung, weil er seine eigene
Empfindsamkeit, im Namen einer wissenschaftlichen Vernunft
erstickte.
Ausserdem war dieser Deutsche isoliert,
der Anblick einer Kultur, die sich Mestize dachte, in ihren
Werten und Gewohnheiten; war er, letzthin, der ewige Fremde,
denn man in den imaginären Grenzen eine Reihe Verweigerungen,
anlegte; und als man ihm ansah, "Brasilianer zu sein" wurde
für viele, geworden, eine weniger unbestimmter Begriff, als
einfach dasselbe Gebiet zu teilen und einer Zahl Gesetzten und
Regeln untertan zu sein.
In diesem Kapitel habe ich vor, die
Vorstellungen und Bilder welche über den Deutscheinwanderer
gemacht worden sind, anzuerkennen, die sowohl in der
brasilianischen Literatur wie in den Sozialwissenschaften
hervorgebracht worden sind, um verschiedene Ansichten der
Integration der Deutscheinwanderer in der brasilianischen
gebildeten Kultur zu untersuchen. Es interessiert mich auch
nachzufragen, in welchem Massstab diese unbeugsamen
Vorstellungen und Auseinandersetzungen zur Verarbeitung
(bewusst oder unbewusst) einer Reihe von Strategien, beitrug,
die sich der politischen Mentalität des autoritären Charakters
Brasiliens näherten.
Der Deutsche als
Verkörperung des Deutschtums
O nosso contingente tem
que ser
brastleiro. O dia em que nds Jormos tntetramente brasüetros e sd brasüetros, a
humanidade estarä rtca de mais
uma raga,
rlca duma
nova combinagäo de qualidades humanas (...) avango
mesrno que
enquanto o brasileiro
näo se abrasileirar,
e um seLvagem. 10
Mario de Andrade,
1922
Das Bild des Deutscheinwanderers wurde
praktisch bearbeitet zur Zeit des Kaiserreiches. Was sich auf
die politischen Debatten bezieht, war sie in der Zahl der
Betrachtungen zu Gunsten und gegen den Ersatz der
Sklaven-Arbeitskraft durch die der freien und europäischen
Arbeitskraft.
Es ist auch gewiss, dass es eine bestimmte Befremdung in Hinsicht auf
den nicht katholischen Europäer, sich bemerkbar machte, zur
Verteidigung der kulturellen Werte, welche die ersten
Kolonisten mit sich brachten. Diese Sorgen waren mit einem
nativistischen Gefühl einer patriotischen Eingebung,
verbunden, der in den höheren Schichten der Gesellschaft,
entstand. Aus dieser entstammen eine Reihe Schriftsteller die,
als sie nach Coimbra und Paris zurückkehren, arbeiten sie
Themen, aus welche ganz die romantischen Modelle ihrer
Meister, nachahmten: eine sentimentale und idealistische
Beschreibung der Vergangenheit, die Erhebung der in freier
Übersetzung: Unsere Bevölkerung muss brasilianisch sein. An
dem Tag da wir vollständig Brasilianer sein werden, und nur
brasilianisch, wird die Menschheit mit noch einer Rasse
bereichert, reicher mit einer neuen Verbindung menschlicher
Eigenschaften (...) ich behaupte, dass derweil der Brasilianer
sich nicht verbrasilianert, ist
er ein Wilder Natur, die Suche nach einem mystischen und
heldensinnigen Ursprung der Heimat. Die Heimat wurde übrigens
vom Bild des Indianers dargestellt, was eine einfache
Neuauflage der Bon
Sauvage laut Jean Jacques Rousseau
repräsentierte.
Die Literatur hatte ihren Mäzen, es war
der eigene Kaiser, der die Bildung einer nationalen Kultur
durch Kunst und die Geschichte anspornte, 11 eine
Initiative, das nicht aus politischen Gründen, sondern aus
persönlichem Wunsch geschah, in dem er den "Körper" seiner
Heimat kennenlernen wollte, dessen Oberhaupt er war.
Diese brasilianische Literatur, typisch
dieser Epoche, hatte ein beschränktes Publikum, das heisst,
die zu den hohen Schichten gehörende Jungend und die
ausgebildeten Beamten des Hofes, welche an den literarischen
Dilettantismus gewohnt wurden; derweil sie die aus Europa, von
den Dichtem mitgebrachten romantischen Ideen, kennenlernte,
wurden sie von einer Art "Selbständigkeitsgefühl" beeinflusst.
Dieser von der offiziellen Politik geförderte Nativismus trug
für den europäischen Einwanderungs-prozess bei. denn laut der
Meinungen vieler Politiker, würden "diese arbeitsamen und
ehrbaren Männer den Reichtum und den Fortschritt Brasiliens,
durchführen”.
Es ist hervorzuheben, dass die
literarischen und geschichtlichen Schriften damals von
mundartlichem Charakter imprägniert waren, sowie auch die
Politik und die Kultur es waren. Deshalb als später die
Veröffentlichungen vom ganzen Land handelten, beschränkten sie
sich darauf, die Nation, ihre Symbole und ihre Sprache zu
feiern.
Aber nur um die Jahrhundertwende, wird der
Deutsche [26]
Einwanderer im kulturellen Bühnenbild Brasiliens vorgestellt,
wo der schon vorhergenannte Roman Aranhas ein sehr wichtiges
Beispiel dafür ist. Seitdem Canaä erschien, fing die brasilianische
Literatur an, in vielfältigen Formen den deutschen Einwanderer
in seiner Bedeutung, sei es den aus Europa oder den aus
Vereinigten Staaten als leitendes Vorbild zu beschreiben, zu
denen sich die Sinnbilder der Gesellschaft fügten;
Gewissenhaftigkeit, Disziplin, Rationalität, der Deutsche im
Gegenteil zum Lateiner, sind Beispiele für die ersten
Eindrücke, die in der Literatur sich äussern.
So charakterisiert sich der Roman Mario
de Andrades, welche in 1927 herausgegeben wurde,[27]
und sich Amar,
Verbo Intransitivo
nennt (Zu Lieben,
ein intransitives Verb). In seiner Erzählung sind die
Unterschiede zwischen den Deutschen und den Brasilianern,
deutlicher betonnt.
Die Auswanderin "Fräulein Elza" ist die
Protagonistin des Romanes,
und als "Fräulein" wird sie
immer genannt. Sie ist eine 35-jährige Frau, die als
Haushälterin in einem portugiesisch- brasilianischen Hause
eingestellt wurde, deren Familie die aufsteigende Bourgeoisie
aus São Paulo vertritt.
Bei der Beschreibung der ersten Kontakte
zwischen diese deutsche Immigrantin und den anderen
Roman-Figuren, stellt Andrade
sie als eine ausgebildete und
formelle Frau vor, dessen Genügsamkeit ihr jede Empfindung zu
äussern, verbietet.
Sie wurde in zwei "Ichs" geteilt; in den
"Traum- Mensch" (o homem do
sonho), der sich romantisch und idealistisch
charakterisiert, aber in sich selbst verborgen, und den
"Lebens-
Mensch" (o homem da
vida), der sich sehr praktisch und sachlich
benimmt, welcher sich in jeglicher Situation äussern darf.
Diese Persönlichkeit scheint uns, denselben deutschen Geist zu
verkörpern, welchen Aranha, als er Milkau und Lentz beschreibt, zuspricht.
Als "Fräulein" zu Souza Campos kommt,
bringt sie Bilder von Richard Wagner und Bismarck mit, und
noch eine "grosse Anzahl Bücher".
Bei ihrem Antritt, beginnt sie sofort
ihre Arbeit, ohne Fragen zu stellen oder zu zweifeln, stellte
auch keine Frage über Bewegungen oder Regungen, womit sie
nicht zu tun hatte.
Elza war unfähig zu jeder
Spitzfindigkeit, sie lachte nicht noch weinte sie; ihr
Rhythmus war ruhig und taktmässig; sie übte langweilig ihre
Tätigkeit aus und hatte einen einzigen Zweck: Geld zu sparen
um nach Deutschland zurückzufahren.
"Fräulein", eine arianische Frau, ist
die Hauptfigur des Romanes.
Trotzdem, im Gegenteil zu den
romantischen weiblichen Protagonisten, ist sie nicht hübsch
und zerbrechlich. Als Expressionist, beschreibt sie der
Schriftsteller als ein sauber, gesund und wahrscheinlich
fruchtbarer Typ; ausserdem benimmt sie sich wie eine Soldatin;
aber wenn sie allein ist, träumt sie von Liebe, von Heimweh,
von der Natur und davon sich, ein Heim aufzubauen.
Das Fräulein hatte eine heimliche
Pflicht bei Souza Costas Familie zu erfüllen, was nur der
Familienchef kannte. Sie war verantwortlich für die ersten
sexuellen Erfahrungen des ältesten Sohnes Carlos Costa.
Am Anfang treibt sie diese Tätigkeit als
ob sie eine irgendwelche Aufgabe wäre, wie zum Beispiel,
Klavier spielen oder die deutsche Sprache zu lehren. Aber nach
und nach beginnt sie sich in Carlos zu verlieben.
In diesem Moment, beschreibt sie der
Erzähler als ein
zerrissenes Wesen, laut
den Worten Andrades:
Estava muito pouco Fräulein neste momento. Porque
Fräulein, a Elza que princlplou
este Idillo
era uma mulher felta, que
näo estava
dlsposta a softer. E a Fräulein deste mlnuto £ uma mulher desfetta, uma
Fräulein que sqfre. E- porque
sojre estä
al£m de Fräulein, alem de alemä:
6 um pequenino ser humano.(I927, s. 119) ^
Und was die Freude am Sex anbetrifft,
bis dahin unbekannt, verwandelt sie in einem grotesken Wesen,
sozusagen, eine Karikatur der Elza. Laut Andrade:
Os olhos dela pouco a pouco
se fecharam, cega duma
vez l...)Das partes profu.nd.as do serüie vtnham apelos vagos e decretos
Jracionados. Se misturavam animalidades
e invengöes geniais.
E o orgasmo. Adquiria enßm uma
alma vegetal. E asstm perdida, assim
vibrando, as narinas se alastraram, os läbios
se partiram, contraqöes, rugas,
esgar, numa
expresSão dolorosa
de gozo, ficou
Jeia. (S. 120)[28]
[29]
Aber als das Idyll aufhörte,
unterdrückte das Fräulein ihre heimlichen Gefühle, und ihr
"öffentliches "ich” triumphiert". Sie verzichtete auf die
Mischung. Es ist nicht Wagner (der Traum- Mensch), sondern
Bismarck (der Lebens-Mensch), der sie aus dieser Wohnung heraus führt. Sie
ging weg, um irgendwo anderen Liebeslehren zu geben.
Das Vorbild des Deutscheinwanderers als
Verkörperung des Deutschtums, als ein Individuum,
der identisch wie
irgendeiner aus ihrem Volke, stark, kriegerisch, gefühllos,
ein echter Sohn Odhins wird in
vielen anderen Romanen und Erzählungen imprägniert werden, sei
es in der Literatur, sei es in den Zeitungen oder selbst in
den populären Chroniken.
Im Rahme der Sozialwissenschaften ist es
aber, dass die Deutscheinwanderung systematischer behandelt
wird. Ich beziehe mich besonders auf die Erscheinung des
kritischen Geistes, der zum Ende des Kaiserreiches und zu
Anfang der Republik entwickelt wurde.
In dieser Konjunktur ist es wichtig den
Schriftsteller Sylvio Romero
zu erwähnen. Er war der
Erste, welcher die Deutsche Einwanderung, als ein
wissenschaftlicher Themenkreis behandelte.
Sylvio Romero war
ein Intellektueller, der sich am stärksten den
nationalistischen Ideen verpflichtete. Deshalb strebte er
danach, den Versuch einer selbständigen Identität für die
brasilianische Gesellschaft zu erreichen, die weder im
Allgemeinen einer europäischen noch portugiesischen Kultur
begründet sein sollte.
Er beginnt seine literarische Betätigung
als Kritiker in der 70. Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts, und
sorgt sich seitdem mit der analytischen Funktion der
Literatur. Er verwirft die romantischen Vorbilder und schlug
es vor, die Bearbeitung des Studiums der brasilianischen
Kultur nach modernen Methoden zu machen, infolgedessen
orientierte er sich nach der Entwicklungstheorie von Haeckel und Büchner.
Romero gehörte, wie auch Graga
Aranha, zu der "Recifense- Schule"
[30];
allerdings, laut Antonio Candido, (1988, S. 31u.w.), waren
seine Kenntnisse über die deutschen Denker nicht so gründlich
tief wie die seines Meisters Tobias Barreto. Es
handelte sich um Lektüre und Auslegungen, welche durch die
Franzosen vermittelt wurden, mit welchen er wirklich enge
Kontakte anknüpfte. Diese Bemerkung ist wichtig um das
Verständnis seiner Annäherung zu Gobineau
zu fördern, sowie auch die leeren Stellen in seinen Gedanken
und derjenigen von ihm bewunderte deutsche' Wissenschaftler;
vor allem, es ermöglicht uns seine Identifikation mit dem
Mythos der "Deutschen Gefahr" zu verstehen, wie dieser Mythos
von den Franzosen bearbeitet wurde. Deswegen, war Romero einer der wichtigsten Verbreiter dieser Ideen in
Brasilien.
Als ein in der Völkerkunde
interessierter Schriftsteller und ein Literaturwissenschaftler
verstand und analysierte er die brasilianische Kultur als
einen Wiederschein des rassischen Mischungsprozesses; diese
Kultur entstand aus der Verschmelzung dreier Rassen, das
heisst, die Weisse, die Schwarze und die Rote. Diese durch
Verschmelzung entstandene Rasse, deren Geist noch aufzudecken
wäre, würde für die soziale Kohäsion verantwortlich sein, die
das Land bedurfte, um seine historische Besonderheit zu
bilden. Deshalb konnte sich Brasilien in Zukunft als ein Land
mit seiner Eigenart gegen der Welt gegenüber äussern.
Diese Überlegungen, die von Gilberto Freyre in den 30. Jahrzehnte des 20.
Jahrhunderts tiefer ausgearbeitet wurden, [31]
lehnte sie nicht ab, aber verminderte die rassistischen
Tendenzen des europäischen Geistes, welche ein Vorbild für die
brasilianischen Intellektuellen war.
Gleichdenkend mit denen seines
Zeitgeistes, gab Romero wohl die Niedrigkeit des Negers und
Indianer zu, aber er glaubte auch dass; durch häufigere
Mischungen und mit der weiterlaufenden europäischen
Einwanderung eine Zunahme der Bevölkerung entstehen würde und
die Eigenart der Weissen sich gegen die Anderen durchsetzen
würde.[32]
Wenn jedoch, die Utopie des Vergleichens
der brasilianische Rasse (O branqueamento da
raça brasileira) ein Erfordernis zu einem bestimmten
Fortschritt des Ethos zu bilden ist, und das Verbleichen
durch die europäische Einwanderung erreicht würde, warum
stellte sich Romero gegen die Deutschen, solch ein
unbestreitbar arianisches Volk? Es handelt sich um nach dem
unordentlichen Charakter der deutschen Ansiedlung in Brasilien
zu fragen, sowie die Unentschiedenheit ihrer Rolle in der
brasilianischen Gesellschaft. Von den Deutschen sollte man nur
ihren biologischen Charakter wie auch ihre Leistungsfähigkeit
in der Arbeit gebrauchen; aber nicht in der Politik weder noch
in der kulturellen Bildung Brasiliens durften sie teilnehmen.
Denn sie gehörten nicht der brasilianischen Vergangenheit an
(noch ihrer Geschichte), deshalb würden sie auch nicht zu der
Zukunft gehören, weil sie Träger einer fremden Kultur waren.
Sie sollten also als ein biologischer
dazwischenliegender Grundstoff dienen, um das brasilianische
Volk zu formen.
Lassen wir uns durch Romero aufklären; in einer seiner Veröffentlichungen,
welche von der Deutscheinwanderung handelten,[33]
analysiert er, eine von ihm selbst aufgezeichnete
völkerkundige Landkarte, auf der wurde das brasilianische
Gebiet in vier völkischen Gegenden geteilt. Die nordische und
westliche Mittelzone ist eine Wildnis und laut dem Verfasser,
kaum bewohnt; deswegen sind sie auf dem Risiko des
nord-amerikanischen Ausdehnungsdranges.
Die südliche Zone, die von Rio de
Janeiro bis zu dem Rio Grande do Sul sich
hinzieht, steht unter den Einfluss der Italiener und der
Deutschen, die für ein bedeutendes demographisches Wachstum,
verantwortlich wird. Zuletzt die vierte Zone, die Ost-Nord und
Ost-Süd Brasiliens umfasst geht (von Maranhão
bis zum Staates Espirito Santo),
hier wurden die Portugiesen die Mehrheit der Bevölkerung, und
deren Hauptproblem ihrer Tendenz zur Mischung ist.
Was die deutsche
Bevölkerungskonzentration in Santa Catarina, Paraná
und Rio Grande do Sul anbetrifft, repräsentiert sie, laut des
Verfassers, ein doppeltes Risiko; erstens, die rasche
wirtschaftliche Entwicklung, die intensiver als in den anderen
Gebieten ist, dank der Arbeitsamkeit dieser Bewohner. Diese
Entwicklung bedroht die Hegemonie derer die von
portugiesischer Abstammung sind, und gleicht bald ihrer
herkömmlichen Kultur. Zweitens, bezieht sich auf die
Möglichkeit eines Verlustes der sprachlichen Einheit, da die
deutsche Sprache doch häufig unter die Einwanderer benutzt
wird.
Tatsächlich erreichte in der
Jahrhundertwende dieses Gebiet, im Vergleich zu den anderen,
einen bedeutenden Fortschritt, denn die Verteidigung des
kleineren Besitzes ermöglichte die Erschaffung eines
Inneren-Marktes und folglicherweise
die Entstehung einer ausdruckvollen Mittelklasse.
Ausserdem bewahrten viele Einwanderer
die deutsche Sprache, als ihre Umgangssprache, sei es wegen
der Unkenntnisse der portugiesischen Sprache, oder aus
psychologischen Gründen. Solche Faktoren trugen dazu, nach
Romeros Meinung, um die politische Rivalität anzukurbeln.
Um diese Probleme aufzuheben, müsste die
deutsche Bevölkerung sich im ganzen brasilianischen Gebiet
verteilen.
Nach seiner Meinung ist die Politik
streng mit der Biologie verwandt. Wenn ihre Methode in den
Sozialwissenschaften gebraucht werden, scheint es mir, dass
tüchtige Programme und Werbungen den Willen der Menge in
Richtung der leitenden Mischung durchführen könnten. (1904. S.
313)
Anderes gesagt, schlug der Verfasser die
Verbreitung der Arianischen Vertreter in anderen Gebieten vor,
damit sie selbst durch das Heiraten Mischehen eine neue
Bevölkerung produzieren könnten. Gleichzeitig sollte die
Regierung Werbungen planen, um das Bedürfnis andere
portugiesische Einwanderer zu fördern wegen der Hegemonie der
nationalen Sprache.
Die Ideen Romeros über die
Deutscheinwanderer werden deutlicher in der Veröffentlichung O Germanismo no
Sul do Brasil
(Das Deutschtum in
Süd-Brasilien), der in einer Zeitung von Rio de Janeiro,
erscheint. In dieser formulierte er eine Analyse über die
deutsche Geschichte, die bis ins Altertum zurückgeht, um die
fast genetische Tendenz dieses Volkes zu dem Ausdehnungsdrang
zu prüfen; solche Kennzeichen werden als eine Tugend
angesehen, wie man aus seinen Betrachtungen über das Zeitalter
Bismarcks bemerken kann;
Was für ein Volk ist dieses Volk. Schau
die Herrlichkeit, die Kühnheit seiner Ziele,
die Unerschrockenheit wen es spricht; da hört die Regierung
auf die Intellektuellen und nimmt ihre Ratschläge an. {1906.
S. 17).
Trotz dieser Lobreden, fürchtet Romero davor, dass die völkischen und sprachlichen
Prinzipien, auf welche die Deutschen sich gründen, um ihre
Nationalität zu bestimmen, gilt auch für die deutschen
Ansiedlungen in Brasilien; denn wenn das Boden-Prinzip (jus soils) nicht berücksichtigt wird, wird Süden
Brasiliens sicher ein von den Deutschen als ein
Eroberungs-Zweck gesehen, was vorläufig noch nicht geschehen
ist, dank der politischen Kraft des Panamerikanismus, von den
Vereinigten Staaten ausgeführt.
Gemäss den Nachrichten aus den
französischen Zeitungen, den Gliedern des
Alldeutschenverbandes und selbst der deutschbrasilianischen
Presse, beweist man das Risiko, einen neuen unabhängigen Staat
in Süden Brasiliens zu gründen, unmittelbar mit Deutschland
verbunden, deren Regierung ihm den militärischen Schutz gäbe.
Andererseits, kritisierte Romero die Einwanderer, weil sie kein Interesse für die
Öffentlichkeit in Brasilien hatten (das heisst, seiner Meinung
nach, für die politischen parteiliche Streite), weil sie nicht
die nationale Sprache kannten und auch weil sie die Regierung
nicht berücksichtigten.[34]
Er widersetzte sich auch den süd-brasilianischen Politikern,
denn wegen der Wahlen und ihrer populistischen Haltung
unterdrückten sie
nicht diesen Unternehmungsgeist.
Und laut einer seiner Anhänger Romario
Martins, selbst das Wahlrecht sollte den Deutscheinwanderer
verboten werden, bis dass sie ihre Liebe zu der neuen Heimat
bewiesen hätten. Laut Martins, während dem das sich nicht
ereignete, würden sie nur zu arbeiten berechtigt sein
(MARTINS, 1900, s. 67).
In dieser Richtung, wurde unfraglich,
das Verbot des Gebrauchens anderer Sprachen, ausser der
"nationalen" Sprache, das Verkaufen grösser Besitze an
Ausländer und die obligatorische Lehre der portugiesischen
Sprache in den privaten-Schulen. Es würde sich noch nötig
zeigen, einer demographischen Politik anzuregen, die eine
Zwangsmischung durchführte.
Intellektuelle wie Sylvio Romero und Romario Martins beeinflussten nicht, trotz
ihrer Anstrengungen, die offizielle Politik in Brasilien. Das
geschah nicht, weil ihre Gegner stärker waren, aber wegen des
öffentlich-betriebswirtschaftlichen Charakters dieser
Konjunktur. Ausser ihrer Verachtung gegenüber der
Intellektuellen, wie Romero
damals schon beklagte, die
relative Unabhängigkeit der provinziellen Regierungen
ermöglichte es nicht, dass ein umfassender und geplanter
nationale Massstab ergriffen werden konnte. Deshalb wurden
ihre Verlegungen über die Nationalität und die Kultur nur
unter anderen Intellektuellen in Betracht gezogen. Solche
Ideen sollten mindestens zwanzig Jahre warten bis sie
berücksichtigt werden konnten; es wurde nötig, dass gebildete
Männer sich einer Regierung näherten; eine Regierung, die
besorgt war, Brasilien zu lieben, es zu schätzen, sich um
seine Zukunft zu bemühen und einen Neuen Staat (Estado
Novo) [35]
zu gründen; dazu aber mussten solche Ideen alles Fremde
verabscheuen.
In
einer kurzen Episode des Romans Um
lugar ao
sol (Ein Platz unter der Sonne) [36],
von Erico Verissimo,
einer der populärsten Schriftsteller Brasiliens seit der 30.
Jahrzehnte, ein junger Mann hat ein zufälliges
Liebesverhältnis mit einer deutschen Frau, die sich Annelise
nennt, deren Beruf oder soziale Stellung unbekannt ist.
Von den zwei anderen Roman-Figuren, die
auch Deutsche sind, wurde ihre Vergangenheit wie auch
Einzelheiten ihres gegenwärtigen Alltags nicht geäussert.
Der junger Vasco ist
arbeitslos; er wandert unterwegs umher, durch die beweglichen
und lärmenden Strassen von Porto Alegre, als
er aus Versehen Annelise trifft, eine deutsche Frau, die
(...) uma mulher que
"parecia de mnrmore,
de gelo, de g£sso,
de qualquer coisa,
menos da matärta
de que ile
fora/eito".
(1966. (1936j, S. 667) [37]
Ohne ein Wort Portugiesisch zu können,
zieht sich Annelise Vasco
mit Gesten, Seitenblick und
Umarmung an. Sie gehen in Kaffees, zum Strand, ins Kino,
irgendwo, ohne ein Wort
zu tauschen.
Nach einigen Tage, lädt sie ihn zu ihr
ein, ein typisches deutsches Haus, das trotz seiner Grösse,
fast unbewohnt scheint; vielleicht blieb Annelise immer
allein.
Im Zimmer der Geliebten, während Vasco auf sie wartet,
Vasco apanhou distraidamente uma revista (...) eram
prospetos das oltmpiadas de Berllm.
Folheou a revtsta.
Vistas de Colönia, de Francofort de cldades
das margens do Reno (...) Tudo aqullo pertencia
a um mundo sonhado
mas nunca
visto. Annelise pertencia a esse mundo:
a sua figura esbelta, os
seus cabelos
louros eram
produto daquela
patsagemfria, daquela terra
onde ca(a
neve no inuemo. Vasco
sentiu-se estrangeiro.
(S. 714) 23
Diese Erfahrung eines zweiundzwanzig
jährigen Jungen, der gerade in die Hauptstadt gekommen ist,
provozierte eine komische Erinnerung, in der sich erotische
Sensationen, Schuld, Liebe und Hass vermischten, ausserdem
noch die Schande, weil er im Vergleich zu der Geliebten einer
unterlegenen Schicht gehörte.
Nach dieser Begegnung, fühlte sich Vasco ein Verräter seines Volkes, seines Clans, des
Geistes seiner Gruppe (S. 714). Trotzdem war er verliebt, und
konnte es nicht verhindern, sie wieder zu treffen.
Wahrscheinlich wäre er immer bei ihr geblieben, wenn diese
deutsche Frau, trotzdem sie ihn während des angenehmen
Abendeuers "Mein Wilder" nannte, zurück nach Deutschland
gefahren wäre dank ihrer Enttäuschung gegen dieses Land.
Leben ohne Vergangenheit,
Unmittelbarkeit mit den Menschen, weil sie nicht die gleiche
Sprache kannten, Annelises freiwillig Exil, die Schuld und
Leidenschaft Vascos, das sind die Szenen eines [38]
Romans, der wie für einen Kinematographischen
Leitfaden geschrieben wurde, in einer von Verissimos zugetaner Ausdrucksweise,
seit er ein Kind war. Und als ein Kind, das einen verbotenen
Film anschaut, so spricht der Verfasser von Leuten, die nachts
über düstere und verdächtige Plätze laufen, wo Frauen, wenn
überhaupt welche da sind, nötigerweise
vergängliche Wünsche erwecken.
Gleichdarauf, nimmt die Erzählung eine
andere Richtung ein, welche das langweilige Leben der ernsten
und konventionellen Leute betrifft.
Um
lugar ao
Sol umfasst eine
Reihe von literarischen Werken, die in Brasilien als
regionalistische-Romane bekannt wurden. Wie Gracilianos Ramos, Jorge
Amado und Lins do Rego, interessiert sich auch Verissimo für die Beschreibung der
universellen Themen, die mit den innigsten Ansichten seiner
Roman-Figuren, sowie mit deren subjektiven Erfahrungen ihrer
Umwelt, in welcher sie eingefügt sind, zu behandeln.
Verissimo entfernt sich auch anderen Verfassern
wie Mario de Andrade und Graga
Aranha, nicht nur wegen seiner regionalistischen Einstellung,
sondern auch seiner Ansicht dem Deutscheinwanderer gegenüber;
als "Gaucho", [39]
hat er es früh gelernt, sie als Mitbürger neben andere
Einwanderer, zu verstehen. Er war es gewohnt, sie in ihrer
kulturellen, politischen und sozialen Verschiedenheit
anzuerkennen, wie er in anderen Romanen, zum Beispiel, die
Figuren seines berühmtesten Werkes O tempo
e o
vento schildert. Ausserdem konnte er als
"Gaucho" leichter den Unterschied zwischen die
Deutschbrasilianer und die in Rio Grande do Sul wohnenden Deutschen erkennen.
Allerdings, schreibt er dieses Buch im Jahre
1935.
Infolgedessen scheint es uns unmöglich, dass
Annelise nur zufällig eine deutsche Frau war, und Vasco, ein Mestize aus der unterlegenen Schicht, Freund
von Rebellen, Anarchisten und Revolutionäre. Es wäre auch
nicht unwägbar zu vermuten, dass dieser kleine Auszug des
Romans Um
Lugar ao Sol die Bestrebung hätte, das freiwillige'
Exil mancher Deutschbrasilianer, welche von dem
Nationalsozialismus verführt würden, oder der Schock der
beiden Kulturen, die trotz ihres vertrauten Umganges weit über
ein Jahrhundert, begonnen sie sich starrsinnig abzusondern als
ob sie vollkommen fremd wären. Oder könnte es ein Auszug
dieser Utopie das Verbleichens spiegeln, dessen Vertreter
keine Bewunderung in Verissimo
hervorrief; der Wunsch weiss zu sein, das
Minderwertigkeitsgefühl, die Leidenschaft und der Hass zu der
werdenden vorbildlichen Zivilisation des deutschen Volkes,
sind wahrscheinlich Darstellungen die, die Bestürzung des
Verfassers gegen das kulturelle Bühnenbild seiner Epoche
offenbart. Und wenn diese Darstellung in den Überlegungen des
Verfassers vorhanden waren, kommen wir auf den eugenischen
Gedanke von Oliveira Vianna, der Sozialwissenschaftler, der die
Ideen Romeros in der zwischen-Periode der beiden Kriege, das
heisst, die dreissiger Jahre, vertritt.
Die Einwanderer
nach Viannas Weltanschauung
Wenn man die Autoren, die von der
Entwicklungstheorie in Brasilien inspiriert wurde, analysiert,
welche sich über den wirtschaftlich, kulturellen Rückstand
Brasiliens sorgten, wird man
keine wesentliche Erneuerung in den Werken Oliveira Viannas finden.[40]
Wie Sylvio Romero, Nina
Rodrigues, João Batista de Lacerda, Romario Martins, unter anderen,
verteidigte er das Bedürfnis des Verbleichens der
brasilianische Rasse und die Unmöglichkeit des demokratischen
Systems in der brasilianischen Politik, solange das
Nichtvorhandensein einer durchaus bewussten nationalen
Identität dieses Volkes aufzuweisen wäre. Gleichwie die
anderen Schriftsteller, lehnt Vianna
die romantischen Vorbilder ab, seiner Meinung nach, bedeutet
das nur eine eigeschränkte Erhebung der Heimat und der Natur.
Vianna selbst bekennt es, dass er sich der
soziologischen und volkskundlichen Methoden sowie der
Geschichtswissenschaft bedient, um die Last der Vergangenheit
über die gegenwärtige Gesellschaft zu identifizieren, gemäss
der Übereinstimmung der "Recifenser-Schule".
Aber trotz seiner Identifikation mit den
Intellektuellen, die für um wissenschaftlichen Gedanken
kämpfte, deren Publikum sich unter ihren Mitspielern als
Teilhaber einschränkte, sprach jedoch Vianna
von einem anderen und einzigartigen politischen Standpunkt,
denn er wurde, unter anderen, von den offiziellen Mächten
aufgefordert, die kulturelle Politik und die politische Kultur
anzudeuten. Es ist nämlich die Konjunktur, welche seine Ideen
bekannt macht, welche für die Veränderung solcher Debatten
verantwortlich war. Sie besteht nicht mehr aus der reinen
Rücksicht des gelehrten Wissens, wie in der gebildeten
literarischen Aussprache, aber aus der Politisierung der
kulturellen und geschichtlichen Thematik; denn die Hersteller
der kollektiven Gedächtnisse wurden streng mit den
institutionalisierten Mächten verbunden, um die echte Ausübung
der Herrschaft zu gewährleisten. (DE DECCA, S. 72, u. w.).
Welche Ereignisse spielten eine wichtige
Rolle für diese Umwandlung? Zuerst ist die nationalistische
Ideologie zu erwähnen, die seit des 19. Jahrhunderts in
Brasilien als eine der Hauptleitmotive' der hohen Kultur
erklärt wird, und die während des ersten Weltkrieges einen
entscheidenden Antrieb erlebt.
Mit der diplomatischen und militärischen
Anordnung dieses Landes zu Gunsten der Alliierten ergab es
sich, dass der Panamerikanismus und die darauffolgende
Bestrebung um die selbstständigen nationalen Werte zu zentrale
Themen der politischen Debatten auszubilden. Die Bewegung zu
Gunsten der Alliierten, die Gründung der Liga
da Defesa Nacional - LDN (Verband zum Schutz der
Nationalität) und die Bestätigung der vereinheitlichen
Sinnbilder der Heimat sind bedeutende Beispiele dafür.
Es ist aber auch wesentlich wichtig zu
berücksichtigen, was unzählbare Geschichtswissenschaftler der
70. und 80. Jahrzehnte in ihren Monographien und Thesen
veröffentlichten. Dies ist ein Abschnitt indem die
Arbeiterklasse in den Hauptstädten des Landes eine zahlreiche
Ausdruckskraft gewinnt. Diese Arbeiter kommen aus den
brasilianischen wie auch aus europäischen ländlichen Gebieten
um in der Industrie und in den Handel-Sektoren sich
anzustellen. Es handelt sich hier zufälligerweise um ein Teil
der Bevölkerung, dass arme Emigranten umfasst, welche nicht
stillschweigend den zunehmenden Gebrauch der Maschinen, in der
Umstellung des Arbeitsprozesses, die Steigerung der
Arbeitszeit, die niedrigen Löhne und die zunehmende Disziplin
und Oberaufsicht ihres Alltags akzeptieren würden.
Die Streikbewegungen von 1907, 1913 und 1917, die
Konflikte zwischen Arbeitern und Werkführern, gegen die neue
Arbeitseinteilung, die schlechte Behandlung und die Arbeit der
Minderjährigen sind die Tagesordnung der öffentlichen Meinung
(DE DECCA, 1983, S. 47). Unter diesen Arbeitern, die über
ihrer "neuen Welt" bestürzt sind, wurde es der Elite deutlich
wahrnehmbar, dass unter ihnen die Anwesenheit der europäischen
Eiwanderer sich bemerkbar machte, von nun an als "Ausländer”,
"eingewanderte Bevölkerung", "Deutsche", "Italiener",
"Fremde”, usw. genannt.
Maria Stella Bresciani,
(1975, S. 284-300) schilderte genau die Bestrebungen der
Elite, um diese gegen die wirtschaftliche Ausbeutung
gerichtete populäre Demonstrationen entgegenzutreten.
Als Auswirkung dieser Konflikte erwies
sich eine Reihe vielfältiger Strategien und Massstäbe der
sozial-Kontrolle, dessen Leitung der
öffentlichen-Betriebswirtschaft angeordnet wurde, schon seit
Ende des 19. Jahrhunderts. Solche Massstäbe und Regeln wurden
nicht nur der repressiven polizeilichen Überwachung
eingeschränkt, sondern auch in der Empfehlung einer
Erziehungspolitik, welche den zivilisierten Charakter des
Staates widerspiegeln sollte. Laut Bresciani,
die vorgefasste Meinung, die Bürger juristisch gleichzumachen,
einer der wichtigsten Prämisse des Liberalismus, hatte die
Erziehung der Bevölkerung, als Imperativ. Diese sollte nicht
nur die Arbeiter beruflich ausbilden, sondern auch in ihnen
ihre bürgerlichen Pflichten einprägen.
Was hauptsächlich die deutschen
Einwanderer betrifft, ist zu bemerken, dass zufällig der
grösste Teil dieses Kontingents nicht in den Hauptstädten
angesiedelt war [41];
ausserdem laut der offiziellen Reden waren sie nicht in
widersprüchlichen Bewegungen gegen der Bourgeoisie Ordnung
engagiert - eine Verantwortung, die den Italienern zugesagt
wurde.
Trotzdem wurde die Resistenz gegen die
Assimilation der deutschen Einwanderer intensiver, was als ein Risiko gegen
die' erwünschte
Gleichartigkeit des Volkes angesehen wurde. Ausser diesen
Begründungen, muss man es berücksichtigen, dass die meisten
Deutschbrasilianer den evangelischen Glauben bekannten, ein
Zustand, der sie als Ausländer weit über den Gesichtspunkt der
Nationalität setzte.
Trotzdem die Katholische Kirche, ihren
offiziellen Charakter seit der Republik verlor, verblieb sie
noch eine einflussreiche politisch- kulturelle Institution.
Zwar ist es Gewiss, dass die zugeschriebenen friedlichen
Beziehungen noch als Kompromiss zwischen Protestanten und
Katholiken vom Klerus bewährt wurde, im Namen der
gegenseitigen Toleranz. Aber gegen Ende des 20. Jahrhunderts
erweckte die Ankunft der Leiter und Anhänger der
Philo-pietisten, Fundamentalisten
und
auch Charismatische
Bewegungsleader, welche aus Europa und aus den Vereinigten
Staaten kamen, die Aufmerksamkeit der Kirche, die der Kirche
als eine so ernsthafte Gefahr bedeutet wie der Sozialismus und
die heimliche Gesellschaft.[42]
Im Namen dieser Gefahr, organisierte
sich der katholische Klerus, gegen solche Sekten zu kämpfen,
nicht nur im Nennen des "wahren Glaubens", sowie auch zur Ehre
der Heimat, deren Geist durch Erbschaft als katholisch
verstanden wurde.
Wir zitieren beispielsweise eine
Stellungnahme des Bruders
Celestino de Padalovi während des
katholischen Kongresses, im Jahre 1902:
Von Storchon
und Muncer kamen die
Wiedertäufer, welche von Beruf Kommunisten und zornige'
Anarchisten sind. Durch Zwingli kamen die Sakramentarien,
welche die Erbsünde, die Taufe, das katholische Zölibat, usw.
verneinten (...) Die Calvinisten, die den gefährlich freien
Willen der Mensch bekämpften, und die Gott für einen Despot,
einen Tyrannen, einen Mörder seiner Kreaturen hielten. Die
Anglikaner des Heinrich der VIII. ein lächerliches Gemisch des
lutherischen Protestantismus und der bischöflichen Hierarchie.
Dazu kamen die Presbyterianer. (...). die energisch nicht nur
gegen die katholische Kirche protestierten, sondern auch und
viel mehr gegen die 39 Artikel des Anglikanismus. welche sie
wütend abschlugen und verabscheuten. Dazu die Quäker, die
haarsträubend die Presbyterianer und den Anglikaner verwerfen
und zurückstossen. Dann kommen noch die schmähsüchtigen
Methodisten, die aus Wesley
ursprünglichen Methodisten,
die Reformierten, die Calvinistischen-Methodisten. die
wiedergetauften Christen. Mormonen, die Herrenhüter, die
französischen Protestanten, die deutschen Reformatoren. 28
Die Bestrebungen der Katholische Kirche
sich der evangelischen verbreitenden Bewegung zu widersetzen,
um die religiöse Gleichartigkeit und Einigkeit unter dem
brasilianischen Volke zu erhalten, trug während des
Säkularisation Prozesses bei, um das patriotische und
nationalistische Assoziationswesens anzuregen. Die Agão Nacionalista (Nationalistische Aktion), der Partido Nacionalista Regenerador (Erneuernde Nationalistische Partei)
und die Legião
Cruzeiro do
Sul (Kreuz des Südens Legion), welche in den
20. Jahrzehnten entstanden, sind Beispiele solche Vereine, die
in dieser Zeit sich an der Agão Integralista Brasileira (Die Brasilianische Integtralistische Aktion)
eingliederten. [43]
[44]
(SEITENFUSS, 1985, S. 70; OLIVEIRA,
1990, S. 167).
Versucht man die 20. Jahrzehnte
im Allgemeinen zu erfassen, so lässt sich
die kulturelle Identität und die nationale Frage der
politischen Debatte finden; zu dieser Zeit entstand auch die
moderne intellektuelle Bewegung, welche Semana de
Arte Moderna
genannt wurde, deren Hauptziele eine kritische Stellung gegen
die Pflege der romantischen Literatur und Kunst der
Vergangenheit und die mimetische Haltung in Verhältnis zu den
literarischen und künstlerischen europäischen Vorbildern
anzunehmen, war, unter der Behauptung einer ästhetischen und
thematischen Erneuerung, welche fähig wäre, die technische.
Zivilisation und industrielle Welt widerscheinen zu lassen.
Ausserdem sollte diese neue Weltanschauung mit dem
Versuch echter nationale Werte und Bildung verbunden sein.
Im Gegensatz dieser ideologischen
Prämisse, nach Meinung der Intellektuellen, die
Einwandererbewegungen, das Risiko der Entnationalisierung, die
Streike, die lange Ausdauer zu der Assimilation, wirkte.
Laut Adalberto Marson,
(1979), zur Gegenwirkung zu diesen Tendenzen, entstand einer
Art von Nationalismus, der streng von einem verteidigenden
Charakter imprägniert war, und dessen Ziel die anhaftende
Widrigkeit einer von aussen abhängigen Volkswirtschaft
entgegentreten zu müssen; dazu wurde vorgeschlagen, eine
stärkere Interferenz des Staates zu führen, um die
technologische Entwicklung und die des
Volks-Erziehungs-Prozess durchzuführen.[45]
Allerdings, neben solch eine
pragmatische, politische Empfehlung, entstand eine andere Art
nationalistischen Begriffes, welcher von der Mittelklasse, von
anderen Intellektuellen und Journalisten formuliert wurde. Es
handelte sich um einen in irrationalen vereinigten Mythen
inspirierenden Nationalismus, dessen Voraussetzung die soziale
und kulturelle Kohäsion war. Laut ihrer Ankündiger, sollte man
sich der gegen-revolutionären Erfahrungsbewegung
Europas nähern, welche es die Konflikte zwischen Kapital und
Arbeit zu vermindern erreichte. Dazu bediente man sich vor
allem der Staatsapparate, die einen vormundschaftlichen
Charakter über die Gesellschaft übernahm.
Es ergibt sich daher eine symbolische
Ebene, dessen Grundlage der Mythos der Nation war, und diese
als universelle Interessenträgerin angesehen wurde; von da an,
sollte alle anderen Interessen sich ihr unterstellen. In
diesem Sinne, wurde die Nation nicht mehr als der Guardian des
Bürgerrechtes angesehen, sondern als Schiedsrichter des
kollektiven Willens.
In diesem politischen und kulturellen
Zusammenhang findet man die Ansatzstelle Oliveira Vianna Gedankens; wie man schon behauptete,
unterscheiden sich seine Ideen über die brasilianische
Gesellschaft nicht viel als die der anderen Intellektuellen,
die ihm voranging. Etwas Neues was an seinem Gedanken zu
erwähnen ist, besteht aus Überlegungen über zwei von ihm
bewunderten Wissenschaftler: Gustave Le Bon und Francis Gaiton.
Trotzdem die Werke dieser beiden
Wissenschaftler seit dem 19. Jahrhundert in Brasilien bekannt
waren, ist es Vianna wer sich
ihnen in tiefer und aufmerksamerer Betrachtung zuneigt.
Seine Begeisterung war
selbstverständlich nicht zufällig; Gustave Le Bon, zum
Beispiel, befreite ihn von manchen unbequemen Ansichten des
Liberalismus, wie zum Beispiel das Prinzip der Gleichheit der
Bürger gegen den Staat. Gustave Le Bon, stets auf das Risiko
der revolutionären Bewegung bedacht, erschuf die
mannigfaltigsten und bildsamsten Kriterien um die
Unterlegenheitsordnung der Menschheit einzustufen: die
rassistischen, zwischen Männer und Frauen, zwischen Gesunde
und Kranker, zwischen Sozialisten oder Naturvölker und
Gehorsame und moralisierte; vor allem, zwischen der Elite und
die Menschen, die zur Menge gehörten, indem, seines Erachtens,
sie ihre Rationalität verlieren (HOBSBAWM, 1988a). Nach Le
Bons Meinung, die Tätigkeiten der Menge wurde immer
zerstörender und gewaltsamer; allerdings, wurde die Heftigkeit
solcher Irrationalität durch den kollektiven Charakter (das
heisst, durch die rassistische Eigenart) unterworfen (LE BON,
1920, s. 37).
Die Interpretation der
sozial-Psychologie Le Bons erlaubte Vianna,
die Verknüpfung zwischen "soziale Unruhe" und "rassischen
Ursprung" festzusetzen, wodurch eine seiner Schlussfolgerungen
über die Streike im 10. Jahrzehnte, welche von den Anarchisten
durchgeführt wurden, war;
Diese höchste Aufgabe zu regieren ist
eine Pflicht, und ein Recht der Arianer (...) diese besitzen
die Apparate der Disziplin und der Erziehung, um diese
unförmlichen unterlegenen Mestizen zu kontrollieren. Diese
Elite hält ihr. dank ihres juristischen und sozialen
Verständnisses. unter den moralisierten arianischen Regeln
fest, um sie nach und nach an die Mentalität der weissen Rasse
heranzuziehen (...) (VIANNA. (1954) [1918], 1° Vol, S. 65).
Von Francis Galton leiht Vianna sich die eugenische Lehre, eine
von Galton erschaffene und entwickelte Ausdruckweise. Sowohl
der Meister wie der Nachfolger gehörten zu dem amerikanischen
Kontinent, und konnten besser die Vorteile der
Scheidung der Rassen durch die Farbe einschätzen, ein Begriff,
der zuerst von europäischen Theoretikern des Imperialismus
angewendet wurde. In Amerika, auf ähnlicher Weise, wurde das
Kriterium der Farbe für die Bestimmung der Klassen-Schichtung
nützlich, sowohl um das Sklaventum sowie auch die Ausrottung
des Indianers zu legitimieren.
Das Urteil des Supreme
Court erlaubte, in den Vereinigten Staaten,
im Jahre 1896, das Angebot der Güter und der öffentlichen
Dienstleistungen der Behörden mit einem diskriminierenden
Kriterium, trotz der verhüllenden Rhetorik separated
but equal. Ausserdem hatte die
Institutionalisierung der Poll
Taxes als
Folgerung, die praktische Ausschliessung des Negers in dem
Wahlprozess. Und die exogamische
Heirat wurde streng verurteilt, nicht nur aus psychologischen
Gründen, sondern auch wegen von den Weissen ausgeübte
gewaltige Unterdrückung gegen solche Beziehungen. (STYRON,
1985).
Durch die Inspiration von Galton,
gründet man in den USA, 1896, die "Eugenische Gesellschaft’’,
die das Ziel hatte, die asiatische Einwanderung zu verbieten.
Fast gleichzeitig wurde in São Paulo ein identischer Verein
gegründet, in dem Vianna sich
einschreiben liess. Durch diese Vereine übte die Elite unzahlreiche Massstäbe und
Unterdrückungen gegen die asiatische, afrikanische und
jüdische Einwanderung im Lande, aus (LUIZIETTO,1975).
Es waren die ersten Schritte Oliveira Viannas: brasilianische, europäische und amerikanische
Wissenschaftler anzuwählen, Einfluss auf die
öffentliche Meinung durch die Presse auszuüben, und durch
Teilnahme die Interessen der korporativen und politischen
Vereine verteidigen zu können.
Um besser die vielfältigen Kreuzläufe
zwischen diesem Verfasser und den rassistischen Theoretikern,
den politischen Gedanken in Brasilien und das Bild des
Deutscheinwanderers, müssen wir manche Aspekte in Hinsicht
seiner Werke als Sozialwissenschaftler, hervorheben.
In dem Buch Populates Meridionais (Südliche Ansiedler), welches im Jahre
1918 veröffentlicht wurde, unternahm Vianna
das Studium der Nationalitätsbildung vor, um mit
wissenschaftlicher Begründung die Verschiedenartigkeiten der
brasilianischen Bevölkerung zu demonstrieren.
Laut seiner eigenen Worte, sorgte er
sich nicht um die politischen, sondern um den Völkerkundlichen
und anthropologischen Faktoren. Ihm interessiert besonders der
Ursprung der brasilianischen ländlichen Aristokratie, um auf
ihre zivilisierende Mission in Brasilien hinzuweisen.
In dieser Richtung, erregt er die
Aufmerksamkeit auf die biologischen Charaktere des gaúchos, (sowie auch auf die Bandeirantes aus São Paulo [46]),
ein Beispiel für den abenteuerlichen und tapferen Geist; solch
erbliche Eigenarten ermöglichte ihnen, laut Vianna, die Führung des Landes.
Vergleicht man diese Behauptung mit der These von Gobineau, so lassen sich die tapferen,
grossen und blonden Franken finden, die das französische
Territorium eroberten. Wie diese, müssen auch die Weissen das
Schicksal Brasiliens beherrschen.
Bei der Beschreibung der gaúchos, ist es interessant zu bemerken, dass Vianna
keine Erwähnung über die Deutscheinwanderer macht; im
Gegensatz, des Arianischen Mythos, der immer betont wurde, als
ein vorbildliches Muster, der für die Bildung des nationalen Ethos beigetragen haben musste.
Was die gaúchos betrifft, behauptet er, dass
(...) Die weissen Eigenarten eine
führende Rolle spielten; und die arianischen Elemente (...)
waren reiner in Rio Grande do
Sul als in alle Gebiete
des Landes (...) alles weisst auf den gaucho hin (...) ein Mensch, der mit einer
besonderen Kraft begabt ist. ein gerechter, ein starker, ein
eugenischer Typus ist. (29 Vol. S. 333-5).
Und als er noch von der nördlichen
"Aristokratie" spricht, behauptet er, dass der Portugiese aus
Nord-Portugal, und nicht der Mestize aus dem Süden der echte
Kolonisator Brasiliens wurde, sowie auch die Arianer aus
anderen Länder Europas dazu beitrugen.
In Pernambuco
(...) ist der lokale Adel
zahlreich, aus Höfen Portugals. Castellas,
Frankreichs, Italiens und Deutschlands gekommen (lö Vol,
S. 33)
In diesem Werke ist seine einzige Erwähnung den Deutschbrasilianern gegenüber
anspruchslos, aber eindrucksvoll; er beschränkt sich auf
Vereinigungswesen der Deutschen in Santa Catarina und Paraná ab des 19. Jahrhunderts zu äussern;
nach Viannas Meinung, ist solche
Charakteristik ein Teil ihrer ursprünglich der politischen
Kultur, die sich von Solidarismus orientiert. [47]
Er Vergleicht diese Weltanschauung mit dem, typisch für die
Portugiesisch-Brasilianischen Individualismus, infolgedessen
ist die Demokratie in Brasilien unausführbar.
Dessen ungeachtet, könnten die
biologischen Eigenarten des Germanen eine in der arianischen
Verwandlung Prozesses in Brasilien eine wichtige Rolle
spielen, sowie auch in dem Entwicklungsprozess der
brasilianischen Volkswirtschaft, dank seiner Arbeitsamkeit.
Der Deutscheinwanderer wurde besser und
aufmerksamer von Vianna in den
30. Jahrzehnte bearbeitet, eine Konjunktur, die für den
Verfasser geeignet war, um das Verbleichen der brasilianischen
Bevölkerung zu verteidigen.
Bei der Einschätzung des Übergewichtes
der weissen Bevölkerung in Ost-Süd und Süd-Brasilien,
wiederholt er das Bedürfnis einer demographischen Politik,
welche die regionale Konzentration der Weissen verhindert.
Er benützt sich die ethnische Landkarte
Romeros, um die Vermischung des Volkes vorzuschlagen.
In einem Essay, O tipo brasileiro
e seus elementos
formadores (Das brasilianische Volkstum und die
Elemente seiner Zusammenstellung) genannt, (1991, [1931, s.
15, u. w.J) zeigt der Verfasser
die Vorteile der europäischen Einwanderung, trotz ihres
unordentlichen und spontanen Charakters. Er meint, dass der
Einzug der letzten Jahre eine wesentliche Anzahl von Deutschen
und Italiener (deren ethnische Adel unfraglich ist) sich über
alle anderen ethnische Einwanderungsgruppen überwiegt.
Über seine zuversichtliche Haltung,
lassen sich seinen Schriften selbst erklären: laut des
Verfassers, besonders aus den Deutschen ist die Verbesserung
der Rasse und der politischen Kultur zu erwarten, weil ihr
Volkstum sich der Abneigung zur niedrigen Arbeit
charakterisiert. Ausserdem zeigt dieses Volk starke Neigung
zur Herrschaft und zum Ausdehnungsdrang; bliebe er noch als
Bauer im Land, so würden ihre Kinder und Enkelkinder, schon in
Brasilien sich eingelebt, würden ganz spontan in die Städte
gewandert sein; da würden sie sich zu der Beschäftigung des
höher gehörenden Status verantwortlich, wie zum Beispiel,
Wissenschaftler, Geschäftsmänner, Politiker, Militärs und
Unternehmer, deren Aufgaben sich ihres Charakters besser
einpassen würden.
Dank der Einwanderung und der grossen
Fruchtbarkeit der Weisen, laut seiner Folgerung, hätte das
Land in wenigen Jahren eine völlig weisse Bevölkerung. Um
solche Ideen zu prüfen, vergleicht er den Prozentsatz des
natürlichen Bevölkerungswachstum unter Weissen, Neger,
Indianer, und Mestize, in dem zentesimale Unterschiede ihm
genügen, seine Hypothesen zu sichern, wie man in folgenden,
von ihm selbst gezeichneten Schaubild, beobachten kann:
Schaubild 3 -
Geburtenüberschuss nach ethnischen Gruppen •
|
Ethnische Gruppen |
|
Weisse Mulatten Indianer Neger |
|
Sterbefälle % |
|
2.83 2.75 3.70 5.38 |
|
Geburtenfälle % |
|
4.04 3.67 4.08 4.74 |
Es ist wohl erlässlich die Schwäche
seiner Folgerung gegen solche Daten hervorzuheben; ausser den
unbedeutenden Unterschiede zwischen Geburtenfallen unter den
genannten Gruppen und auch der Ungenauigkeit der
demographischen Statistik in Brasilien während der 20.
Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts, muss man noch aufmerksam
beobachten dass die Sterbefallen der Sklaven grösser als die
freie Bevölkerung waren, infolge der sozial und ökonomischen
Bedingungen dieser Gruppe, und nicht aus biologische oder klimatische Gründe, wie der
Verfasser voraussetzte.
In einer anderen Statistik, gebraucht er
die Demographie wieder.
um das Verbleichen
durch Vermischung aufzuweisen:
Schaubild 4 -
Zahlen der Heiraten gemäss der
Staatsangehörigkeit des Brautpaares - Rio Grande do Sul - 1918-
|
Staatsangehörigkeit |
1918 |
1920 |
|
Deutscher/
Deutsche |
22 |
29 |
|
Deutscher/ Brasilianerin |
63 |
91 |
|
Italiener/ Italienerin |
38 |
60 |
|
Italiener/ |
138 |
167 |
|
Brasilianerin |
|
|
|
Spanier/Spanierin |
4 |
7 |
|
Spanier/ Brasilianerin |
38 |
59 |
|
Portugiese/ Portugiesin |
9 |
12 |
|
Portugiese/ Brasilianerin |
108 |
107 |
|
Quelle: VIANNA, 1991, apud Relatorlo
da Repartição Estatistica do Rio Grande do Sul, 1919-1921 |
Diese Daten sind auch zweifelhaft:
zuerst, das Staatsangehörigkeits-Kriterium, in dem
statistischen Amt in Rio Grande do Sul erlaubt
man keine Genehmigung um eine nötigerweise
exogamische Heirat zu prüfen, denn
edle Kinder der Immigranten, die in Brasilien geboren sind,
sind als brasilianische Bürger berücksichtigt; deshalb, kann
man nicht durch solches Daten den echten Prozentanteil der
inter-ethnischen Ehen erkennen. Zweitens, die endogamen Ehen repräsentieren eine
noch sehr ausdrucksvolle Zahl, im Vergleich zu den sogenannten
Mischehen. Allerdings, trotz dieser "Missverständnisse", hat
diese Statistik einen gewissen Geltungseffekt; in dem
Massstab, als dass das einzige Element zum Austauschen der
Brasilianer ist, scheint der inter-ethnischen Prozess, für den
Leser guten Willens, dass der Erfolg der Vermischung schon
eine Realität ist. Laut Vianna
würde dieser Fortschritt noch bedeutender, wenn die Regierung
das Verbot der ethnischen Konzentration ernster nehmen würde.[48]
Nun noch eine andere Frage: Welch
Brasilianer dürfte sich nach Viannas
Meinung versmischen? In diesem selben Text, kritisiert der
Verfasser die Ehen zwischen Weisse und Neger, wegen der
psychologischen Charakteristik dieser zweiten ethnische
Gruppe:
Der Mulatte (...) 1st explosiv,
rebellisch, streitsüchtig und aggressiv: Ihm 1st die
Hauptschlägerei und Anarchie unserer Geschichte zu verdanken
(...) das passiert, weil die Unterwürfigkeit, welche eine
genetische Charakteristik des Negers ist. sich nicht
fortpflanzt in dem Mulatten. Im Gegenteil, er ist stolz,
lässig, überheblich und unverschämt. (1991, (1931), S. 49)
Aus diesen Gründen, das heisst, die
Unterwürfigkeitstendenz des Negers, die Lässigkeit des
Mulatten, und die Unfähigkeit des Indianers in der
zivilisierten Welt zu leben, (S. 46), dürften diese Schichten
nicht die Bürgerrechte bekommen. Aber auch nicht der
Einwanderer, weil ihm das patriotische Gefühl fehlt; nur
seinen Nachkommen, wenn sie dank der häufigen Kontakte mit der
Luso-Bevölkerung sich vermischen
und verbrasilianerten (S. 61-2).
Abgesehen von diesen Veränderungen, die sich in der
nordamerikanischen Gesellschaft spiegeln sollte, konnte
Brasilien nicht unter die zivilisierten Nationen vertreten
sein.
Ich beschreibe
die Überlegungen von Oliveira
Vianna nicht nur um über die Ähnlichkeit
seines Gedankens und des Romeros und Aranhas, unter anderen,
zu erklären, oder um die Ambivalenz der Intellektuellen gegen
die Deutscheinwanderung zu wiederholen. Aber auch um die
historiographischen Darstellungen zu kritisieren, die
behaupteten, dass die Versmischung-Utopie eine alternative
Ideologie gegen den USA Rassismus wurde, eine Haltung welche
sogar Eric Hobsbawm einmal verteilte (HOBAWM, 1988a). Nach
meiner Meinung, obgleich die Vermischungstheorie die Einverbildung der afrikanischen und
indianischen Kultur voraussetzte, wurde ihre Prämisse nichts
anderes als eine Abänderung, anderes gesagt, eine Verdünnung
des eugenischen Prinzips, in anderen Worten, eine Anpassung zu
den gegenwärtigen Umständen; letzten Endes vollendeten die
Mulatten schon eine ausdrucksvolle Zahi der brasilianischen
Gesellschaft; von denen viele, wie der berühmte Schriftsteller
Machado de Assis, der Präsident Nilo Peganha und selbst Oliveira Vianna einen sozial und intellektuell höheren Status
errang, und in übrigen, die weisse Bevölkerung, in Gegensatz
zu der USA, keinen Stolz auf die Heimat äusserte und sich
nicht im geistigen Sinn des Wortes Brasilianer fühlte.
Gegen solche unbequemen Umstände drängt
es sich auf, eine Unzahl von Ausschüssen, welche zu der
Perversion von modernem Bürgerrechtsbegriffs ergab; die Nation
hatte keine Pflicht den Individuum gegenüber, aber verlangte
von ihm sein Blut, seine Arbeit, sein Gehorsam. Er musste dem
Land dienen, damit in der Zukunft die Gleichheit unter den
Männern, welche durch die Verbesserung der Rasse garantiert
wäre, ermöglicht würde.
Als Feinde solcher Träume stellten sich,
unter anderen, besonders die Pangermanisten, die die Endogamie
und den Widerstand gegen die Assimilation verteidigten. Daraus
ergab es vielfältige kulturelle und politische Konflikte,
nicht wegen den ideologischen Prinzipien, in dem die beiden
Gruppen sich orientierten, sondern weil wenn man von Eugenik
spricht, die Anwesenheit einer zu niedrigen Klasse untrüglich
gegen anderen Arianischen wird,
trotzdem verbleicht,
aber der zu der höheren Klasse gehört.
Der Deutscheinwanderer und der zweite
Weltkrieg: aus dem
Traum zum Alpdruck
(...) Mos eu näo posso we sentir
negro nem vermelho!
De certo que essas
cores tamböm tecem mlnha roupa
arlequinai,
Mas eu näo me sinto
negro, mas eu näo me sinto
uermeüio.
Me sinto sö branco,
relumeando a carldade
e acolhimento,
Purlflcando na revotta
contra os brancos, as pätrias, as guerras, as preguigas, as ignoräncias!
Me sinto sö branco agora, sem ar neste ar livre
da Americal
Me sinto sö branco,
sö branco
em minha
alma crivada
de ragas. 34
Mario de Andrade,
1930
Ich muss zugeben, dass nach einer tiefen
Untersuchung über die Rassenfrage (...) ich gründlicherweise meine Ideen
erneuerte!...) der blonde Dolichozephale und seine
Überlegenheit interessierten mich nicht mehr.
Oliveira Vianna, 1938
In einer akademischen Auseinandersetzung
über die Unterschiede zwischen die Fiktion und die
Geschichtswissenschaft, erwähnte Jose A. M. Pessanha Heraclito,
für wen die Aporie Phantasie/Wissenschaft oder Wahrheit/Lüge
als die Aporie zwischen Traum und Nachtwache verkündigt werden
kann; der Traum entspricht des Täuschungszustandes, während
die Nachtwache die Vernunftzustandes. [49]
Als ob er Heraklit gefragt hätte,
stellte Pessanha fest: "Wie kann
er sicher sein, dass sein Anspruch auf aufgeklärte und
gesorgte Einheit nicht der tiefste und meist perverse Traum
ist?" (PESSANHA, in: RIEDEL, S. 283).
In diesem Kapitel, erwählte ich ein paar
literarische und wissenschaftliche Texte, die von einem
gewissen Bild, aus den Deutscheinwanderer in Zusammenhang mit
der brasilianischen Kultur handelten: in solchen Schriften
wurden die Deutscheinwanderer als ein einziger und
harmonischer Körper gesehen, der immer seine ursprüngliche
Identität fortpflanzte.
Bei der Analyse, ist es zu folgern, dass
diese Autoren streng mit dem Zeitgeist (oder wie die
französischen Geschichtswissenschaftler darstellten, L’imaginaire collectif) ihrer Epoche verbunden waren,
besonders was die deutsche Kultur betrifft. Da erfindet man
ein paar Leitmotive, welche, sei es in einer
wissenschaftlichen Sprache, sei es in einer literarischen
Sprache bekleidet, als Wahrheit übernommen wurden, nicht weil
sie echt waren, sondern weil sie fortlaufend wiederholt
wurden.
Im Allgemeinen, kann man behaupten, dass
in verschiedenen Umständen, das Bild der Deutscheinwanderer
als "das Fremde", aus dem engen Sinne des Wortes,
repräsentiert wurde. Als sie als "Deutsche", "Germanen",
"Alamannen" genannt wurden, hatten diese Autoren vor, nicht
nur ihre historische Herkunft zu erwähnen, sondern auch ihnen
als "was ganz anderes" der brasilianischen Gesellschaft
darzulegen. Deshalb, unabhängig von ihrer Feindseligkeit oder
ihrer Liebe zu Brasilien, wurden Milkau, Lentz, Elza und Annelise als Wurzellose Individuen
beschrieben, die unfähig zur Integrierung in ihrer neuen
Sozial-Umwelt waren, weil sie von Brasilien erregend entfernt
wurden. Sie waren übermässig ihrer Heimat zugetan,
infolgedessen durch das Lesen, dem Gebrauch der deutschen
Sprache, die Erhaltung der Sitten ihrer Vorfahren und die
Endogamie ihre Vergangenheit immer vergegenwärtigt wurde.
Die Last der Geschichte in dem Alltag
der Deutscheinwanderer wurde auch von einem diachronischen
Ausschnitt beschrieben, mit welchem die Autoren ihre
Geschichte rekonstruierten. Sie verstanden den
Deutscheinwanderer als ein Synonym des Germanen und
verknüpften sie mit der Geschichte ihrer Ahnen, als ob sie
"eine prä-etablierte Übereinstimmung mit ihrer ur-
historischen Vergangenheit geschaffen hätten" - wie schon
Georges Dumezil einmal behauptete
(1959).
Diese zu weitläufig kulturelle Fortdauer
ist an den Immigranten hauptsächlich von Oliveira Vianna und Sylvio Romero
verwendet; in dieser
Richtung, sowie der Deutsche mit seinen erschaffenden Mythen
verbunden ist, würde der Deutschbrasilianer immer mit seinem
Heimatland verbunden sein, indem die Genauigkeit ihm als aus
einem militärischen Geistträger zu begreifen, in einer
gewissen Weise, als eine Vortäuschung Bismarcks hinstellt -
wie, zum Beispiel, in den Roman-Figuren Elza und Lentz.
Wir dürfen es nicht geringschätzen, dass
das Vorbild des Deutschbrasilianer fast immer als das
Gegenteil des Brasilianers bearbeitet wurde, dessen kollektive
Identität, nach ihrer Meinung, noch zu konstruieren sein
würde. Es interessierten also deswegen die Eigenarten beider
Gruppen zu durchstöbern, um in ihrer Verschiedenheit die
Wesenheit ihres Charakters zu untersuchen, zu finden. Und,
unabhängig von den vorausgesetzten Vermischungen, wünschten
sie, dass die luso-brasilianische
Kultur überwiegen sollte.
Allerdings, die von ihnen vorgestellte Zukunft
wurde nicht in harmonischer Weise verwirklicht. Im Zweiten
Weltkrieg, wurde der Mythos der Deutschen Gefahr und das
Vorbild des Deutscheinwanderers als ein Vertreter des Reiches,
von den Ereignissen "bestätigt”.
Graga Aranha und Sylvio Romero starben vor dieser Konjunktur, aber ihre
"Hinweise” wurden im Namen der anti-germanistischen Politik
umformuliert.
Mario de Andrade, in
der neuen Auflage des Buches Amar
verbo Intransitivo
in 1944, fügte eine
Satz hinzu, der seine Entrüstung gegen den Krieg symbolisieren
sollte: "Bárbaro, tedesco,
infra-terno alemão infraterno)[50]
(cf. LOPEZ, s. 37, in: ANDRADE,
S. 60).
Erico Verissimo,
von dem Nationalsozialismus im Schreck erstarrt schreibt den
Roman Saga,
wo er Vasco in 1940 zu dem spanischen Zivil-Krieg, auf Seiten
der Antifrankisten die
Internationale-Brigade durchführt, was auch seinen Widerwillen
gegen die Rechts-Tendenz der brasilianischen Regierung
symbolisieren wollte. (VERISSIMO, 1966a, S. 15).
Und Vianna,
einer der Theoretiker des Neuen Staates (Estado
Novo), musste seine Analyse über den
Deutscheinwanderer umorientieren; so wiederholt er, dass die
Immigranten, zu der Arbeiterklasse gehörten, und unter der
Bedingung, mussten sie sich zwanghaft in die brasilianischen
Sitten und Regeln integrieren (VIANNA. 1991, S. 383).
Aber während die Brasilianer schrieben,
lasen die Deutscheinwanderer und ihre Nachkommen, die nicht
von den Wirkungen des Mythos der Deutschen Gefahr geschädigt
wurden, noch weiter die Nachrichten und literarischen Texte
aus einer Welt, die als ihre Welt verstanden wurde, nicht weil
sie zu ihnen gehörte, aber weil solche "Wahrheiten"
unaufhörlich wiederholt wurden. Ich spreche hier von den
Zeitungen, Kalendern und Zeitschriften Deutscher Sprache die
in Süden Brasiliens erschienen, ein Thema welches, das Ziel
der nächsten Kapitel dieser Dissertation werden.
III
ALTE UND NEUE
NATIONALISTEN: HEIMAT UND VATERLAND
Seit dem Ursprung der deutschen
Einwanderung, bemerkt man die Gründung verschiedener
Druckschriften in deutscher Sprache, die sich durch alle
Gegenden der Kolonisation, während einem längeren
Zeitabschnitt erstreckt, der nur durch den Eintritt des
zweiten Weltkrieges unterbrochen wurde.
Diese Literatur wurde mindestens zu den
siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts hergestellt, von Autoren
die über einen ganz regionalen, begrenzten Umkreis
berichteten, dessen Thema nicht die Grenzen ihrer eigenen
lokalen Gemeinde überschritten. Es waren nur wenige
Herausgaben, die je nach Bezirk sich unterschieden, dass diese
im Umlauf kamen, dank man mehr den allgemeinen Lesern als dem
Willen der Autoren, durch den Beziehungen zwischen Freunden
und Verwandten anderer Gemeinden.
Es handelte sich um eine Textsammlung
dessen Charakter die Freude zur Sache zeigte, deren Berichte
die Begünstigung der Vergnügungs- oder religiöser
Gesellschaften hatte, oder Nachrichten mit Informationen an
die Kolonisten brachte. Kuder, (1937), meinte, es handelte
sich um eine Söldnerliteratur von unbedeutender Qualität, die
von einem kleinen Handwerkergeschäft hergestellt wurde.
Man entnimmt ihr einen gewissen
städtischen Patriotismus, der sich von der feierlichen lokalen
Geschichte näherte. Die Einwanderung wurde, in den Erzählungen
die über das Leben in der alten Heimat, die Schwierigkeiten
der Reisen, der Ankunft und dem Anfang der Niederlassung auf hiesigen
Boden, hochgeschätzt und idealisiert; die Schriftsteller waren
die Kinder und Enkel der Einwanderer, welche die Berichte und
Erinnerungen ihrer Vorfahren niederschrieben, welche als
Eroberer dieser neuen Welt angesehen wurden, Anfänger die über
die Vergangenheit eine ungefragte Autorität ausüben. Wenn an
die Benennung der Gegend wohin sie immigrierten, von ihnen
Urwald genannt, beachtet, kann man sie als relativen Erfolg
bezeichnen, denn da gab es wenigstens keine Lehnsherrschaften, keine
hohen Steuern, keinen starken Winter. Einerseits hatten diese
Erzählungen einen psychologischen Entfernungseffekt in
Hinsicht auf die Vergangenheit, weil sie als Geschichten an
die man sich erinnern soll, organisiert waren.
Ausser diesen Lebensbeschreibungen und
Erzählungen über den Heldenmut der Gründer, bemerkt man noch
Liebes, Verbrechens, Abenteuergeschichten und Anekdoten.
Zerstreuungen, Ausflüchte, Erfindungsreisen, Vergleiche
zwischen der alten und der neuen Welt, bildeten wahrlich
wichtige kulturelle Kunsterzeugnisse in der täglichen
Ausarbeitung ihrer Leser, hauptsächlich wenn die gründliche
Umstellung beachtet, welche die Einwanderung erfordert. Zu
diesen rechne man noch solche die über religiöse
Streitigkeiten, wie zum Beispiel die der Protestanten wider
Katholiken, der Frommen gegen die weniger Religiösen oder
selbst der Ungläubigen.
Die Schriftsteller dieser Berichte
stammten aus der eigenen Gemeinde: sie führten zur gleichen
Zeit die Arbeit der Buchhändler, Herausgeber, Redakteure aus,
und so wurden sie, dank dieser Beschäftigungen durch
selbst-Didaktik Lehrer und Pfarrer, die manchmal ausgewählt
wurden, weil sie, zur körperlichen Arbeit sich nicht eigneten,
oder weil sie sich von den anderen als “Gelehrte” ausnahmen.
Die meisten arbeiteten ausser dem Bereich der Landwirtschaft;
sie waren Telegraphisten, Landkartenzeichner/ Bäcker,
Kaufmänner oder Tischler, so zum Beispiel war der Johann Georg
Maurer (Quacksalber) und der Johan Georg
Klein amtierte als Pfarrer; beide Namen wurden bekannt,
besonders weil sie die Bewegung der Gläubigen an das Kommen
Christi führten, die Mucker (AMADO, 1978). Der reisende
Handelsmann, weithin bekannt, wurde von dem Einwanderer
"Musterreiter’[51]
genannt, und wurde im Laufe der Zeit, nicht nur ein
Warenverkäufer, sondern auch der Überbringer der Nachrichten,
Ratschläge und Informationen.
Die Informationsniederschriften und
Berichterstattungen über das Werden und der Entwicklung der
Kolonien, übertreffen die Anderen, weil sie objektiv ausser
der praktischen Anleitung, noch die Propaganda der
Kolonisation übernehmen. Was sich klar in der Zeitung
"Kolonie", aus Joinville, heraushebt, durch Koordinierung des
Ottokar Dörffel, eines
Einwanderers von der Vormärz, Buchhalter des Kolonievorstandes
und der erste Bürgermeister der Stadt.1 Er
beschäftigte sich auch mit der Orientierung der neuen
Einwanderer, seine Schriften wurden nach Hamburg gesandt, um
zukünftige Auswanderer zu beeinflussen, sie wurden als
Wegweiser für den zukünftigen Kolonisten angesehen. (SEYFERTH,
1988, S. 11)
Nach der Meinung Mercedes Kothe (1991, S. 20)
spielten viele Personen, die zum Sozialismus neigten und sich
wegen der Unterdrückung des Jahres 1848 antäuschten, eine
besondere Rolle in der Herstellung der Druckschriften dieser
ersten Phase. Sie sahen die Kolonien als Utopien die sich
verwirklichten in Freiheit und Fortschritt.
Diesen Optimismus teilten aber nicht
einige Männer, wie zum Beispiel, Sellin, einer der wenigen
Schriftsteller der südlichen Gegend, welcher zur gleichen
Zeit, die Behandlung von Seiten der brasilianischen Regierung
an seine Landsleute, durch die Presse kritisierte.[52]
Solche Veröffentlichungen waren aber
sehr geteilt und begrenzt in ihrer weiteren
politisch-überzeugenden Organisation, was sich wegen der
geographischen Isolierung der Kolonien erklären lässt, die
Unkenntnis der portugiesischen Sprache und der damaligen
prekäre Kommunikationsmöglichkeiten.
Der Name der Druckschriften dieser Phase
offenbaren ihren regionalistischen Charakter und ihre noch
innere Verbindung mit der Kultur ihres Ursprunges, wie man an
den Schaubild Nr. 5 sehen kann:
|
a. Zeitungen |
|
|
|
|
Zeitungstitel |
Erscheinungsort |
Erscheinungsweise |
Erscheinungs- |
|
|
|
wöchentlich |
Zeitabschnitt |
|
Kolonie |
Joinville |
1 xbisl887 1887-39-2 x |
1862-1939 |
|
Der Kolonist |
Porto Alegre |
2 x |
1852-53 |
|
Der Einwanderer |
Porto Alegre |
2 x |
1854-61 |
|
Deutsche Zeitung |
Porto Alegre |
6 x |
1905-42 |
|
Der Bote von São Leopoldo |
São Leopoldo |
3 x |
1867-75 |
|
b. Kalender Titel |
Erscheinungsort |
Herausgeber |
Erscheinungsjahr |
|
Deutscher Kalender |
Porto Alegre |
Fischer |
1855 e 56 |
|
Der neue hinkende Teufel |
Porto Alegre |
T. Jäger |
1856 |
|
Deutscher Volkskalender für Provinz
S. Pedro |
Porto Alegre |
O. Stieher |
1861 |
|
Deutschen-Kolonie Kalender |
São Leopoldo |
T. Brügern |
1868 |
|
Quelle; KUDER. 1937. |
S. 9.4-37 usw. |
|
|
|
|
Diese zerstreute und verschiedenartige
Literatur hindert uns eine verbindende Analyse zu
verwirklichen, da sie sich der Bestrebungen jedes
Schriftstellers unterwarf, ihr gemeinsamer Nenner war der
Gebrauch der deutschen Sprache, der regionale Vorzug und die
Gleichgültigkeit zu
Brasilien -
bemerkbar, wenn man sich auf es bezog, als Regierung - gut
oder schlecht, je nach Entscheidungen die sich auf die
Immigranten erstreckten.
Die ersten Zeitschriften die ein grösseres Publikum erreichten
und die über Vollkommenheit der deutschsprachigen Bevölkerung
überzogen, stammen aus dem Jahre 1870. Ihnen entnehmen wir,
diejenigen, die durch Karl von Koseritz
und Wilhelm Rotermunds Unternehmen veröffentlicht wurden, weil
sie die meist verkauften waren und die, besonders zu Anfang,
eine Reihe von Stellungen vereinigten die gegenseitig
wetteiferten.
Das Entstehen der Zeitungen "Deutsche
Zeitung" und "Deutsche Post" und die Kalender "Koseritz Volkskalender" und "Kalender
für die Deutschen in Brasilien" beziehungsweise unter der
Leitung des ersteren und des zweiten Verfassers,
Druckschriften die dem deutschbrasilianischen Publikum
zugedacht waren, ergab sich nicht ungezwungener Weise. In
diesem Zeitabschnitt kamen wieder neue Immigrantenscharen nach
Brasilien, die nun von einer kürzlich- vereinigten Nation,
welche über Frankreich siegte, herstammen. Die Zunahme der
Bevölkerung in Süden Brasiliens, auf Grund der Immigration und
des hohen Prozentsatzes der Fruchtbarkeit, die sich unter
diesen Schichten bemerkbar machte, gleichwie die Diskussionen
in Hinsicht auf das Sklaventum, das Ersetzen derer Arbeit
durch die Arbeitskraft der Europäer, dazu kam noch, die als
Vorbild geltende Kolonisation des Südens, welches nachgeahmt
werden konnte oder nicht; diese Faktoren trugen zu dem Beginn
der regionalen Absonderung, zu mindestens in den wichtigsten
Zentren derer Staaten; bei Erwähnungswert ist auch der
Einfluss der Evangelischen Protestantischen Gemeinde der
Deutschen aus Nord und Süd- Amerika, welche, ab 1864 eine
Missionarische-Aktivität unter den Deutschen beginnt, in dem
sie ausgebildete Pfarrer nach Brasilien sendet, wodurch sich
eine Verminderung der Selbständigkeit und Zerstreuung der
lokalen Pfarrkirchen, wie auch den Verlust der Sozialen
Wichtigkeit der Laienprediger.
Trotzdem, sind diese mit allgemeinem Charakter
gezeichneten Bestrebungen nicht die Einzigen die diese
Ausbreitung des literarischen Universums der deutschen Sprache
erklären, denn dieser besitzt seine eigene interne Dynamik,
welche seine Selbstständigkeit bis zu einem gewissen Punkt mit
diesen Begebenheiten erhält.
Erstens, der sozial-ökonomische Aufstieg
der Deutschbrasilianer wurde von neuen städtischen
Ortschaften' begleitet, die sich emporhoben, wodurch die
Aufforderung einer immer grösseren Zahl der Informationen über
ihre Geschäfte erfordert wurde; zweitens, womöglich der
Wichtigste, die Niederschriften von Koseritz
und Rotermund, werden von nun an, die ersten Druckschriften
aller Personen deutscher Herkunft bilden, wegen der
vielfältigen Thematik die sie bringen, andernfalls, wegen der
Agenten die sie unterstützen: die Liberale Partei und die
Evangelische Kirche, beziehungsweise.
Wie schon bestätigt, das Erscheinen der
Druckschriften, die für ein vergrössertes Abnehmerpublikum
bestimmt war, stammt von der 70er. Jahre des 19. Jahrhunderts,
zufällig oder nicht, zur selben Zeit der Vereinigung
Deutschlands. Wie dort, mussten auch hier, die
Deutschbrasilianer ihre internen Auseinandersetzungen
besiegen, um in Gleichheit übereinzustimmen, welche ihnen die
Verteidigung ihrer kollektiven Interessen erlauben würde.
Diese Änderung erklärt sich auch, wegen der "Aufklärung",
ebenso wie diese kulturelle Bewegung in Deutschland anerkannt
wurde. Im Gegensatz zu Frankreich, ihre Vertreter stammten aus
den Mittel und Volksschichten, und erwarteten, dass durch
Erziehung und Aufklärung, die interne Angst zur Religion und
zu Lehnsherrschaft besiegt würde.
Laut Kocka, unter
Aufklärung kann man verstehen:
Eine Bewegung, die auf
die umfassende Befreiung der Menschen aus herkömmlichen
Zwängen tradierten Vorurteil und nicht legitimierter
Herrschaft zielte, durch Bildung, öffentliche Kritik und freie
Diskussion Unwissenheit. Aberglauben und Intoleranz ausräumen
wollte und den mündigen Gebrauch der Vernunft als regulativ
aller privaten und öffentlichen Verhältnisse zur Wirkung
bringen wollte. (1989. S. 140)
Der erste ausdrucksvollste
deutschbrasilianischer Kalender, wie, auch die dauerhafteste
Zeitung in deutscher Sprache, sind von einem Immigranten, der
von der intellektuellen Geschichte seines Vaterlandes tief
beindruckt wurde,- Karl von
Koseritz, Sohn eines Gliedes des kleineren
deutschen Adels, wurde in Dessau, im Jahre 1830 geboren. Er
kam nach Brasilien im Jahre 1851, um im Söldner-Heer des
Kaiserlichen Krieges gegen den Diktator Rosas, von Argentinien
teilzunehmen. Verlies aber sehr bald die Legion, um sich als
Zivil in Pelotas, im Staate Rio Grande do Sul niederzulassen,
wo er sofort seine Laufbahn als Privatlehrer, Buchhalter und
Journalist begann. Er heiratete eine Brasilianerin, Tochter
eines Farmbesitzers (fazendeiro) des Südens, verzog dann in die
Hauptstadt der Provinz, wo er weiterhin als Journalist,
Geschäftsmann und Politiker tätig war; im Jahre 1883 wurde er
als Abgeordneter der Liberalen Partei gewählt, wo er bis 1889
tätig war.
Seine immer treue Gewohnheit des Lesens,
ertrug ihm eine enge Verbindung mit der hohen Kultur seines
Vaterlandes, aber auch mit den intellektuellen Bewegungen
Brasiliens. Im gemeinsamen Sinn mit Tobias Barreto, Sylvio Romero
und andere, stellte er sich
kritisch gegen die überragende Einwirkung der französischen
Kultur unter den brasilianischen Intellektuellen um, und wie
es die Konjunktur verlangte, neigte er auch dazu über die
Nation, das Bürgerrecht
und den
Fortschritt zu denken.
Als ein Bewunderer Feuerbachs und Haeckels, Atheist und ein Verteidiger der Entwickelungs-Theorie,
schrieb er verschiedene Bücher,
unter den Ersten schon einige, die sich der Lehre
des einfachen Leute widmeten, wie eine Zusammenfassung der
Universalgeschichte und der Geozentrismus und
über die brasilianischen Indianer.
Er gründete in Porto Alegre die “Gesellschaft Feuerbach“, unterhielt
Korrespondenz mit verschiedenen Gelehrten und schrieb auch für
mehrere brasilianische Zeitungen. Später wurden noch einige
seiner von romantischer Eingebung angefertigten Romane,
herausgegeben, durch welche er überaus populär unter den
Immigranten wurde. {CARNEIRO, 1959).
Koseritz Eintritt in das öffentliche Leben ergab
sich durch die Unterstützung der Liberalen von Rio Grande do Sul und der deutschbrasilianischen Wähler, dessen
Interessen er vertrat; tat es, nicht aber, unter einem
ethnischen Prinzip, sondern aus gesetzlichen und politischen
Gründen. Endlich, laut seines Urteils, bildete diese Gruppe so
ungefähr den sechsten Teil der Bevölkerung von Rio Grande,
welche fast die Hälfte des Steuers der Provinz einbrachte.
Trotz ihrer ökonomischen Wichtigkeit, genossen sie nicht die
Vollkommenheit ihrer Bürgerrechte. Gemäss der Verfassung des
Kaiserreiches, den eingebürgerten Ausländern nicht-katholisch
verhinderte man ihnen das Recht gewählt zu werden als
Abgeordnete oder Senatoren, wie auch wichtige Stellungen der
offiziellen Ämter zu bekleiden. [53] Um diese Anordnungen zu hemmen,
versucht er auf den Politiker Silveira Martins einzuwirken,
welcher sich für die Wählbarkeit der Protestanten einsetzt,
was sich im Jahre 1881 verwirklicht durch das Saraiva-Gesetz, welches die Zulassung
Koseritz und anderen
Deutschbrasilianern zur institutionalisierten Politik
erlaubte.
Als Abgeordneter, bewirbt er sich noch
um die Institutionalisierung
der
bürgerlichen Trauung, die Aufhebung der Staatlichen Religion, den
Strassenbau welcher den Handel der landwirtschaftlichen
Produkte zu allen Gegenden des Staates erleichtern würde und
die Verminderung des Steuers, der auf die Kolonisten haftet.
Ausser den unmittelbaren Interessen seiner Wähler, verteidigt
Koseritz die Abschaffung des
Sklaventums und die öffentlichen' Erziehung. Was sich auf die
Besiedlungs-Politik des Gebietes bezieht, verteidigt er die
Immigration zur Kolonisierung und nicht nur als Mittel der
Arbeitskraft für die Kaffeepflanzungen, so widersetzt er sich
den Interessen der Lehnsherrschaften. Im Namen dieser Haltung
verurteilt er die asiatische Immigration, ausser dass sie eine
zurückgebliebene Bevölkerung bildet, würde sie noch die
Fortsetzung des Systems darstellen.
Die Kaffee-Barone wollen mit ihrem
Nichtstun erleben fortfahren und strengen sich deshalb an neue
Sklaven zu suchen, jetzt von gelber Farbe, um die alten Neger
zu ersetzen, (apud CARNEIRO, 1959,
S. 33)
Oder auf einer milderen Form, bezieht er
sich auf die Immigration als ein gutes Geschäft, selbst an die
Elite, an die er sich wendet,
Lasset es zu, dass eure Sklaven
freigelassen werden, erlaubt und teilt eure riesengrossen
Farmen, rufet Immigranten und kolonisiert. Diese Probleme die
Euch wie ein böser Traum scheint,
so ist der für die
Sklavenarbeit, die Änderung der grossen Besitzungen und die
Emigration schon erledigt, (idem, S. 41-2)
Die Teilnahme in der Politik des Staates
widerspiegelt sich auch in seinen Betrachtungen über die
nationale Wirtschaft, wo er die “Dogma” der Politischen
Ökonomie, “diese Wissenschaft die fast eine Religion ist”,
schlussfolgernd, wie Smith, Say, Mill und
Wirth, dass der freie Handel und die Industrie die einzigen
Möglichkeiten sind, die den Fortschritt gewähren (KOSERITZ, 1870).
In seinen Betrachtungen über Brasilien,
gebraucht er den politischen Fortschritt Deutschlands als ein
Vorbild einer zivilisierten Nation, so zog er die Achtung der gelehrten
Immigranten oder die sich den Fortschritt des Landes der
Vorfahren interessierten. Diese gedachten jene Zeit als das
“Zeitalter Koseritz”, ein
Abschnitt in dem' die Ergänzung dieser Schichten zur
brasilianischen Nation beziehungsweise der liberalen
Grundlehre bedacht wurde, oder, aller, durch die
Institutionalisierung der politischen Debatte über private
Interessen, wo die Oberherrschaft geengt werden sollte, im
Namen des “vernunftgemäss richtig” im Gerecht verwandelt.
Die Bestrebungen Koseritz
enden mit dem Ausrufen der Republik. Als Verteidiger der
parlamentarischen Monarchie, wurde er verfolgt und von seinen
Gegnern festgenommen im Jahre 1889, welches auch das Jahr
seines Todes ist. Aber bis dahin, brachte Koseritz seinem Leser und Wähler eine
Reihe Kenntnisse und Meinungen über Erneuerungen und
Anordnungen des materiellen Lebens und des Sieges der
Wissenschaft über die Religion. Ideen gegen welche sich ein
anderer Denker streng widersetzte.
Rotermund kommt nicht aus politischen
Gründen, noch ökonomischen, beabsichtigte auch nicht,
ursprünglich, sich in diesem Lande Bestimmtheit festzusetzen.
Seiner Meinung nach, ist eine Vereinigung der
Deutschbrasilianer dringend, aber nicht aus denselben Gründen
die Koseritz angibt. Rotermund
war auch Herausgeber und Journalist, aber im Gegensatz zu
seinem Gegner, regte er, den Einfluss des Deutschen Wesens
unter den Immigranten in Brasilien.
Er wurde in Hannover im
Jahre 1843, als Sohn einer Bauernfamilie
geboren; da er
sich keiner
guten Gesundheit erfreuen durfte, bildete er sich als Lehrer aus, um
später sich der Theologie-Studien, auf der Universität zu
Göttingen, zu widmen.
Im Jahre 1874 wird er nach Brasilien
ausgesandt, einer Einladung des Friedrich Fabris, Präsident
des “Komitees der Deutschen Protestanten in Süden Brasiliens”,
Direktor der' Kolonisationsgesellschaft Hamburgs und Inspektor
der Evangelischen Missionen.
Die missionarische Arbeit an die
deutschsprechenden Evangelischen im Ausland entwickelte sich
in Europa schon seit anfangs der jenseitigen Migrationen
verschiedener Kontinente, zuerst neigte sich ihre Achtung,
hauptsächlich den Vereinigten Staaten. In Brasilien wird die
Ausbreitung der Mission erst deutlich ab 1860, dank der "Rheinische
Missionsgesellschaft" und die "Basler-Mission. Während der
ersten 40 Jahre der Immigration kamen nur 18 Pastoren für ganz
Brasilien, dann im Süden Brasiliens eingesetzt, von den beiden
schon genannten Missionsgesellschaften angeregt.
Friedrich Fabri war ein Theologe der zum
missionarischen Charakter der Kirche neigte, Gründer und
Lehrer spezialisierter Schulen zur Ausbildung der Pfarrer fürs
Ausland, und ein Verteidiger der Bewahrung des Deutschtums als
die Vervollständigung seiner Lehre. Sohn des Carl Fabri,
Direktor der Kolonisationsgesellschaft Hamburgs, lernte
Friedrich schon sehr früh, die Wichtigkeit der Bewahrung des
Deutschtums, als eine indirekte Strategie des Imperialismus,
oder, andererseits, nicht ausschliesslich, als eine
wirkungsvolle Art um mitzuwirken an der Erhaltung der
protestantischen Religion trotz der Hegemonie der Katholischen
Kirche in den Latein-Amerikanischen Länder.
Rotermund folgte der Einladung Fabris
und kam nach Brasilien um Borchard zu ersetzen, Pfarrer der,
ohne grossen Erfolg, versucht hatte, die Unabhängigkeit der
Evangelischen Gemeinden zu verringern und die erste
Lutherische Synode zu gründen.
Als Rotermund in Rio Grande do Sui
ankam, empfängt ihn ein ungünstiges Klima für seinen
Unternehmen; laut Prien:
Das Panorama wurde bestimmt vom
Mistrauen der ihre bisherige Freiheit nicht aufgeben wollend,
und von den Pseudo-Pfarren verhetzten Gemeinden, sowie
denjenigen Pfarren, die ihre Bedenken und Vorurteile gegen
Preusse und den preussische EOK den höheren Zwecken des
kirchlichen Zusammenschlusses nicht opfern wollten (...) Hinzu
kam katholischerseits die
aggressive Abgrenzung durch die Jesuiten, die durch die
Ausweisung aus dem Deutschen Reich nach Ausbruch des
Kulturkampfes 1872 Zuzug erhalten hatten, der den
Ultramontanen Geist in Rio Grande do Sul verstärkte.
Das Bild wurde vervollständigt durch den publizistischen
Kulturkampf, den Koseritz gegen
die Synode, die evangelischen Geistlichen und die Jesuiten
führte. Nicht zu vergessen ist in diesem Zusammenhang die
schon erwähnte 1874 niederschlagende Mucker Bewegung. Da der
brasilianische Süden mit charismatisch enthusiastischen
Bewegungen wenig vertraut war. konnte die Mucker Kräfte
"böswillig gegen die Evangelischen ausgeschlachtet werden als
eine typisch protestantische Erscheinung (PRIEN, 1989, S. 133)
Um dieser Situation gerecht zu werden,
versuchte Rotermund, sich seiner Gläubigen, mit einer eifrigen
Seelsorge beizustehen, und sie, zu einer Religiosität durch
Übung des Lesens, anzuspornen.
Durch Rotermund wurde der "Kalender für
die Deutschen in Brasilien", im Jahre 1881 herausgegeben, und
später die Zeitung "Deutsche Post". Als Herausgeber und
Buchhändler setzte er sich gegen den Atheismus der Texte Koseritz vor; von welchem er folgenden
Kommentar machte:
Das grösste Hindernis unserer
evangelischen, kirchlichen Arbeit war Herr Karl von Koseritz, durch seiner "Deutsche
Zeitung" aus Porto Alegre,
in welcher er auf
oberflächlichen Materialismus alles was sich zum Glauben an
Gott und das Zukünftige Leben bezog, kritisierte und
geringschätzig behandelte. Selbst mich liess er nicht aus in
dem er mich als den Pastor der zum Journalisten wurde"...
taxierte. In dem konnte er sich der Unterstützung vieler
Brummers erfreuen. welche in den Kolonien als Lehrer und
Handwerker weilten, wo sie, wie es irgendwie möglich war.
Widerstand zur Arbeit der lokalen Pfarrer, boten. Ausserdem,
nützte Koseritz seinen Kalender
um den Atheismus zu verbreiten (...) So war es offenbar, dass
unsere Seelsorgearbeit sich nicht ausbreiten und in aller
Stärke wachsen konnte, derweil wir Ja auch nicht die gleichen
Mittel und Rückhalt hatten, (apud
Rotermund, G., 1986, S. 198-9).
Rotermund wirkte noch als Lehrer und
Ratgeber, hatte, um die Verbreitung seiner Ideen, die
Unterstützung anderer Pfarrer die kürzlich aus Deutschland
gekommen waren. Er gründete die Riograndenser Synode, schon um
1886, von welcher er bis 1919 Vorgesetzter war. In dieser
Bedingung war er einer der wichtigsten Verteidiger der
Evangelischen, was auch, seiner Meinung nach, die Stärkung des
Deutschtums bedeutete. Es handelte sich nicht um die
Organisation dieses Segmentes zur Verteidigung ihrer
politischen Interessen, aber um sie treu an ihrer originalen
Kultur zu erhalten, von ihm aus, als ein heiliger Ursprung
angesehen. Die säkulare Welt würde nur die Achtung verdienen,
wenn sie diesen Werten drohen würde. Deshalb, empfahl
Rotermund die Einigkeit dieser Gemeinde, welche sich nicht nur
von Menschen anderer ethnischen Herkunft, wie auch von
deutschen Katholiken und Ungläubigen fernhalten sollte;
verurteilte Mischehen, den der Internationalismus welcher von
dem Katholizismus in kurzer Zeit herausgefordert würde, zur
Assimilation der brasilianischen Gesellschaft führen würde.
Verkündigte die Erhaltung der deutschen Sprache und die
Endogamie denn seiner Meinung nach,
Die Erhaltung des Deutschtums liegt im
Blut und in der Seele der Evangelischen Kirche, welche mit
Recht, als Frucht der Vereinigung des Evangeliums und des
Deutschtums angesehen wurde (...) Wer das Denken und Fühlen
auf evangelischer Axt verlässt, ist kein Deutscher mehr, und
auch umgekehrt, wer die deutsche Sprache und Gemütsart
verweigert, wird auch für unsere Kirche verloren sein, (apud DREHER 1984. S.93-4).
Unter dieser Urteilsrichtung, regte er,
die Gründung und Erhaltung der Schulen in deutscher Sprache
an, mit dem Vorbehalt der deutschen Geschichte, denn,
(...) es ist sicher, dass unsere Kinder
in den Schulen, die Sprache und Geschichte des Landes
kennenlernen müssen, aber zuvor müssen sie die Sprache und
Geschichte der eigenen Sippe kennen (idem, S. 91)
Rotermund sandte noch Mitglieder der
Gemeinden denen er diente, um in Deutschland Theologie zu
studieren und hielt enge Beziehungen mit säkularen und
religiösen Organisationen seines Vaterlandes. Zur Zeit des
ersten Weltkrieges versucht und erreicht er die
einschränkenden Massnahmen zum Gebrauch der deutschen Sprache
zu mildern, mit interessantem Argument.
Wenn die freie religiöse Bekanntmachung durch die Verfassung
gewährt wurde und wenn Luthers Sprache, wie das Latein, eine
heilige Zuflucht der Liturgie war, so dürften die
Gottesdienste nicht in portugiesischer Sprache gehalten
werden. (LUEBKE, 1987, S. 81 u. w.)
Rotermund starb mit 70 Jahren, wurde
berühmt durch die Lobreden der Evangelischen und der
Deutschbrasilianer, die ihn als Mentor ihrer Seelen und
Verteidiger ihrer kulturellen Interessen sahen, den sie nicht
nur die Druckschriften seines Verlages, die Gründung der
Synode, aber noch als den Förderer der Bewahrung ihrer
Herkunft, verdankten.
Die Erläuterungen über das Leben Koseritzs und Rotermunds erlaubt uns
festzustellen, dass beide in enge Beziehungen mit den
Gemeinden in denen sie lebten verbunden waren, was auch für
andere Schriftsteller und Herausgeber desselben
Zeitabschnittes wichtig sein konnte. Ihre Schriften waren
deshalb in den vielfältigen Erfahrungen die sie mit ihren
Lesern teilten, begründet. Als Politiker und Pfarrer nahmen,
diese beiden Stellvertreter der Schriftstellergenossenschaft,
unter vielen, einen würdevollen Platz ein; da sie gelehrte
Staatsmänner waren, wurde ihr Aussehen durch ihren
bevorzugten' Status, als die "Erzeuger der Wahrheit",
begünstigt.
Koseritzs Texte zeichneten sich, wegen der
Sprache, die starke Schlussfolgerungen und Orientierung der
hohen europäischen Gedanken zeigte, aus. Durch sie, versuchte
er seine Leser zu überzeugen, die religiöse Tradition zu
verlassen und ihre Handlungen in Richtung der freisinnigen
Grundlehre auszuüben.
Seit seiner Gründung hatte der "Koseritz Deutscher Volkskalender"
(KVK), nach der Meinung seines eigenen Erzeugers, "sollte er
eine Waffe des Kampfes zu Gunsten der Aufklärung sein". Somit
sollte er die Eroberungen und das Licht des Deutschtums von
über-See den Kolonisten bringen, welche er als die Gemeinde
der Deutsch-Riograndenser nannte.
Schon in den ersten Bänden dieses
Kalenders, veröffentlicht Koseritz
einen Text in drei Artikeln, unter den Namen Der
Sieg der Wissenschaft über die Religion [54]. In diesem Artikel behauptet er, dass
in den Urzeiten, da die Menschen nicht fähig waren, die
Naturerscheinung zu verstehen, erfanden sie Götter und Sagen,
welche ihre Angst in Hinsicht auf das Unbekannte rechtfertigen
und trösteten; diese Mentalität bestand praktisch unversehrt,
in ihren Grundlinien, mindestens bis zum Advent der
protestantischen Reformation. Als die Vorgänger gegen das
Dogma und die Unfehlbarkeit des Papstes kämpften, öffneten sie
die Türe zu dem was des Christentums zerbersten würde, zum
Beispiel, das freie Examen und die Kritik. Diese Bewegung
führte, wenn auch unfreiwillig, zu vernunftgemässen Gedanken.
Als Koseritz
seine Untersuchungen über das Zeitalter der Aufklärung,
machte, nennt er, zu mindestens, zwanzig Schriftsteller der
hohen Kultur Europas, wie, zum Beispiel, Giordano Bruno, Descartes,
Spinoza, John Locke, Herder,
Hegel und Feuerbach. Er organisiert sie, sodass alle mit den
Entwicklungsthesen und dem Leugnen des religiösen Glaubens
übereinstimmen.
Er hebt das Werk Darwins hervor, und
schätzt den Verfasser, als denjenigen der den Übergang der
Philosophen und Denker des modernen Zeitalters,
vervollständigt.
Seine Gelehrsamkeit zeigt sich in diesen
unzählbaren Anführungen, welche von komplizierten
Betrachtungen über die Menschheit begleitet sind, ganz nach
dem Sinne der gelehrten Männer seiner Zeit, für welche die
Welt der Ideen, sich in der Gesellschaft vollständig
widerspiegelte.
Koseritzs Kalender handelte aber nicht nur über
solche Anlässe. Über die politisch-wirtschaftliche Lage
Brasiliens zu berichten, praktische Informationen zu bringen,
wie zum Beispiel die Post- Preistarifen, die zu bezahlenden
Steuern, die nötigen Apparate zu den landwirtschaftlichen
Erzeugnissen mit Verkündigungsgründe, und anderes,
vervollständigten die Seiten seines Büchleins.
Dieser Inhalt passte sich mit einer
zugänglichen und volksmässigen Literatur; nehmen wir zum
Beispiel zwei Erzählungen, der
Musterreiter (KVK,
1875, S. 132-35) und der
Coronel (KVK,
1874, S. 100-10), beide von Koseritz.
Die erste Erzählung beschreibt in humoristischer Art die
Charakteristik des Kalenders. Diese Art personifiziert in der
Titelfigur des Musterreiters (der reisende Handelsdiener) ein
Gutaussehender, eleganter Mann, der gern Zigarren raucht, gern
tanzt und den Frauen zugeneigt ist; lehnt nicht einen guten
Wein noch, hin und weder einen "Chimarrão"
ab.[55]
Zu Pferde besucht er alle in der Gegend liegende Städtchen,
überbringt, mit seinem scharfen Humor, Nachrichten, Meinungen,
und Kritik all seinen Gesprächspartnern. Er ist auch überall
als der Kalendermann bekannt, der immer seinen Kopf gebraucht,
das heisst, ein Aufgeklärter.
Er zeigt sich als jemand der überall und
nirgends ist, eine Tugend die zu seinem wirklichen Ausweis
passt, wie die eines Buches; seine Lebensart sollte nachgeahmt
werden als ein Muster der Geselligkeit.
Der
Coronel ist teils
eine erdichtete, teils eine wirkliche Persönlichkeit; einige
Grundstoffe dieser Erzählung können Autobiografisch angesehen
werden, wegen ihrer Ähnlichkeit mit dem Leben des Verfassers.
Der "Coronel”, eine Anführung des Urbildes des brasilianischen
Leaders, nach Koseritz Meinung,
er ist auch ein Leader der Deutschen, dessen Vollmacht nicht
aber durch Kraft erobert worden ist, aber auch durch Vernunft.
Es handelt sich hier um das Pseudonym des Arztes Daniel
Heillebrand, der zu dem preussischen Heer gehörte und in den
Kriegen im Jahre 1815 gegen die Mannschaften Napoleons
kämpfte, der dann nach Brasilien auswanderte, um hier
gleichzeitig als Arzt und Kundschafter tätig zu sein. Durch
seine Erkundigungen und Studien, wählte er die günstigen
Landstreifen zur Ansiedlung aus und arbeitete, später, bei den
Bauern.
Als der Revolução Farroupilha (Farroupilha-Krieg)
ausbrach, organisierte er die Immigranten um gegen diesen
Aufruhr zu kämpfen. Sein Zähigkeitsvorbild und seine
befreiende Art widerspiegeln seine Kultur, gestaltet sich als
eine Beziehung zu seinem Volke.
In der "Deutsche Zeitung" übt Koseritz Kritik gegen die
brasilianische Politik und gegen die Kirche in einer
direkteren Form. Wenigstens zwei Anlässe spürt man diese
Tendenz; der erste beschreibt seine Eindrücke über dem
brasilianischen Hof, den er als unnütz beschreibt, sei es in
der Darstellung der aristokratischen Macht, sei es in der
Ausführung der politischen Verwaltung.[56]
In anderen Anlass nützt er die Nebenhandlung der Mucker um
gegen den religiösen Geist seine Kommentare zu machen; der
Auslauf diejenigen Begebenheiten offenbart; nicht den
wirklichen deutschen Geist, sondern eine Erfahrung die an den
Fanatismus grenzt, spürbar bei allen Gläubigen.[57]
Im Bezug der Katholischen Kirche ist er nicht weniger streng;
er sieht im der Arbeit der Jesuiten eine politische Macht die
sich hinter der Religion verbirgt, Betrug der in Preusse
besiegt dank des Kulturkampfes, welche die Kirche von den
Geschäften des Staates getrennt hat, was auch im Brasilien
geschehen muss.
Mit der Ankunft Rotermunds, haben seine
Angriffe ein ganz bestimmtes Ziel. Laut der "Deutsche
Zeitung", war Rotermund ein Pfarrer der sich "in einen
Journalisten verwandelte" um die Angst und die deutsche Ware,
unter den Deutschbrasilianer, zu verbreiten. Der Einfluss der
Deutschen Lutherischen Kirche würde nur die selbständige
Organisation schädigen.
Unterdessen beschäftigen sich seine
Artikel mit offenem Widerstand gegen den Evangelischen und
Katholischen Klerus, Rotermund, derweil er seine
Herausgeberarbeiten beginnt, erwähnt er praktisch nicht seinen
Gegner, versucht auch nicht, sich mit solch polemischen Ideen
zu beschaffen. Im Gegenteil, er schreibt kleine Erzählungen
oder auch Beschreibungen die sich in wirklichen Begebungen
begründeten, von moralischen Ratschlägen und Aphorismen
durchdrungen. Sich stark in Gedichten, Bibelversen,
Volkssprüche flüchtend und auf eine orientierende Sprache
eingehend, die leicht verständlich und leicht zu lesen war,
erreichte der "Kalender für die Deutschen in Brasilien" - KDB,
bald dieselbe Popularität des Vorhergehenden. Die Erzählungen
Rotermunds begründen sich in einfache Menschen und täglichen
Zuständen oder Begebenheiten; sein Blättchenausssehen
gab die Möglichkeit zu einem gesunden Zeitvertreib, ganz nach
dem Sinn der deutschen Pietisten.
Er verlor nicht viel Zeit mit
verwickelten Beweisen wie es Koseritz
tat, noch zentralisierte er seine Rede in gedrängten
Objektiven, welche die dieselben beeinflussten. Weil er
nämlich nicht dort seine Beziehung mit den Segmenten der
unrechtmässigen Besitzer eines gelehrten Kommens hatte,
sondern in der Synode, welche er Vorstand.
In der Erzählung Die
beiden Nachbarn (KDB,
1884, s. 40-44) wiedergibt er den Widerstand zwischen einen
religiösen und einen nicht gläubigen Menschen. Derweil der
Erste auf dem Land arbeitet, ist der Zweite Kaufmann in der
Stadt (Vendtst). Die Kinder des Landwirtes heiraten
ihres Gleichen, sind glücklich, machen Fortschritte und
bleiben ihrem Glauben treu; die des Kaufmanns, heiraten
reichen Menschen, sind aber tiefunglückliche Menschen. Die
Erzählung ist interessant, weil darin noch die Figur des
Abgeordneten des Südens Gaspar Silveira Martins vorkommt. In
dieser Erzählung, spricht derselbe Martins zu den Deutschen
und empfehlt ihnen ihre Herkunft zu bewahren und den Gebrauch
der deutschen Sprache zu pflegen. Auf dieser Art, versucht
Rotermund, deutlich die Unterstützung des Abgeordneten,
welcher von den Deutschbrasilianern geehrt ist, an seine Ideen
anzugliedern; er versucht noch einem harmonischen
Zusammenleben der brasilianischen Bevölkerung und der
Deutschen geben kann.
Ein anderes Thema welche seine Schriften
durchzieht, die im Rotermunds Kalender, herausgegeben wurden,
sind die Abenteuer in welchen er die deutsche Einwanderung zu
schildern versucht. In diesen Erzählungen zeigt er die
Indianer und Eingeborene als sorglose Menschen, und als
feindlich die Natur und das Klima im Kontrast zu der Zähigkeit
und der Intelligenz der Immigranten. Andererseits werden die
Neger von ihm als Opfer eines Ausbeutungssystem dargebracht,
welches nicht weit von dem europäischen Immigrationsverfahren
entfernt ist, und der Grund des Kampfes zur Erhaltung des Landwirtenstandes, der Grundbesitzer,
als Garantie gegen die Gefahr der Oberherrschaft.
Was aber diesen Kalender am besten
kennzeichnet, ist die beständige Gegenwart der Geschichte,
Sprichwörter und biblische Verse, die auf den nicht
beschriebenen Seiten, vermerkt sind, welche dem Leser zu
täglichen Notizen zur Verfügung stehen. Auf diesen Seiten
waren die Wochentage gedruckt, ein Bild der Jahreszeiten, und
auf den Fussnoten befanden sich die Sinnsprüche, dort gedruckt
als der Losungsspruch des Tages, diese Merkmale verbleiben in
seinen Kalendern bis zum Endschluss der Herausgabe.
Rotermund sorgte sich auch um die
Entwicklung einer selbständigen Literatur welche die Kultur
der Deutschbrasilianer widerspiegeln sollte, wo die Werte der
Herkunft sich der neuen Realität der Immigranten
kennzeichnete, im Gegensatz zum Einfluss der säkularen
deutschen Kultur in seiner Gemeinde; die religiöse
Kultur, sollte im Gegenteil von der
deutsch-Lutherischen Kirche beschützt werden, von welcher er
ein treuer Vertreter war.
Aus diesem Grunde, schliesst er in
seinem Kalender und in der Deutschen Post, verschiedene
Artikel, wie zum Beispiel, Texte von Georg Knoll, den Dichtern Ernst Niemeier und Wolfgang Ammon,' Autoren die sich der Kultur und der
Geschichte der Immigranten widmeten ein, und wie viele andere,
die aus verschiedenen Gegenden des Südens Brasiliens, kamen.
Mit der Zeit, war die Zahl der Erzählungen über die
Deutschbrasilianer anderer Gegenden, praktisch der aus Rio
Grande do Sul kommenden, gleich.
Der Wettstreit zwischen Koseritz und Rotermund überschritt nie
den Bereich der Ideen, gemäss der nachgeforschten Urkunden.
Als guter Politiker, versuchte Koseritz
seine Kritiken zu vermindern und sich dem Pfarrer zu nähern,
wenn die Interessen seiner Wähler es verlangten. Man kann
vorläufig auch nicht feststellen bis wo diese Meinungen das
Leserpublikum teilte, weil selbst die Emphase in den Schriften
Koseritz sich nicht lange hielten.
Bald nach Koseritzs Tod, wurden
seine Zeitung und Kalender von pangermanistischem Herausgeber
übernommen und ähnelten dann sich in den Artikeln, denen deren
sie sich früher widersetzten.
Die Zwietracht zwischen den liberalen
Agnostiker und den Protestanten, die sich dem Nationalismus
Bismarcks zuneigten, war sehr oft in anderen lokalen Zeitungen
und Kalendern bemerkbar. Nach Meinung Giralda
Seyferth, (1982), diese Bestrebungen bewahrheiten sich in
Santa Catarina und Paraná, wie auch in Innern des Rio
Grande do Sul. Man hebe noch hervor, dass es auch
katholische Kalender und Zeitschriften gab, viel Mildere als
die mit liberalem oder protestantischem Einfluss, wie "Der
Kompass" zum Beispiel, der in Curitiba im
Jahre 1890 gegründet wurde und das Deutsche Volksblatt im
Innern des Rio Grande dos Sul.
Die internen Verschiedenheiten mindern
sich, mehr oder weniger, so langsam ab, bis zu der
Jahrhundertwende, wo man praktisch keine bedeutenden
Verschiedenheiten zwischen den beiden' Tendenzen bemerken
kann. Wenn es welche gibt charakterisieren sie sich nicht als
Widerstand unter ihnen, sondern durch ihre historische
Beschaffenheit, wie zum Beispiel, die üblichen Unterschiede
der Hauptregeln der katholischen und der evangelischen
Religion, oder noch der religiösen und säkularen Literatur.
Hier beginnt eine Verteidigung des Deutschtums als eine
bevorzugte Form um sich eines gemeinsamen Gegners zu
widersetzen, zum Beispiel, die sogenannte Luso-brasilianische Kultur. Seitens
der Liberalen, die in dieser Identität, ein individuelles
Recht eines Teils der Bürger sehen, wie auch Seitens der
Protestanten, die darin ein rechtliches Element ihres Glaubens
sehen, die Frage des Deutschtums nimmt von da ab, einen
wichtigen Stand ein, einen würdigen Vorrang über irgendwelche
andere Stellungen.
Diese gewöhnliche Feststellung brachte
die Presse dazu sich als die organisierende und
stellvertretende Rolle dieser Gruppe, in einen
Verteidigungszustand, zu sein. Bei den Katholiken, bemerkt man
eine zweideutige Haltung: von Seiten des hohen Klerus wird die
Integrierung dieser Sub-Gemeinde in die brasilianische Kultur
gewünscht, hauptsächlich in dem Gebrauch der portugiesischen
Sprache. Im Namen des christlichen Universalismus aber, die
Laienvorsteher der Parochien, der niedrige Klerus genannt,
gründeten ethnisch-religiöse Stiftungen, wie zum Beispiel,
Waisenheime, Altenheime und auch Wohltätigkeitsstiftende
Frauenvereine. Die halten als besondere Arbeit die Hilfe an
Notleidende, bevorzugten aber diejenigen deutscher Abstammung.
Die Erhaltung der katholischen Presse in deutscher Sprache
wurde als ein Mittel zur Eroberung der Wähler angesehen
(LUEBKE, 1987, S. 38 usw.)
Irgendwie bemerkt man aber, dass seit
1890 die Pluralität der Herausgaben praktisch besiegt ist, mit
Ausnahme einiger Bestrebungen der Sozialdemokraten und der
Anarchisten. Was man beim Lesen der verschiedenen Schriften
dieser Zeit feststellt, ist ein Prozess der Homogenisierung
des Inhaltes.
Mit dem Ausbruch des ersten Weltkrieges,
verstärkt sich die Bestrebung auf dem Gebiet der Kultur, der
Wirtschaft und der Politik. Unternehmen die nicht mit einer
gründlichen finanziellen Hilfe rechnen konnten, gingen zu
Grunde, wegen der Angriffe und Boykotts und Unterdrückungen in
Hinsicht auf das Land ihrer Herkunft. Ausserdem wurden sie
auch von den Lesern und den Mitgliedern der Vereinigungen die
derart Herausgaben finanzierten, verlassen, aus Angst, dass
sie als mit den Interessen Deutschlands verwickelt würden. Es
gab auch noch solche die absichtlich sich des patriotischen
Fortganges des neuen Vaterlandes fügten und indessen Namen
sich verwandelten.
Was, zum Beispiel, noch vermerkt werden
muss ist, dass der anti-Germanismus und der Krieg eine
Destillations-Effekt der Segmente germanischer Herkunft
verursachte; wenn ein Teil sich freiwillig oder auch
unfreiwillig auf Seiten der Interessen Brasiliens einreihte,
und ein Anderes einfach ihr Interesse und ihre Vorzüge für
Deutschland in der Öffentlichkeit unterdrückte, so gab es auch
diejenigen welche ihre Kompromisse mit dem Deutschtum aufrecht
erhielten, behaupteten sehr gründlich ihre Stellung,
kritisierten die offiziellen Autoritäten und die Unterschiede
der Gesellschaft, immer noch als die Empfängerin betrachtet,
führte sich wie eine ethnische verminderte Gruppe auf, die
sich als selbst-Bewerber einer "Nation" welche von einem
autoritären Staat unterdrückt wird,[58]
genauso wie auch eine verminderte Zahl des
Österreich-Ungarischen und des Deutschen Kaiserreiches sich
gegen ihre Regierenden widersetzten. Eines Teils, kann man
dieses Betragen, von bestimmten sub-Gruppen als einen
Wiederaufbau der Erfahrung welche einige in Europa hatten,
ansehen, wie zum Beispiel, die Immigranten die aus Russland,
von der Wolga Gegend kamen (FUGMANN & BREPOHL, 1927), oder
von noch Anderen die auch ethnische Unterschiede erfahren
haben, weil sie von Grenzgegenden kamen. Aber die Betrachtung
der Verteidigung des Deutschtums begrenzte sich nicht
denjenigen, sondern im Gegenteil, sie bekräftigte sich als
eine politische Kraft, welche alle einbeziehen sollte, selbst
die Familien die schon seit beinahe ein Jahrhundert im Lande
lebten. Die Tatsache, dass diese Erfahrung bekannt wurde,
brachte es dazu das einige sich aufrichtig und solidarisch zur
Idee der Notwendigkeit einer Verteidigung, stellten der
Begriff einer "Herde", Ausdruck, welcher oft in den
Betrachtungen der Pfarrer, vorkam, half auch um in ihnen das
Gefühl der Minderheit zu stärken. Wenn aber dieses Betragen
nicht noch andere Antriebe als nur die ihrer eigenen Leiter
gehabt hätte, wären sie schwerlich über ihre eigenen Grenzen
hinausgekommen. Zu ihrer Befestigung war es nötig, dass zu
ihnen sich die Betrachtungen und Erfahrungen der Gruppen
vereinigten, dessen Erfahrungen ihnen fremd waren, sich aber
mit ihren Gesinnungen verbanden, um ihren Betrachtungen einen
neuen Sinn zu geben.
Diese Gleichartigkeit berechtigt sich
deshalb, wie schon in den vorigen Kapiteln berichtet wurde,
aus externen Gründen die sich durch die Entwicklung und durch
den imperialistischen deutschen Charakter erklären lassen; die
Aufrufung der Republik erfüllt ebenso eine wichtige Rolle in
der Orientierung der Ausdrucksweise der kulturellen und
politischen Darstellung der Immigranten und ihren Nachkommen.
Dieses Zusammenfliessen der Begebenheiten haben nicht nur als
eine zusammenfassende Rolle der ursprünglichen Überlieferungen
der Deutschen gewirkt, sondern auch die Lektüre welche, über
ihr Wirken in Brasilien berichteten, eingeleitet, Änderungen
die wir zu analysieren versuchen werden.
Das Deutschtum
und das Auslandsdeutschtum
Laut einer Sage, ist Pan eine
griechische Gottheit, Sohn des Hermes und ein Herdenhüter. Er
besass Hörner, eine hochstehende Nase und Bockbeine; weilte in
den Bergen der Arakadius,
begleitete den Nymphentanz mit
seiner Flötenmusik. Manchmal zeigte er sich wie die
personifizierte Natur, alles in einer vorhandenen Ordnung der
Dinge einschiessend.
In den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts
bis zu dem ersten Weltkrieg, wurden der asiatische und der
afrikanische Kontinent unter verschiedenen europäischen
Ländern verteilt, eine Unternehmung die keine Grenzen kannte,
von einer Sucht des Nutzens und dem Ausdehnungsdrang. Die
amerikanischen Kontinente, obwohl sie von der politischen
Kraft der Lehre Monroe's beschützt
waren, wurden sie nicht von den streitsüchtigen starken
Mächten bewahrt. Für diese, eben erst selbständigen Länder,
unterlies man, in meisten Fällen, die Eroberung anderer
Gebiete, und gebrauchte die Strategie der Oberherrschaft des
Marktes, oder den politischen Einfluss der gut belohnten
Vertreter ihrer Interessen. Solche Interferenz wurde
strategisch geteilt mit der Spitzen-Wirtschaft dieses
Kontinents, die Vereinigten Staaten, eine Nation die sich sehr
bald in gleichstellten Bedingungen zu der Wirtschaft der
industrialisierten Länder Europas zeigte. Laut Hosbaum (1988, S. 87 u.w.) wurde eine neue Art des
Imperialismus gegründet, welche die gewesenen nicht-
industrialisierten Herrschaften durch Gewalt verschlungen, und
somit wurde die restliche Welt in informellen Kolonien in
ökonomisch, politisch und kulturellen Zonen geteilt.
Zur gleichen Zeit, der Nationalismus,
welcher die Bewegungen für die Emanzipation in den alten
Kolonien des 18. Jahrhunderts beeinflusste, wurde vom Staat
angenommen, mit der Einwilligung der Mittelklassen und ein
Teil der hohen Klasse, und verlor eine seiner wertvollsten
Grundlehre, die individuelle Freiheit und das folgliche Recht der Selbstbestimmung
der Völker. Dieser Nationalismus, von offiziellem Charakter,
ist auch Frucht einer politischen Reaktion gegen die sozialen
Bewegungen im Innern jedes Landes, sollten sie von
Klasseninteressen geleitet werden, oder, an diese verbunden
sein, durch Ausdehnung der Bürgerrechte der ethnischen
Minderheit. Als Antwort, hauptsächlich an die
Arbeiterorganisationen, die Interessen des Landes würden sich,
zumindestens zur Meinung der
offiziellen Mächte, als Füllwort zwischen dem individuellen
und gesamten Interesse, einsetzen.
Wenn auch der Begriff des Nationalismus
Änderungen verspürte welche ihn von den liberalen Grundregeln
entfernte, so fuhr er weiterhin fort, unverträglich mit den
Utopien des Imperialismus zu sein. Wenn die Nationalität der
Bürger durch die Gleichheit in der Hinsicht des Staates
festgesetzt wird, welcher verpflichtet ist, die Bürger zu
schützen und ihnen die grundlegenden Rechte zu sichern, und in
Hinsicht auf die nationale Oberherrschaft, wie kann man die
gewaltige Unterdrückung die über andere Völker verübt worden
ist, annehmen? Nach Hannah
Arendt Meinung, (1978), war
dieses gleichzeitige Vorhandensein möglich, weil ein
Unternehmen ebenfalls irrational, wie die rassistische
Ideologie, entwickelt wurde. Ihre Schwäche im theoretischen
Plan ist verhältnismässig das Gegenteil der Zahl ihrer
Nachfolger, besonders, unter den Geistwissenschaftler, von
welchen es, in Brasilien, eine beträchtliche Zahl von
Vertreter gab. Die Vereinbarung der nationalistischen
Auffassung mit dem Rassismus ermöglichte die hierarchische
Gliederung der Menschheit in biologisch geringeren und
überlegenen Schichten, sodass man vom einfachen Genozid bis
zum Schutz und der Erziehung der Völker, welche niemals solche
Leistungen beanspruchten, rechtmässig erklärte.
Wenn auch der Ausweg, um überflüssige
Männer und überflüssiges Kapital nach Gegenden wo es später
die Möglichkeit gab, den Markt nach der ausdehnenden deutschen
Strategie zu exportieren, entwickelt er sich aber, anfangs,
auf einer langsameren Art, als in anderen industrialisierten
Ländern, wegen der politischen und wirtschaftlichen
Wahlfähigkeiten die sich dort entwickelten.
Zur Zeit Bismarcks (1862-90) war die
Strategie der Gebiete- Eroberung nicht in den offiziellen
Plänen voraussichtlich. Selbst die Wahl der Einflusszonen
wurde, gleichfalls, gemeinden, im Namen einer pragmatischen
Haltung. Bismarck betrachtete einen kriegerischen Einsatz zur
Eroberung neuer überseeischen Besitzungen, kostspielig, auch
selbst, die Aufstellung einer Bürokratie die ihm die
Oberherrschaft der eroberten Gegenden gewährte, aus diesem
Grunde, sollten diese Verfahren zu Gunsten einer freien
Wirtschaft unterdrückt werden, im Hinblick auf die
Vergleichung Vorteile der deutschen Ware.
Laut Wehler,
He pursued his overseas policy for motives which allow it to be designed
as pragmatic expansionism; and he himself belongs in the
category of pragmatic expansionists. In contrast to the type
of imperialism that was self-assertation and of prestige, or
by the desire for recognition as a world power, pragmatic
expansionism resulted primarily from an assessment of economic
and social interests. (1970, S. 130)
Diese offizielle Haltung verhinderte
nicht, dass Unternehmer die sich für den direkten oder
indirekten Imperialismus interessierten, ihr Träumen und
Schaffen in Hinsicht, auf ihre utopische Gebietsausdehnung,
unterliessen, was dann später dem Nazismus eingereiht würde,
unter der Rechtfertigung einer Notwendigkeit der Erweiterung
des Lebensraumes. Solche Gruppen, welche sich einige Jahre
später, an den Alldeutschen Verband angliederten, setzten
sich, wie schon im vorhergehenden Kapitel vermerkt wurde, in
Ländern Süd-Amerikas, wo sie versuchten, in ausgedehnte Zeit,
eine Lateindeutsch brasilianische Republik zu gründen.
In Betracht auf die. Gegner, begann die
deutsche Kolonisationspolitik sehr spät, wenn man sie mit
derjenigen anderer imperialistische Länder vergleicht: sie
wurde erst anfangs der Mitte der 80. Jahre unternommen. Laut
Wehler, (S. 132 u. w.), handelte es sich um eine
anti-zyklische Massnahme, die unter anderen, den Zweck hatte,
die Wirkungen der wirtschaftlichen Krisen, die Deutschland
erlitten hatte, zu mindern. Erst in dieser Konjunktur hat
dieses Land sich um Gebietsteile Asiens und Afrikas mit den
anderen Ländern gestritten, und übte dort, dieselbe oder noch
grössere Gewalt als die der Gegner, aus.
Was sich zu Latein-Amerika bezieht,
wurde dort die Taktik das informellen Imperialismus
angewendet, und trotzdem, erst anfangs 1890, zum Zeitalter
Caprivi, wenn auch ihr wichtigster Mechanismus schon von
Zeiten begonnen hatte. Mit institutioneller Unterstützung,
beginnen die Agenten des deutschen Imperialismus den Markt in
Ländern wie Chile, Peru, Argentinien und Brasilien zu erobern.
Ausser der wirtschaftlichen Ausdehnung, erhebt sich ihr
Einfluss in den wirtschaftlichen chilenischen und
argentinischen Armeen in welchen, die Aussendung der Waffen
und eine Reihe von Lehrmeistern zwischen 1891 bis 1914, nur in
Chile, kam die Zahl auf 300 deutsche, die in ihrer Begleitung
eingeborene Offiziere nach Deutschland brachten um dort zu
studieren. Die Eigentümer der Hafenunternehmen des Exports und
Imports waren auch Deutsche, die von den Eingewanderten in
ihren Unternehmungen unterstützt wurden (BLANCPA1N, 1990, S.'
433-82). In Brasilien, wegen der Erheblichkeit der Politik der
Monroe Lehre, die Agenten des deutschen Imperialismus
begrenzten sich an dem Export der Waren und der
pangermanistischen Lehre in den Kolonien wo die Zahl der
eingewanderten Deutschen und derer Nachkommen stark war.
Karl Peters (1856 - 1918) zeichnete sich
in diesem Zusammenhang aus, als ein nationalistischer Kämpfer,
welche den direkten wie auch den indirekten Imperialismus
verteidigte; verwaltete verschiedenen Kolonien in Afrika und
beeinflusste politisch das Parlament damit ein Programm zur
Verteidigung der Deutschen in Ausland eingeführt würde. Die
Peinigung und die Gewalt, welche er als einzigen Inhalt seiner
Politik in Afrika ausübte, galt für ein fremdes und niedriges
Volk, aber nicht für seine ethnischen Volksgenossen, wie er
selbst, in verschiedenen Gelegenheiten, behauptete. Peters war
im Gegner der Monroe Lehre, denn er schätzte unter dem
kulturellen Licht, Latein-Amerikas, weithin verschiedener von
den Vereinigten Staaten als von Europa; der Panamerikanismus
sollte, nach seiner Meinung, aus diesem Grunde eine künstliche
Ideologie geschätzt werden um in dem Handel anderer Länder
beeinflussen, eine Drohung der Oberherrschaft.[59]
Oberherrschaft welche ihre Grenzen hatte und nicht in
Konflikte welche die Deutsche einschlossen, angewendet werden
sollten; er zeigte sich öffentlich geneigt, zum Beispiel, zu
einer Vermittlung seines Landes in Brasilien, als einige
Deutsche verfolgt wurden, weil sie an Bewegung in Rio Grande
dos Sul, im Jahre 1891, teilnahmen; zu der Zeit, bestand er
darauf das Cprivi militärische
Kräfte dorthin senden sollte, um auf Seiten der Volksgenossen
zu kämpfen (SNYDER, 1984,' S. 51)
Peters und seine Nachfolger konnten nach
der Entlassung Bismarcks, welcher die Ideen des
Grossdeutschlands nicht ernst nahm, freier handeln.[60]
Zur Zeit Caprivis wurde sein Begriff über Volk und Nation in
der offiziellen Politik betrachtet; eine Idee wie diese,
welche den Begriff der Transterritorial betreffend bis zur
letzten Folgerung entwickelte, brauchte selbstverständlich,
eine annehmbare Definition. Die nationale Identität wurde als
die Form mehr oder weniger vom Zufall abhängig angesehen; von
der Beschaffenheit und der politischen Übereinstimmung ihrer
Nachfolger, die Unterscheidungszeichen konnten die Religion
oder politische Staatsverwaltung, oder der geographische Raum,
die Geschichte oder die Kultur sein. Deshalb die Idee der
Einigkeit bevorzugte die Rasse und die Sprache, zudem noch der
Begriff der ethnischen Überlegenheit kam, nur für reine
arianische geltend, nicht für irgendein weisser Typ. Das
letzte Ziel bestand darin den Feind zu besiegen, wären es
andere Länder, wie Frankreich, England und Russland, andere
Völker, wie die Juden, Zigeuner und Slaven oder andere Ideen,
wie der Liberalismus und der Sozialismus (SNYDER, 1984).
Die Bewegung, vor und nach der
Organisation, hatte mehr Sympathisanten als Anhänger.
Verblendete die Mittelklasse wegen der Xenophobie und weil sie
die Empfindung der Drohung in ihnen stärkte, verursachte aber
auch die Angst wegen der Gierigkeit nach politischer Gewalt.
Diese Bewegung entwickelte sich zuerst in Österreich, ab 1860,
und charakterisierte sich durch die offene Widersetzung zur
Regierung, in Hinsicht der liberalen Haltung. Ihre Gründer
ernannten seine Leiter Bismarck ihren Führer (Stellung die
nicht von seiner eigenen Beharrlichkeit abhing) und brachte
die Unzufriedenheit der kleinen Bourgeoisie, welche sich
ängstigte wegen der Möglichkeit der Sezession, dass der
Zionismus und Slawismus auch auftretend, sich ihren aufführte.
Seine Leiter schätzte man
verantwortlich, laut Schorske,
(1988, S. 127), weil sie sich als Vorgänger einen "neuen
politischen Kultur wo die Gewalt und die Verantwortlichkeit
sich vervollständigten in einer verschiedenen Art der Kultur
des rationalen Liberalismus".
Unter diesen Personen, hob sich
Schönerer heraus, weil er die Ideen des Antisemitismus
organisierte und wegen seiner Fähigkeit den politischen Kampf
ausser parlamentarische einzufügen, Stellung welche seinen
bekanntesten Nachfolger Adolf Hitler, ausserordentlich
begeisterte.
Das österreichische Deutschtum, eine im
Makro abgewandelte Form des Nationalismus, welche sich von den
anderen unterscheidet keine Voraussetzung von verschiedener
völkischer Vereinigung sah, wie zum Beispiel der Pan-Slawismus
in Russland, erweckte grössere Wirkung in Deutschland, wo die
Bewegung sich mit entscheidendem politischem Ehrgeiz
organisiert ab der 90. Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts, um den
Alldeutscher Verband. Dieser Verband, zog Nationalisten aller
Klassen an, wie zum Beispiel, Intellektuelle wie Max Weber, Haeckel und Theodor Fischer, oder Militanten wie Hugenberger, Haase und Class, welche sich, auf die Ideen der Romantiker des
Anfangs des Jahrhunderts stützen, und sich dem staatlichen
Nationalismus angliederten. Sie rechneten noch mit der
Unterstützung anderer Verbände, von welche uns die schon
genannte "Deutsche Kolonial Gesellschaft" interessiert und der
"Verein für das Deutschtum im Ausland", welche eine Abteilung,
den "Allgemeinen Deutschen Schulverein" unterhielt.
Einige nationalistische Parteien, wie
die Deutsche Nationale Volkspartei - verliehen ihnen ihre
Unterstützung, und kämpften um verschiedenen Massnahmen ihrer
Interessen im Parlament zu bestätigen.
Ihre hauptsächlichen Ziele ihrer
Statuten, waren:
Ausarbeitung und Propagierung der
Expansionspläne; Kampf für die Flottenverstärkung;
Arbeit mit dem Deutschtum im Ausland;
Kampf gegen die nationalen Minderheiten in
Deutschland, besonders gegen die Polen. (LEXIKON. 1983. S. 19)
Im 20. Jahrhundert kamen zu diesen
Absichten noch die Forderung, dass die Bürgerrechte sich auf
die Deutschen im Ausland erstrecken sollten, unter den
Beweisgründen des jus sangüinis und verweigerten sie die Zulassung des
Bürgerrechtes an Individuen anderer ethnischen Herkunft, die
im Lande wohnten. Verstärkten noch ihre anti-semitischen
Stellung und förderten die Propaganda zu Gunsten der
bewaffneten Kämpfe.
Ihre Ideen verbreiteten sich rasch in
einigen periodischen Schriften in deutsche Sprache in
Brasilien, wie zum Beispiel, der "Urwaldsbote",
aus Blumenau, welcher von da ab, eine finanzielle
Unterstützung von dem Verband erhielt. Ausser diesem, bekamen
verschiedenen andere, Artikel von einigen Verfassern, die
direkt oder indirekt sich dem Verband verpflichtet hatten.
Aber der systematischere Einfluss kam von dem Verein für das
Deutschtum im Ausland - VDA, welche durch die Hilfe an die
Privatschulen der Deutschen Sprache, welche die Kinder und
Jugendliche für das zukünftige Deutschtum vorbereitete.
Der Verband finanzierte den Bau der
Schulen, schenkte die nötigen Möbel und Gegenstände, die
Schulbücher und sandte in Deutschland ausgebildete Lehrer um
sich hier in die Kreise der Lehrerschaft einzufügen, unter dem
Slogan
- Gedenke, dass du ein Deutscher bist -
begünstigte der Verband noch die Ausbildung einiger
Deutschbrasilianer in seinem Land.
Nach Paivas Meinung, war die finanzielle
Hilfe nicht bemerkenswert und der Einfluss, in der Praxis,
unwirksam (1984). Diese Schlussfolgerung ist, nach unserer
Meinung, zweifelhaft, denn er geht von der Voraussetzung aus,
dass dasjenige Material ausschliesslich in den Stadt-Zentren
verteilt wurde, und nicht unter den Bauern, den meist
vorstellenden Teil, derer Schicht. Wir hatten schon die
Gelegenheit festzustellen, dass die These der Mehrzahl der
Bauern über die anderen Gruppen der Einwanderer nicht der
empirischen Gewinnheit
übereinstimmt, und dass die Landleute enge Verbindungen mit
den Städten hatten, mit wenigen Ausnahmen, dank der vielen
lokalen Vereinigungen. Die Veröffentlichungen gegen den
externen Einfluss, an welchen der Verfasser sich hält, kommen
von den Kolonienlehrern, und der
Laienprediger, wir sind uns aber nicht sicher dass sein
Widerstand sich in den Ideen, die von dem VDA gefördert
wurden, vereinigten; für diejenigen kamen nun in Frage die
Konflikte zwischen Land und Staat - die schon seit Anfangs der
Kolonisation gegenwärtig waren - die Konkurrenz zwischen den
formellen Unterricht und den Ihrigen, die Auflage der
brasilianischen Gesetzgebung über den Lehrstoff und ihren
eigenen Bestrebungen.
Ausserdem kann die Wirkung dieser Literatur nicht
nach dem Münzwert geschätzt werden, oder nach dem Publikum
welches Anfangs durch sie erreicht wurde, ausserdem durch die
grössere oder kleinere Wirkung des Umlaufs und der Mitteilung.
In diesem Fall ist es wichtig zu beachten, dass die Literatur
die Deutschen schon seit' der Kindheit erreichte und sie bis
zum Erwachsensein begleitete, ganz besonders, diejenigen,
welche die Möglichkeit hatten, dieses Material zu erhalten.
Wei sie regelmässig erschien, konnte sie ständig in den Alltag
eingreifen, und war in vielen Orten, das einzige schriftliche
Material welches ihnen, den Lesern zur Verfügung stand, ebenso
als Inspiration für neue Schriftseller. Ausserdem schätzten
wir es nicht unwichtig die umfangreiche Beihilfe die den
Schulen zugeschickt wurde; im Jahre 1927, betraf diese Hilfe,
zum Beispiel, 18.000 Mark (oder 45.000 Mark zu dem heutigen
Kurs), welche allein von einer Ortsgruppe aus Hamburg kam und
zur Erhaltung der damaligen Schulen dienen sollte, ebenso zur
Anschaffung von Schulbüchern.13
Ausser dem didaktischen Schulmaterial
und der vielen Beiträge in den Deutschen Zeitungen, in Form
verschiedener Artikel oder auch finanzielle Hilfe, kann man
noch die Eröffnung der "Zentralstelle für die Forschung des
Deutschtums im Ausland" - ZDA nennen, Stiftung das die
Forschungsprogramme welche die Auswanderung und die
Begünstigung der Pangermanischen Kultur im Ausland förderte,
diese wurde in einer neuen Wissenschaft verwandelt. Die
Mitglieder fertigen Studien über die brasilianische Politik
und über die günstigsten Gegenden zur Einsetzung neuer
Immigranten und förderte noch Hilfeleistung an die
Pangermanisten in Brasilien. Gab auch die Lage [61]
des Deutschtums in Brasilien für beide Länder bekannt und
glaubten es sei ihre vorzügliche Aufgabe die Bildung einer
elidierten Gruppe welche die Kultur aller Deutschstämmigen
sicherte und bewahrte. Laut Kuder, (1937), ein Mitglied dieses
Unternehmens, die Bewahrung des Deutschtums durch Literatur
war eine Aufgabe der deutsch-' nationalen Gemeinde. Solche
Forschungen und Bücher wurden gleichmässig unter der deutschen
Bevölkerung befördert, und wurden sehr sorgfältig ausgewählt
zu diesem Zweck.
Für die Mitglieder des VDA und anderer
gleichgesinnten Vereinigungen, galten die Auswanderer nicht
nur als Gruppe, denen geholfen werden, musste, sondern sollten
auch vorbereitet werden, um die deutsche Nation und ihre
Interessen vertreten zu können. Im Jahre 1990, wurden 20.000
deutschbrasilianische Pangermanisten von der Z.D.A. anerkannt
und diese Zahl nahm immer mehr zu bis zu dem ersten Weltkrieg.
Von diesem entstammen diejenigen welche den Vorzug halten
einen sozialen Aufstieg zu erreichen, und diese Übernahme die
Aufgabe die Verbindungen mit dem Deutschtum zu erhalten,
verkürzten, auf dieser Weise, durch Presse und Vereinigungen,
die Entfernungen welche sie von ihren Führen, trennten.
Das Deutschtum während der ersten
Republik bis zum ersten Weltkrieg
What
the eye is to the lover - that particular, ordinarily eye he
or she is born with - language - whatever language history has
made his or her mother-tongue - is to the patriot. Through
that language, encountered at mother's knee and parted with
only at the grave, pasts are restored, fellowships are
imagined, and futures dreamed.
Benedict Andersen
Zu derselben Zeit da der Alldeutsche
Verband mit grösserem Eifer in den deutschen Siedlungen
wirkte, beobachtet man das Aufsteigen eines starken
nationalistischen Begriffes in Brasilien, welchen eine
grössere regionale Vollständigkeit verteidigt und die
Gestaltung eines Volkes welches mit den Interessen des Landes
übereinstimmt. Dafür, verlangte man das die Sinnbilder der
neuen Anordnung von der gesamten Bevölkerung einverleibt
werden sollten, Ideen die aber nicht von den Immigranten und
dessen Nachkommen stillschweigend angenommen würden.
Dieser Widerstand kam teilweise durch
die Art wie die Republik, im Jahre 1889, erklärt wurde. Diese
beschränkte sich auf eine Bewegung der Elite, ohne mit einer
bewussten Teilnahme der anderen sozialen Segmente zu rechnen.
Es gab Gegenden die erst nach zwei Monaten erfuhren, dass die
alte Ordnung gestürzt worden war. Ganz besonders, unter den
ärmeren, deutschen Immigranten, bedeutete der Sturz des
Kaisers Dom Pedro II, den Verlust ihres hauptsächlichen
Beschützers, "jetzt aus seiner eigenen Heimat verbannt", nach
den Worten eines Kolonisten aus Lapa
im Staate Paraná.[62]
Für die Immigranten und ihren Nachkommen
der städtischen Mittelklasse, stellte die Republik auch keine
Hilfe im Fortgang ihrer Bewerbung um eine grössere politische
Ergänzung. In diesem Zustand, ging eine grössere Anzahl der
Mitglieder der Partei der Erhaltung zur Republikanischen
Partei über und, da die Deutschen als Monarchisten angesehen
wurden (weil sie der Liberalen Partei, welche die letzten
Ministerien des Kaisertums angehörten) erklärte man sie als
Feinde der neuen Übereinstimmung.
Ganz besonders in Rio Grande do Sul verschlimmerte sich dieser Zustand mit der
föderalistischen Revolution von 1893, von Gaspar Silveiura Martins geführt, welche als
einen der wichtigsten Alliierten den Vertreter der Interessen
der Deutschbrasilianer, den verstorbenen Karl von Koseritz, hatte. Das föderalistische
System zog einen grossen Teil der Immigranten an, weil es sich
der ihrigen traditionellen Organisationen anpasste, welche
eine grössere Vollmacht der Stadtgemeinde voraussah, und weil
sie auch zur Verstärkung der riogrander
Mittelklasse mitwirkte, gegen der Interessen der Oligarchie.
Der Sieg der Republikaner und die Massnahmen welche gegen die
Besiegten entfacht wurden, brachten den Deutschbrasilianern
ernsthafte Enttäuschungen (DREHER, 1984, S. 30 usw.).
Die Rebublikerklärung
brachte nicht nur Enttäuschung, sondern auch einigen Nutzen
für die Immigranten; die Religionsfreiheit und das Recht zur
Einbürgerung, welches Massenhaft angefordert wurde sind
bedeutende Beispiele.[63]
Ausserdem, war des Positivismus Philosophie welche
hauptsächlich unter der Elite von Rio Grande do Sul wichtig war, und nicht das Eingreifen des Staates
in das intellektuelle Leben der Gemeinden erlaubte, somit die
Ausbreitung der Literatur und des Unterrichts in deutscher
Sprache von Seiten der Immigranten förderte.
So wenn auch deutlich von der
institutionellen Politik entfernt, konnten sie ihre Ideen und
Haltungen in Umlauf bringen, welche sich wenigstens im
Stimmrecht äusserten.
Der Positivismus machte sich aber als
Dolch zweier Scheiden, bemerkbar und brachte den Kolonien neue
Probleme. Einerseits förderte er den Laien-Lehre und die freie
Vereinigung, andererseits, bestärkte er durch seinen Antrieb
zum Fortschritt, seine nationalistischen Entwürfe, wodurch er
sich mit dem Ehrgeiz der Integrationisten
welche die Republik ermutigen, vermischte, von welchen, die
Gedanken des Intellektuellen, Pereira Barreto ein gutes Beispiel ist. Nach seiner Meinung, war
es nicht der individuelle Wunsch welcher eine politisch
organisierte Gesellschaft gewährleistete, sondern die
Erziehung der Menge, mit der Anforderung eines
wissenschaftlichen Kriteriums, die wirklichen Förderer des
Fortschrittes:
Ohne eine intellektuelle Vorbereitung
kann man nichts anfangen. Dass sind die Ideen welche die Welt
regieren (...) es genügt nicht, dass ein halbes Dutzend
gleichgestellte Bürger ein grosses Vaterland wünschen, es ist
notwendig, dass die ganze nationale Menge, einig, geschlossen,
zu dem Vorhaben beitrage (...) wir müssen unsere Menge
erziehen, wir müssen sie umbilden. [64]
[65]
Diesen Ideen, die langsam eine grössere
Anhängerzahl unter den ausgebildeten Schichten erreichte,
spürte natürlich den Widerstand der Haltungen des Alldeutscher
Verbandes, welcher die Grundlehre des Grossdeutschlands bis
zum Süden Lateinamerikas ausdehnen wollte. Erfuhr auch den
Widerstand der politischen Kultur der Immigranten, welche
nicht von dieser Nation erzogen werden wollte. Derartige
Widerwärtigkeiten, verstärkten sich bis zum Ausbruch des
zweiten Weltkrieges, sie machten sich bemerkbar mit ihren
Druckschriften, die von verschiedenen Verfassern übersetzt
wurden, je nach des Vorzugsthema: die Erhaltung der deutschen
Sprache und die Pflege des patriotischen Gefühls, beides als
das Zentrum des germanischen Begriffslehre. Dieser Ausdruck,
bis dahin nur zur Bezeichnung der Bürgervereinigung deutscher
Abstammung diente, wurde langsam zum Sinnbild der Völkische
Ideologie übergeben, und verwandelte sich, praktisch in ein
Synonym des Volkstums.
Dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit
zeigt einen organischen Begriff der Gemeinde, wo das Bild der
Familie, des Körpers, des Blutes
nicht nur als ein Vorbild gebraucht werden, aber als das
wesentliche der Wichtigkeit: die Muttersprache, die zum
Beispiel, für dem Einzelnen, dasselbe darstellt wie die Mutter
dem Kinde;
Was gibt du her mit
deiner Sprache Die der die Mutter dargebracht? Hast du die
inhaltsschwere Frage In stiller Stunde schon bedacht? Versuch
es doch in fremdem Laute. Du sagen, was dein Herz bewegt Die
Muttersprache, die kannte. Kann heben, was dein Busen hegt.
(KDB, 1907. S. 42)
Der Schriftsteller Hans Tolten versetzt sich im dieser
familiären Einheit um seine Sehnsucht nach der Heimat, weiche
er nicht kennlernte:
Die Sehnsucht die meine Mutter nach der Heimat
hatte war so gross und wurde mir so lebhaft erzählt: sodass
ich mich in meiner Phantasie viel näher der entfernen Heimat,
als in der heutigen Welt in der ich bin, fühlte. (TOLTEN,
1934, S. 12)
Oder, in der mehr pädagogischen Form,
empfehlt Rotermund,
Sowie jede Familie seine Tugend und
Fehler hat, so ist es auch mit dem Volk; jedes hat sein
Volkstum und es ist besser für alle, wenn sie sich getrennt
verhalten. (KDB, 1923, s. 17)
Gleichzeitig mit dieser fast passionellen und religiösen Sprache,
kann man noch eine ganze Anzahl Schriften beobachten, die
dieselbe Tendenz haben, aber eine andere Schreibart haben. Das
bevorzugte geistige Wesen ist nicht mehr der Immigrant, aber
die aufnehmende Gesellschaft; wenn auch die Sprache im Umlauf
sei es die Deutsche, semiotisiert
eine Erörterung mit dem anderen, um die Leser auf verständiger
Weise einzuleiten um ihre Überzeugungen zu verteidigen. Zu
diesem Zwecke, richtet sie sich in einer verteidigenden
Sprache grundlegend im Recht gesichert. Widersetzt sich dem jus solis, in Brasilien üblich, dem jus sanguinis, ihrer eigenen Tradition, im Namen ihrer
Vorläufer welche eine Polemik beginnen, die sich nur mit dem
Ausbruch des zweiten Weltkrieges beendet.
Dieses Prinzip erlaubt ihnen einen
Begriff der Gesellschaft, in welcher sie leben, die in
verschiedenen Ethnien geteilt, folglich in verschiedene
Nationalitäten, geteilt ist. In dieser Auseinandersetzung,
wird die überlegene Bevölkerung der empfangenden Gesellschaft,
von Ihnen die anderen ausschliesst, sondern auch ihren
historischen Charakter als die Beherrschende, beweist.
Charakterisiert man sie als ihre hauptsächlichsten Gegner,
erklärt sie ungeeignet als Müssiggänger, zur Vermischung
Tendenz geneigt, Verdorbene und Sklavenführer, wenn auch
gastfreundlich und sentimental, in Hinsicht auf die anderen
Gruppen, gewähren sie ihnen das Recht auf die Erhaltung ihrer
Kultur, wenn sie sich nicht untereinander vermischen.
Für sie, die Schöpfer der brasilianischen
Kultur,
gab es nur die
Möglichkeit, den ethnischen Pluralismus anzunehmen, denn alle
Völker, organisch vereint, hatten das Recht einer freien
Ausdrucksweise. Sie teilten den Beweisgrund, dass Brasilien
keine Nation bildete, gemäss dem romantischen Sinn dieses
Wortes, weil es aus verschiedenen Kulturen zusammengestellt
war. Wenn diese Vermischung sich verwirklichte, würden sie
ihre allerbesten ursprünglichen Charakteristiken einbüssen.
Dieser Rassismus noch in der zusammengestellten Form und diese
Notwendigkeit den anderen auszuschliessen, um die eigene,
innere Ordnung zu bewahren, schuldet sehr viel den
Betrachtungen des Alldeutscher Verbandes. Aber, wenn wir diese
Schriften zum zweiten Mal durchlesen, erlaubt es uns zu
entschliessen, dass sie einen anderen Konflikt erkennen
lassen, welche sich auf die politische Erfahrung des
Leserpublikums bezieht. Nach fast hundert Jahren ihrer
Einwanderung, offenbarten ihre Erinnerungen eine Regierung,
welche ihre Ländereien enteignete, [66]
schränkte ihre religiöse Bekanntmachungen ein, welche eine
verdächtige Verwaltung hatte, wenn es sich um die Erfüllung
ihrer politischen Kompromisse, handelte, ihrer Meinung nach,
Ist Brasilien nicht fähig eine
Verwaltung die das wirtschaftliche Recht und Sicheren gewährt,
ebenso nicht den Strassenbau zu dem Handel unserer Produkte
vollzieht. (Deutsche Zeitung. 1906)
Über diese Regierung erklärte sie
scherzhaft,
Wie wimmeln, die Taugenichtse und
Räuber, diese welche wir in Deutsch als Soldaten nennen, die
das Vaterland verteidigen sollten (...) die Jünglinge werden
verhaftet, die grossen Räuber laufen frei herum, und haben
sogar prächtige Titel (...) wir haben drei Parteien, welch ein
Elend! Diese verbittern uns das Leben, und Schulden und
Schulden. (Brasilien) sie saugen deine Staatkasse, aus
gänzlich aus, du wirst zu dem Abgrund geführt. (Deutsche Post.
1886)
Im Gegenteil, zu diesem Zustand, der
andere, von der Nation aus erneuert, bot er ihnen ein
Disziplin-Modell an, Ordnung und Fortschritt, ausser der
Gleichartigkeit vom Gesichtspunkt aus, weil laut der
Wirkungskraft des jus sangüinis der Staat das Bürgerrecht an Ausländer
verweigerte, andererseits aber sie, ab 1893 annahm, als Bürger
des Reiches. [67]
Dieser sich steigernde Patriotismus verführt sie und treibt
sie an, um sich an einem Krieg zu beteiligen, zu welchem sie
auch, durch die Propaganda, aufgerufen wurden.
Das Deutschtum
in der Öffentlichkeit: der Krieg 1917
Als der erste Weltkrieg in Europa
erklärt wurde, kam eine Zusammenberufung, durch eine
Zeitungsanzeige, der "Deutsche Zeitung", 1914 an alle im
Rückhalt lebende Deutschen in Brasilien um, eine sofortige
Rückreise in ihre Heimat anzutreten, und sich in ihrem
militärischen Bezirk angehörten, wurden angefordert mit ihren
Gütern, dem Rotem Kreuz beizusteuern oder durch den Auskauf
der Kriegesbonusse zu helfen
(LUEBKE, 1987, S. 86-87). In den protestantischen
Gottesdiensten, wurden Gebete zugunsten des Kaisers und des
Sieges für Deutschland, erhoben, es wurde auch die Fürbitte
für die Soldaten, die Familienglieder und Freunde im
Heimatland, ausgesprochen (DREHER, 1984). Durch das Auswärtige
Amt, welches ab 1901 eine
telegraphische Nachrichtenvermittlung direkt aus Deutschland
nach Brasilien, die Zahl der Niederschläge, der Eroberungen
und der Betrachtungen der offiziellen Obrigkeiten wurden durch
die deutschbrasilianische Presse bekannt gegeben (BRUNN, 1971,
S. 177).
Wenn auch bis 1917 Brasilien eine
neutrale, offizielle Politik bewahrte, wurden doch in der
Presse portugiesischer Sprache, den Alliierten Sympathien
entgegengebracht, es wurden oftmals Abscheulichkeiten, die
gegen Kriegsgefangene, Kindern und Frauen von Seiten der
Gegner verübt wurden, preisgegeben. Um sich diesen Angriffen
zu widersetzen, radikalisiert die Presse in deutscher Sprache,
sowohl die liberale wie auch die konservative ihren Diskurs,
im Namen der Einheit des Deutschtums, und klagte die Franzosen
als verantwortlich für die Verbreitung dieser Verleumdungen
ihres Vaterlandes an. Diese leidenschaftlichen Behauptungen
verursachten, unter anderem, dass die Mitglieder der
Turnvereine und der Freischützvereine den Gebrauch der ersten
Person des Verbplurals machten, wenn sie sich auf Deutschland
oder auf den Krieg bezogen.
Die Evangelische Kirche beriete die
Deutschen, dass sie keine Geschäftshandlungen mit denjenigen
die sich den Alliierten zugeneigt zeigten, erledigen sollten,
und in einem Moment der äusserten Erregung, der Pfarrer
Rotermund Erforschungen unternimmt über die Bewegung welche zu
dem Gebrauch der portugiesischen Sprache verpflichtet, warum
beginnen die Brasilianer nicht mit dem erlenen der deutschen
Sprache, wenn sie doch gewillt sind, sich mit den Ihrigen zu
verständigen (...) (LUEBKE, 1987, S. 93)
Die Katholische Kirche, wenn sie auch
ihre traditionelle Mässigung bewahrt, fordern die Unschuld
ihrer Getreuen, obgleich sie ihnen empfiehl, nicht die
deutsche Sprache öffentlich zu benützen (Der Kompass,
14/02/1915).
Zur Zeit 1915, wurde der
Alliiertenverband in Brasilien gegründet, und später, der Liga
da Defesa Nacional
- LDN (Verband der Nationalen Verteidigung),
ultra-nationalistische Vereine, von Intellektuellen wie Ruy Barbosa, Olavo Bilac, Jose Verissimo und Graga
Aranha geleitet.
Zum Gegensatz, wird 1916 der
"Germanische Bund" gegründet. Verband der 6.000 Mitglieder
besass und vorgab mit dem "Deutschen Rotem Kreuz" verbunden zu
sein, welcher aber, in der Wirklichkeit, zum Schutze der
Handels-geschäfte seiner Mitglieder, diente, zur Hilfsarbeit
der deutschsprachigen Schulen und zur Förderung der
Kriegspropaganda. Dieser Verband bestand ausschliesslich aus
Journalisten, Pfarrern und Geschäftsmännern, die sich um die
Zukunft ihrer Unternehmen sorgten, sollte Deutschland besiegt
werden.
Mit der Entwicklung dieser Konflikte,
konnte man eine Verrückung des Kriegsfeldes, von Europa nach
Brasilien beobachten, zum Teil, wegen der Streikausbrüche
begünstigt, welche von den Bewegungen der sozialistischen und
anarchistischen Tendenz den hauptsächlichen Städten gefördert
wurden.
Im Februar des Jahres 1917 brachten die
Zeitungen, dass die Überfälle und Diebstähle an den Läden und
Anstalten der Deutschen, mit aller Gewissheit, verübt werden,
als Vorbeugungsmassnahme, im Hinblick eines möglichen Angriffs
Deutschlands. Die immer zunehmende Verbreitung der Existenz
des Deutschtums und ihren wichtigsten Absichten, wie auch die
Entdeckung von Spionen, in den grössten Hauptstädten der
Staaten.
Als am 5. April dieses selben Jahres,
das Handelsschiff "Paraná", an der französischen Küste, von
den Kriegsschiffen des Reiches bombardiert wurde, bricht die
brasilianische Regierung die diplomatischen Beziehungen zu
Deutschland ab, und dann in Oktober, infolge des zunehmenden
Gedränges Seitens der Alliierten und der LDN, sich entscheiden
um Deutschland den Krieg zu erklären. Von da ab,
vervielfachten sich die Angriffe und offenbarten sich die
Marienfeste und verbreiteten sich die Geringschätzungen,
beiderseits und der Immigrant wurde das Ziel der Konflikte,
man sah in ihm (was ja schon immer in verbogene Art war) den
ausländischen Feind.
Die "Deutsche Zeitung" kritisiert die
Regierung, in dem sie behauptet, dass diese, die Verfassung
nicht berücksichtigt wurde, denn laut der Gesetze, kann die
Kriegserklärung nur im Falle eines Angriffes vollzogen werden.
Gleich darauf, wurde die Zeitung von der Menge zerstört, und
etwas später, wurde ihr Umlauf verboten.
Die Schützenvereine wurden als
Kriegsorganisationen verklagt, welche im Verborgenen planten,
sich den Gegner zu alliieren, um die Trennung des Süden
Brasiliens und sein Einschluss an den feindlichen Staat, zu
erreichen. Zu dieser vorausgesetzten Verschwörung, im Namen
der Verteidigung des vaterländischen Gebietes, wurden das
Hotel Schmidt und die Firma Bömberg,
zwei der wichtigsten Niederlassungen, aus der wohlhabenden riogrander Gesellschaft, in Brand
gesteckt, unter dem Vorwand, dass die Immigranten dort Waffen
und Kriegsbedürfnisse, für ihre Landsmänner, aufbewahrten.
In dieser gleichen Konjunktur,
organisiert die LDN- Ortsgruppe Paraná, von dem Verfahren der
Gegner begeistert, den Schützenverein, und, zusammenhängende
zu diesem Antragsrecht, verbreitet er Bücher, wie zum
Beispiel: "Verehrung des militärischen und bürgerlichen
Heroismus", "Die Wichtigkeit des Sportes im nationalen Leben",
"Vaterlands-Idee" und andere. (Curitiba, Diário da
Tarde, 17- 7-17). Die Deutschen wurden auch
als diejenigen, welche das Bild des brasilianischen Volkes
beschmutzten angeklagt, in dem sie, in Deutschlands Zeitungen
dieselben als barfüssige und zerlumpte Mulatten bezeichnen,
unfähig um als Sieger zu bestehen. (São Paulo, A Plateia, 13-8-17).
In São Paulo, organisieren die Studenten
der Rechts-Fakultät São Francisco, eine Veröffentlichung, in
der sie die Ungültigmachung des exequatur welche
allen deutschen Botschaften bewilligt war. (São Paulo, O Combate, 11-4-17). In dieser selben Zeitung,
veröffentlicht man, Wasserbehälter der Stadt Porto Alegres,
vergiftet hatten, als eine kriminale Taktik eines Volksmordes
(2-5-17).Die deutschsprachigen Schulen wurden verdächtigt, und
unzählige Artikel flössen Urteile, wie diese, ein:
Wenn auch von weither, die Einwendungen
gegen den Missbrauch des Unterrichts der deutschen Sprache im
unserem Land kommen, Unternehmen welches auf eine geschickte
Art gemacht wird, um die Germanisierung Brasiliens zu
erreichen, versucht man, erst jetzt, dieses Übel zu bekämpfen,
was bis hier, nur als Eingebung zur Vorsicht gegen das was in
Santa Catarina vorging, verlangt wurde; jetzt aber,
weiss man schon das die satanische Arbeit der Deutschen
eifrig, in allen Orten, ist (...) sie singen täglich drei
Lieder in deutscher Sprache, es gibt nichts besseres, keine
eingehende Propaganda, mit doppelten Erfolg: einerseits
germanisieren sich die Kinder, denn sie haben durch die Lieder
das Bild der elterlichen Heimat vor sich, andererseits
verlieren sie die Zuneigung zum wirklichen Vaterland. (São
Paulo. A
Platáia. 2-11-17)
Umwendungen wie diese stiften den Unwillen der
verschiedensten sozialen Schichten, welche vom Unwillen zum
Hass auf das Bild des Deutschen wird, und sieht in ihm, eine
erbliche Neigung zur Angriffslust.
Zur Repressalie jedes Falles Seitens der
Alliierten, ob er gut oder schlecht ausging, erhebt sich eine
Welle von Zerstörungen, Volksversammlungen und Propaganda in
den wichtigsten Städten des Südens und des Südwestens des
Landes. In der Hauptstadt Paranás, zum Beispiel, organisiert
das Volk einen Aufmarsch unter den Tönen der National-Hymne
und die Marseillaise, bewegt sich vom Zentrum der Stadt aus
bis zum Deutschen Verein Thalia, zieht die Nationalfahne auf
und entfernt Bilder wie das, des Wilhelm II und des Bismarcks.
Nachdem, begibt es sich zum
Deutschbrasilianischen Turnverein, wo:
wenn auch mit Widerstand von Seiten einiger
Mitglieder (...) ohne Wanken zieht die Menge weiter und in
wenigen Augenblicken, sind alle Abteilung des deutschen
Vereins eingekommen, sie entfernt das Bild des Kaisers (...)
verlässt den Verein die deutsche Fahne hinter sich herziehend
(...) im Hauer Theater (...) werden Gegenstände zerstört und
dann verlangte die Menge die deutsche Fahne (...) in den
Strassen zerstört Bilder und Gegenstände (...) Nachdem wird
noch die katholische Zeitung "Der Kompass in Brand gesetzt und
während der Flammen emporsteigen, zerstörte die Menge, unter
gerechten Wutausbrüchen, die Druckerei. (Curitiba, O
Commercio
do
Paraná, 30-10-17).
Während solcher Volksversammlungen,
wurden die Deutschen verklagt, die Anarchistenbewegungen
der Italiener in São Paulo einschliesslich zu fördern, weil
sie auf dieser Art die Regierung ins Wanken brachten und somit
mit Leichtigkeit ihre Herrschaft einsetzen könnten, eine
"Anklage" welche eine ironische Wiederfindung einiger der
Anklagen die als Ziel die Juden, in "Die Protokolle der Wesen aus Zion".
Eine banale Verletzung in Curitiba, eines Deutschstämmigen welcher ein Kinder auf der
Strasse aus nicht bekannten Gründen schlug, wird von der
Presse auf eindrucksvoller Art so ausgelegt:
Es ist nötig dass dieser böse Deutsche
die Folgen seiner mit raffinierten Bosheit ausgeübten Handlung
spüre (...) denn, der grausame Deutsche, dem es nicht gegönnt
ist sich an unserem Volke zu rächen, seine Rache an einem
unbeholfenen Kinde, über welchem er seine ganze Wut
ausschüttet (...) Er, in dem er dieser unglückliche Kind
brutal misshandelt, griff er unsere Volkswürde an (...) dieser
Schmerz der uns durch diesen Einzelfall zugefügt wurde, kann
man die Marter der gegen VuoIker
durch den deutschen Vandalismus schätzen. Derweil wir hier den
Tag des Kindes ehren, gibt der Deutsche seinen Gefühlen, einer
eingesperrten Hyäne und eines wilden Tieres, lauf. (Curitiba, Diário
da Tarde, 27-11-17)
Wenn die Teilnahme der Gesellschaft zahlenmässig
auch ausdrucksvoll ist und ihrer Reaktion, unverhältnismässig
in Beziehung auf die wirklichen Begebenheiten, von Seiten der
offiziellen Obrigkeiten, sind die Massnahmen mittelmässig, in
einige Fällen, vermittelnd. Ab den 5. Oktober verbiet man den
Gebrauch der deutschen Sprache in den Schulen Santa Catarinas, Massnahme die sehr schwer kontrolliert werden
konnte, denn es gab schon zu der Zeit' mehr als hundert
Schulen; andererseits wurden die Aufstände vermieden, weil ja
einige Volksobrigkeiten (der Statthalter Felipe Schmidt,
Vetter des Lauro Müller, eingeschlossen) sind deutscher
Abstammung. Weil die Zahl der Deutschstämmigen in
verschiedenen Städten des Staates sehr gross ist, beschränkten
sich die Bewegungen in der Ausführung von Versammlungen in
Florianópolis, Stadt welche die geringe Zahl der
Deutschstämmigen hatte, oder noch mit ausdruckslosen
Aufmärschen. In Rio Grande do
Sul, empfiehlt der
Gouverneur Borges de Medeiros, nur die
Einschaltung der portugiesischen Sprache, der brasilianischen
Geschichte und Geographie in den über 700
deutsch-brasilianischen Schulen. Die Polizei Porto Alegres und
Curitibas ihrerseits verlangten die Einschreibung der
Deutschen des Reiches, wenn auch diese Massnahmen keine
wesentliche Folgerung hatten. Als die Presse, den Streik im
Santa Maria, als angeblich von Deutschen angeführt, berichtet,
verteidigt der Gouverneur die Streikenden und behauptet, dass
ihre Anforderungen um bessere Löhne berechtigt waren. Die
Erschaffung oder Strenge der Untersuchungen die in Verbindung
mit der Anklage gegen die Deutschen oder auch die Aufträge zur
Entschädigung der Verluste welche sie mit der Verwüstung ihrer
Niederlassungen erlitten, veränderten sich, denn sie waren
vielmehr von der isolierten Initiative der Polizeibeamte
abhängig, welche nach ihren eigenen Meinungen handelten, als
von einer vorher geplanten offiziellen Politik.
Von der Bundes-Regierung aus, der
symbolische Entlassung des Ministers des Auswärtigen Amts
Lauro Müller, weil er ein Deutschstämmiger war, vollzieht sich
nur in Hinsicht auf den Druck welcher von der Presse und dem
Parlament ausging. Der Präsident Wenceslau
Braz erhielt zufriedenstellend seine Beziehungen zur deutschen
Regierung, und nur im Jahre 1917 als der offizielle Bruch mit
Deutschland sich verwirklichte, wurde die "Schwarze Liste" die
von den Alliierten aufgestellt wurde, in Brasilien ausgeführt.
Diese Liste verbot die wirtschaftlichen Verhandlungen mit
gewissen deutschen Firmen. Die Feierlichkeiten die zur Tagung
der protestantischen Reformation veranstaltet wurden, wie auch
Volksbewegungen zu Gunsten des Reiches, erhielten Verbot.
Ebenso der Umlauf der deutschen Zeitungen, Massnahme die sich
aber erst vollzog, als die Gesellschaft verschiedener Zentrums
Brand-stiftung, Boykotts und Zerstörungen verursachte.
Schon im Jahre 1918, Beendigung des
Krieges, wurden derartige Verbotsmassnahmen eingestellt, und,
diejenigen Vereinigungen und periodische Schriften, welche
diesen Aufruhr überlebten, nehmen wieder ihre Tätigkeit auf.
Wenn die offiziellen Obrigkeiten, selbst
bei der Kriegserklärung, nicht radikale Strafen an diese
Deutschstämmigen ausübten, will es nicht heissen, dass eine
erstaunende hemmende Macht ausser Sicht wäre. Im Gegenteil,
das eingebildete Verständnis derer Ereignisse, ihr sozialer
Gebrauch an die verschiedensten Organisationen, die sich mit Unterbrechungen Nachrichtenverbreitung,
ob falsche oder nicht, welche die Deutschen und ihre
Unternehmungen betrafen, liefen von einem Ende zu anderen die
brasilianische Gesellschaft, und verwandelten die Immigranten
in Ausländer, im wahren Sinne des Wortes. Sie wurden als
Ausgeschlossene angesehen, die nur den Gesetzen und der
Interessen der Obrigkeiten unterworfen waren, denen man eine
furchteinjagende und heimliche Macht zuschrieb.
Urheber einer verderblichen
Verschwörung, Erzeuger neuer Möglichkeiten die von einer
einfachen Ordnungsstörung bis zu der Vergiftung der
Bevölkerung ging, falsche Menschen, die sich wie grausame
Tiere, von biologisch-bedingten Männern abstammend, die zum
Angriff neigen, sind die Bestimmungen und Abbildungen, die
einen Prozess der Dämonisierung des Gegners entlarven, dessen
Macht nur zerstört werden kann durch die Macht Gottes.
Als wir dieses irremachende kollektive
Klima bemerkten und die darauffolgenden Ereignisse forschen,
sind wir geneigt, wie auch Girardet, zu analysieren, über
diese Wünsche welche der Grund, mehr oder weniger unbewusst,
einer Erzeugung des Mythos der Verschwörung, und in diesem
besonderen Falle, des Immigranten wie eines Menschen unter
Verdacht oder, in seinen Grenzen, und für beiden Seiten
gültig, des Anderen als unerträglich, zu erforschen:
Die Macht welche man dem Feind zusagt,
ist sie nicht dieselbe die man sich in Träume erwünscht? Diese
sich immer mehr ausbreitende Fähigkeit der sozialen Kontrolle,
diese Herrschaft der Ereignisse und der Geister, welche er
vorausgesetzt ausübt. stimmen die nicht überein mit dieser
Herrschaftsart welche zu Diensten ihrer eigenen
Angelegenheiten erfordert wird? Diese Eigenschaft die man dem
Feind als bestimmenden Urheber der Geschichte und der die man
erzeugt, ist es nicht dieselbe, dessen man tragisch die
Enttäuschung spürt? (GIRARDET. 1987. S. 62)
Ruy Barbosa,
einer der Leitenden der Liga
da Defesa Nacional
- LDN, erklärt dass dieser Krieg wahrlich ein Konflikt des
Guten gegen das Böse war. Als die Deutschen besiegt wurden,
unter den Siegern, wäre das verstärkte patriotische Gefühl
unter den Brasilianern,
spürbar, was wenn auch indirekter Weise mitwirken
würde, um die abgesonderten Interessen zu schwächen, stets als
Feind der nationalen Einheit, angesehen. Andererseits, die
gedemütigten und besiegten Deutschen, würden sich wenn auch
symbolisch, als aus diesem Lande vertrieben fühlen und somit
sich eine Heimkehr wünschten.
Dem Brasilianischen Staat, Treue; dem
deutschen Volk, Liebe!
Karl Heinrich Oberacker
Verdammt das Volk welches ein anderes
Volk unterjocht
Ernst Moritz Arndt
In den Anekdoten des Kalenders "Der neue
hinkende Teufel", reizt man die Leser zum Lachen an und damit,
erweckt man den Zweifel über jegliche Machtform.
Sellin, gemässigter in seinen
Beziehungen zu der Öffentlichkeit, beschäftigt sich, in dem er
die brasilianische Regierung und ihr wirklichen Vorhaben, mit
der Propaganda, welche die "Neue Welt" betrifft, anklagt.
Dörffel, ein pragmatischer Verwalter, teilte
Berichte aus an denen die aus ihrem Heimatland auswandern
wollten, und versprach gleichzeitig, dass er ihnen stets zur
Seite stehen würde, sobald sich die ersten Schwierigkeiten
zeigen sollten.
Koseritz reist viel, und bringt in seinen
Erfahrungen, verschiedene Kenntnisse, unter denen, Gedanken
der Aufklärung und seine Eindrücke über die brasilianische
Politik sind die meist gebrauchten, mit der Absicht den Lesern
kleine und grosse Überzeugungen einzuprägen, welche den
Lesern, zur Bildung ihrer politischen Kultur, verhelfen
sollte, notwendige Waffe um ihre Vollberechtigung zu sichern,
derweil sie verminderte Bürger waren.
Rotermund bereist nur die nahliegenden Orte
seiner Stadt, São Leopoldo, wo er sich mit seinen Pfarren
trifft; versucht sie anzuhören und zu schützen, wie es jeder
gute Pfarrer mit seiner Heerde macht. Verteidigt sie in den
Stunden der Gefahr, ebenso in den Augenblicken in denen man
ihnen mit dem Tode droht oder noch in der Uneinigkeit.
Die Pangermanisten, Romantiker oder
Pragmatiker, rufen ihnen immer ins Gedächtnis, dass ihre
Gesprächsführer Deutsche sind, nicht nur das, sondern dass sie
einem anderen Volk angehören, als ob sie ewige Gäste eines
fremden Gebiets wären.
Diese Männer verliehen ihren Reden einen
bestimmten fortdauernden Charakter, denn sie wurden in Bücher
und periodischen Schriften veräussert, welche sich zu
hauptsächlichen Zeugen ihrer Geschichte verwandelten. Sie
wirkten auch dazu, dass der Gebrauch der deutschen Sprache,
sich als die bevorzugte Sprache erhalten blieb, steuerten noch
zur Säkularisation der Gewohnheit des Lesens, sei sie als
Zeitvertreib oder als Richtlinie ihrer Taten und Wirkungen.
Trotz ihrer internen Unterschiede, das
verlängerte Vorhandensein solcher Schriften, zeigte sich als
Verstärkung einer bestimmten kollektive Identität welche sich,
nach Hannah Arendt Meinung (1978), als ein
Stammnationalismus zeigt. Es handelt sich um eine romantische
Ausarbeitung der Vergangenheit, die von Schriftsteller wie
Herder, Jahn und Arndt geschrieben, welche in Nationsbegriff
eine Sinnesverbindung mit der Kenntnis des Clans sahen, dessen
Ursprung sich in der entferntesten Vergangenheit erhebt und
deren ursprünglichen Familie die Heimat und die Muttersprache
waren.
Die Freidenker, wie schon hervorgehoben
wurden, entstammen nicht aus den wohlhabenden Schichten des
Volkes, und wollten die Volksklassen vertreten und sie
belehren zu Gunsten einer Resistenz der französischen
Oberherrschaft und der Aristokratie ihres eigenen Vaterlandes.
Solche Gefühle und Handlungen kamen durch jene
Veröffentlichungen zu den Immigranten, Menschen die zwischen
zwei Welten lebten, jene die sie verliessen und diese welche
sie als die ihrige anerkennen würden. Diesen Menschen, war die
Anhänglichkeit, nicht nur das idyllische Bild der
Vergangenheit, sondern auch die Quelle der Kraft gegen ihre
materiellen oder psychologischen Enttäuschungen.[68]
Ausserdem, bezogen sie vielleicht die
einzig möglichen Solidarverhältnisse dieses Universums zu
einer neuen und Isolierten Gegend, in derer es leichter wäre
mit dem Beistand ihrer Landsmänner zu können, als mit den
anderen Gliedern der Gesellschaft, wo die Kontakte sich
oftmals mit der Regierung und der Gesetze vollzogen.
Als die ernstlichen Konflikte mit der
au/nehmenden Gesellschaft und den Immigranten sich in einer
beleidigenden Form zeigt, welche durch "die deutsche Gefahr"
und des ersten Weltkrieges hervorgerufen wird, diese Haltungen
und Sprachen verwandeln sich in einem wortbrüchigen Effekt, wo
jetzt, die Betrachtungen des Alldeutscher Verbandes eine
erhobene Rolle erfüllen.
In diesem Zusammenhang, wirkt sich die
rassistische Lehre als eine Waffe gegen Mischehen aus,
gleichfalls auch als eine Reaktion gegen die Bedingung der
Untergebenheit. Die Unterstützung des Kaisertums an die
Deutschen während des Krieges, von dem Verband beansprucht,
erweckt in den Eifrigsten, den Traum einer Sezession und in
den Brasilianern, das Misstrauen, dass ihre Verdächtigungen
sich bewahrheiten. Die Sprache wird nicht mehr als eine
Verbindungsmöglichkeit erhalten, verwandelt sich aber als ein
Sinnbild des Widerstandes zur herrschenden Kultur. Die
Existenz zweier Geschichten zu einer selben Gegend, offenbart
schliesslich den Konflikt zwischen zwei Begriffen des
Nationalismus: der Erste, der republikanischen Elite, welcher
sich in die Zukunft schleuderte, und eine Nation angab welche
der Gesellschaft, die historischen Möglichkeiten ihres eigenen
Aufbaus, eröffnete; der Zweite, der Immigranten, welche sich in die
Vergangenheit schleuderte, und veranlasste, dass die
Geschichte die Ausdehnung einer Fabel annahm. In diesen
Konflikten, wenn sie vergründlicht
werden, kann man einige Anzeichen bemerken, der
Zerbrechlichkeit der Utopien welche das harmonische
Zusammenleben der Verschiedenen ersuchten, und die Politik als
ein bevorzugtes Bühnenbild des rationalen Diskurses ansahen.
IV DAS DEUTSCHTUM UND DER NATIONALSOZIALISMUS
Ich sehe im Nationalsozialismus ... die
erste und bisher einzige echte demokratische Bewegung des
deutschen Volkes. Wir kennen nur ein Interesse, und das ist
das unseres eigenen Volkes.
Adolf Hitler
Das Jahr 1918 besitzt, für die
europäische Geschichte, eine viel tiefere Bedeutung als das
Ende des ersten Krieges. Das ist die Periode in welcher neue
Staaten gebildet werden und die Grenzen der verschiedenen
Länder abgesteckt werden.
Für einige Wissenschaftler, wie zum
Beispiel, Joachim Fest (1976), das Ende des Krieges stellt
einen entscheidenden Moment für das demokratische Ideal, dar;
einerseits, weil zehn neue Republiken eingesetzt werden, und
gliedern sich an die drei Einzigen die vor 1914 existierten,
und, andererseits, selbst im Innern der monarchischen Staaten,
zeigte sich die Tendenz zur Demokratisierung, allgemein.
Die anderweitigen Jahre zeigten,
unterdessen, dass solch eine Entwicklung nicht gegen die Bürde
ihrer eigenen Vergangenheit standhalten würde. Nach Meinung
Karl Brachere (1973, S. 96 u. w),
hat der erste Krieg eine Reihe von demokratischen Bewegungen,
entfesselt, aber auch gleichzeitig, den Abgangspunkt zu ihrer
Widerrede. Es sind Gegenbewegungen, die das System in Länder
wie Russland, Ungarn, Polen, Italien, Österreich, Spanien und
Portugal bedrohten und selbst das politische Gleichgewicht
Englands und Frankreichs drohen.
In dieser Hinsicht, die Konjunktur
welche der nationalsozialistische Macht-ergreifung vorangeht,
kann als ein Beispiel der Gestaltung dieses Prozesses
angesehen werden. Er verkleidet sich, aber, in äusserst
wichtige Sonderheiten, welche sich durch die politische und
kulturelle Entwicklung, von welcher Deutschland die Erbin ist,
erklären lässt, wie auch durch seine wirtschaftliche und
militärische Niederlage.
Der Versailler Vertrages verstümmelte
jenes Land in verschiedene Gebiete, beraubte es seiner
Kolonien und bürdete ihm eine grosse Ersetzungsschuld auf,
Bürde welche die wirtschaftliche Wiedererlangung beschwerte.
Andererseits brachte der Krieg die Entsittlichung des Kaisers
und seinen Anhängern, und verursachte in den letzten Monaten,
die interne Ordnung des Heeres.
Um der externen Politik welche von den
Alliierten vorgezeichnet war zu antworten, und den sozialen
und psychologischen Schaden der Bürger zu überwinden,
verkündet die Verfassung ein neues Staatsgesetz, mit
republikanischen demokratischen und parlamentarischen
Charakter, wenn auch, der Unterschied, im Hinsicht auf andere
Staatsverwaltungen, wie diese, sagte man dem Präsidenten eine
viel grössere Macht zu, wie die der Ernennung und der
Entlassung des Kanzlers, den Staat im Ausland zu vertreten,
den Reichstag aufzulösen, und die Führung in ausnehmenden
Situationen zu übernehmen (GAY, 1978, S. 169).
Die sozialdemokratische Partei, (SPD),
die schon die grösste Zusammenschliessung vor des Kriegende
war, übernahm schliesslich die Führung der institutionellen
Politik, in der Koalition mit den Demokraten, eine Wahltendenz
die, mit wenigen Ausnahmen, bis 1932 verblieb. Trotzdem,
widerspiegelte diese Vertretung nicht das dauerhafte und
hegemonische Bild, dar; ausser den Spannungen die im Innern
der Linken existierten und in der eigenen Partei, eine Reihe
von Bewegungen der ausser Parlamentarischen Opposition, wie
auch das Entstehen verschiedener anti-republikanischen und
nationalistischen Parteien, bereiten ein Klima mit internen
Gewalttaten und Intoleranz mit Hinsicht auf die auswärtige
Politik.
Weimar lässt sich, nach Gay's Meinung,
über eine kosmopolitische, humanistische und friedenfertige
Kultur, nieder, eine Sammlung ethischen und politischen Werte
die, wenn auch, in den Augen der Verfasser waren den Erben des
II. Reiches, fremd; der Nationalismus auf den völkischen
Prinzip begründet, die Beschlagnahme des Status der grossen,
imperialistischen Macht und Verteidigung eines starken
Staates, modern und gut ausgestaltet, ableitend von der
Modernisierung anderer Institutionen, bildeten sich noch
Wünsche der bürgerlichen Gesellschaft.
Aus diesen Gründen, wurden die Lichter
welche die Intellektuellen und Künstler Weimars, entfachten,
langsam verfinstert durch eine pessimistische Welle und ein
Gefühl der moralischen und psychologischen
Niedergeschlagenheit, welche den Wunsch zur Rache,
Nonkonformismus und Nostalgie entfachte.
Diese Bewegungen wurden von unzähligen
Vereinigungen unterhalten, welche aus kleinen Bürgern
bestanden und sich von einer Proletarisierung bedroht fühlten,
Geschäftsmänner und gewesene Kämpfer die sich, in Hinsicht
auf, mehr oder weniger politische, mehr oder weniger
bestimmte, mehr oder weniger erklärte, mehr oder weniger (von
ihnen selbst) bekannte verschiedene Ziele, organisierten. Die
Mitglieder der Bewegungen stammten aus den Übrigen der
Parteien die vor dem Kriege existierten, oder, in vielen
Fällen, waren es Menschen die bis hierher sich nie der Politik
zugewandt hatten. Nach der Meinung Joachim Fests (1976, s.
101), gab es nur in München, in Jahre 1919, fast 50
Vereinigungen mit diesem Charakter, unter den Namen Patria
Nova (Neue
Heimat), Conselho do
Trabalho espiritual (Rat der Geistigen Arbeit), "Siegfriedring", Liga
Universal
(Universal-Verband), Associação
Livre dos Estudantes Sociais (Die freie Vereinigung der sozialen Studenten),
Liga
Social Feminina (Sozialer Frauen-Verband), Liga
Ostara (Ostara-
Verband). Nach seiner Meinung, sein einziger Hauptnenner war
ein tiefes Angstgefühl. Diese Menschen fühlten sich gedemütigt
im internationalen Plan, durch der Versailler Vertrages und,
in internen Plan verspürten sie eine riesengrosse Angst wegen
der revolutionären Bewegungen, welche sich dort zeigten, sahen
in ihnen ein Symptom der russischen Revolution - welche sie
und auch die Juden bedrohte, diese von allen Völkern als eine
feindliche Rasse angesehen wurden. Laut Annelise Thimme
(1969), wollten diese nicht als Lakaien der Junkers angesehen
werden, Gruppe die gemeinschaftlich mit den Intellektuellen
der Linken sie von Oben herab bedrohten.1 Auf diese
Art, schrieb man die Schuld der persönlichen und kollektiven
Niederlage den Bolschewismus und den Juden zu, gegen diese
mussten sie, in ihrer Gebrechlichkeit, wenigstens,
protestieren. [69]
Diese Vereinigungen unterstützten
Bewegungen, die sich rühmten hoch über die politischen
Parteien zu stehen, diese waren, im Übermass, mit der
Dürftigkeit der Klasseninteressen verpflichtet (ARENDT, 1978,
S. 329 u. w.). Und diese Vereinigungen lieferten auch eine
ansehnliche Zahl neuer Anhänger und neuer Ideen der
pangermanistischen Angelegenheit.
Nach der Meinung Hannah Arendt,
(1978, S. 338 u. w.), für die Leiter des
Alldeutschenverbandes, die Vorteile der Bewegung über die
Partei, lag darin, dass er der bestimmte Grund der Bewegung,
war, musste, deswegen, sich nicht eines vorher festgelegten Programmes unterwerfen, in nie endenden Stunden der
Zusammenkünfte mit ihren Mitgliedern. Damit, konnte er seine
Haltungen in jedem Moment zum anderen verändern, und
allgemeine Vorschläge vorzeigen welche, sehr oft einen
erlösenden Charakter zeigten, versuchten sie die nach Lösung
durstenden Massen zu verführen, wenn auch unabhängig von einer
praktischen Durchführbarkeit.
Dieser Geist der Unruhe und des
Pessimismus, der sich mit einer Feindlichkeit vereint, gegen
die politisch demokratischen Institutionen, wird auch hier zum
Thema der deutschsprachigen Literatur in Brasilien, weil ja
die dafür verantwortlichen Unternehmen weiterhin enge
Verbindungen mit gleichartigen deutschen Unternehmen aufrecht
erhielten. Man muss noch beachten, dass in den zwanziger
Jahren, neue Auswanderergruppen von Deutschland nach Brasilien
kamen, die von Gruppen eines politisch gedemütigten
Deutschlands entstammten, welches auch im wirtschaftlichen
Leben tief angegriffen war. Viele dieser Deutschen kamen um
ausschliesslich als Arbeiter tätig zu sein, ein nicht
gewünschter und einmaliger Zustand, laut der Aussage der
Vertreter derer Gruppen. Andere wieder, kamen aus den
verlorenen Gebieten als Vertriebene oder auch weil sie diese
abgetrennten Bezirke des Landes verlassen wollten, Grund der
in diesen ein doppeltes Gefühl des Verlustes hervorrief. Unter
ihnen, waren welche die den Bewegungen sozialistischer
Orientierung angehörten, und hier in Brasilien sich weiterhin
dieser Ideen widmeten, zum Verdruss des Alldeutscher
Verbandes.
Andererseits, in dieser selben
Konjunktur, die Presse als ein kommerzielles Unternehmen,
vollzieht sich eines sehr schnell entwickelnden Fortganges,
und fördert somit einen immer grösseren Austausch unter
Journalisten aller Welt; zu diesem Massenmedium, zähle man
noch die verallgemein machenden
Radio und Kino, besonders wichtig zur Entwicklung der
kulturellen Industrie.
Die Schriften dieses Zeitabschnittes
zeigen deswegen eine ähnliche Beziehung mit derselben Gattung
in Europa, und unterziehen sich derselben Veränderung wie die
dortigen, nicht unbedingt und nicht immer, was sich auf den
Inhalt bezieht, sondern hauptsächlich in der Berichtung des
Leserpublikums. Seit dem 19. Jahrhundert, in Europa und in
grösser Ausdrucksweise anfangs des 20. Jahrhunderts in
Brasilien, kann die dilettantische, gelehrte oder populär
Literatur, langsam mit den politischen journalistischen
Betrachtungen mitwirken, mit der Begünstigung der Parteien,
Vereinigungen und der Interessegruppen, welche zum Ziel die
Zustimmung der verschiedenen sozialen Segmente zu ihren
Gründen, hatten.[70]
Dies ist zum Beispiel der Fall der
Drucksachen, die von Parteien und Vereine der Linken
herausgegeben wurden, aber auch und hauptsächlich von dem
Alldeutscher Verband im Süden Brasiliens.
Ausser diesen beiden Agenten, kann man
noch die Existenz der Gruppen, welche sich dem ekklesiastischen Gedanken verbunden
waren, hervorheben, welche im nächsten Kapitel das Gegenstand
der Analyse sein werden.
Dieses Bestreben hatte keinen Erfolg in
dem Ersatz, bis zu den dreissiger Jahren, die dilettantische
Literatur oder derer die einen moralischen und religiösen
Grund in ihren Themen fanden. Im Gegensatz, diese bleiben
erhalten, als eine Möglichkeit der Gewohnheit des Lesens in
deutscher Sprache zu fördern, und somit zu ihrer Erhaltung
mitzuhelfen, ausserdem auch die originale Kultur zu erhalten.
Sie fahren deshalb weiterhin fort, das Leserpublikum zu
bewegen, aus den immergleichen Gründen welche, der
Zeitvertreib und der Bedarf nützlicher Informationen zu ihrem
täglichen Gebrauch zu erlangen, ist. Unterdessen, während der
30. Jahrzehnte, verändern sich auf drastischer Weise die
Sprache, der Inhalt und das Ziel des grössten Teils dieser
Druckschriften; die dilettantische Literatur überlässt immer
mehr einen grösseren Raum der Schriften welche über politische
Ereignisse berichten und gleichzeitig auch deren Sprache
annimmt; die lokalen Geschichten, nationale oder
internationalen, wie auch die Biographien richten sich, von da
ab, nur einem Thema zu, und zeigen sich als ein Trugbild der
politischen deutschen Kultur; die Anekdoten, Überschriften,
und Karikaturen spiegeln sich überwiegend, in Persönlichkeiten
die sich auf die europäische Politik beziehen; zur selben
Zeit, werden im durch Wiederholung eine grosse gewisse
"Wahrheit" zu bestimmen suchen, die man zu legitimieren
versucht, (In: MARCONDES F®. 1986. s. 104-113) zunehmenden
Lauf die Wörter durch Fotografien, Zeichnungen, Schaubilder
und der Statistiken, ersetzt.
Die Informationen werden absichtlich
zerstückelt und säkulare Anlässe, die sehr oft unwichtig sind,
werden sakralisiert. Ausser diesen Veränderungen, die sich in
den traditionellen Schriften zeigten und der Herausgabe neuer
Zeitungen und Kalender, kann man noch von einem in zunehmender
Weise Auftauchen neuer Druckschriften reden. Flugblätter,
Broschüren, Anschlagzettel, Schulbücher werden unentgeltlich
verteilt oder auch verhandelt in den verschiedensten
Kaufhäusern, in welchen sich Deutschbrasilianer trafen; als
wenn alles würdig wäre, schriftlich herausgegeben zu werden,
die Druckschriften sind im Umlauf als gehörten sie zu der
notwendigsten Ware, gleichzeitig verlieren sie ihre innere
Dichtheit, denn als Handelsware mit bestimmten Absatz, müssen
sie einförmig werden um wenigstens denselben Erfolg bei allen
ihren Abnehmern zu erlangen. Als wir diese Schriften näher
betrachteten, unterstreichen wir, zuallererst jene, die noch
unter dem Effekt des ersten Weltkrieges waren, danach an
zweiter Stelle diejenigen, welche den Einfluss der
nationalsozialistischen Bewegung unterstanden.
Gleich nach Ende des ersten Weltkrieges,
nehmen die Schriften in deutscher Sprache, welche die
materiellen Spesen die durch Plünderungen und
Unterschlagungen der Gegner verursacht werden, wie auch die,
Vereine, Kirchen und Schulen, ihre täglichen Arbeiten wieder
auf. In dieser Literatur, bemerkt man anfangs, eine gewisse
Abschwächung in Hinsicht auf Fragen des Deutschtums und ihrer
kritischen Einstellung im Verhältnis der Brasilianer
portugiesischer Herkunft. Unterdessen, kann man schon, in den
ersten Herausgaben des KDB und des KVK ein sich ankündigendes
Klima der Vergeltung spüren, welches die Druckschriften in
diese Jahrzehnte leiten würden, sobald ihre Journalisten und
Mitarbeiter sich sicherer fühlten, um ihre Schlussfolgerungen
über die Konflikte, die während des Krieges sich verliefen, zu
offenbaren. In diesen Texten, behauptet der Kalendermann, dass
die politische Situation in Brasilien ruhiger ist, dass aber
die rote Flagge und die anti-Deutschtums Propaganda der
Alliierten noch bestehen, und, reizten die Bewohner
verschiedener Länder gegen die Deutschen, an; dessen
ungeachtet, des allgemeinen Hasses welchen Alle gegen sie
äussern, muss ihnen ein Grund des Stolzes sein, denn solche
Äusserungen zeugen dass das deutsche Volk eine völkische,
solidarisch und einige Volksgemeinschaft, unabhängig den
Staaten denen sie angehört, ist (KDB, 1918, 1921 u. 1922).
Ein anderes Zeichen dieser verteidigenden
Äusserungen ist die Gründung, im Jahre 1919, des "Deutschen
Schutzbundes für die Grenz und Auslandsdeutschen", ein Verband
welcher verschiedene Organisationen
vereinigte
um den Deutschen,
welche in
Grenzgegenden oder
im Ausland wohnten, Schutz zu bieten, ein Unternehmen des
"Vereins für das Deutschtum im Ausland" - (VDA), welches mit
Hilfe der Deutschen Regierung rechnete, um die von dem
Ausbruch des Krieges beschädigten Landsmänner zu helfen.
Wie wir es ja schon bemerkten, hatte der
Krieg einen gewissen Destillations-effekt in der deutschen
Gemeinschaft, und ganz besonders in der Gemeinschaft der
Schriftsteller hervorgerufen. Wenn auch ein Teil dieser
Segmente sich zusammenschliesst gezwungener oder absichtlicher
Weise, seines traditionellen Vereinswesen unterlässt,
einschliesslich den Gebrauch der deutschen Sprache,
andererseits, jene die sich weiterhin um das Deutschtum
schliessen, tun es mit grösseren Nachdruck und Interesse, was
sich an die Vergrösserung der Zahl der Vereine und der
Abdruckzahl der Zeitungen bemerkbar macht.[71]
Ausser der grossen Vermehrung der Schriftenabdrücke, Neue
werden gegründet und schliessen sich den vor des ersten
Weltkrieges Existierenden, an, wie es an dem Schaubild Nr. 6
zu sehen ist.
Schaubild Nr. 6: Haupt-Zeitungen in
deutscher Sprache im Süden
Brasiliens - 1920-1942
|
Zeitungstitel |
Erscheinungs ort |
Erscheinungs weise wöchentlich |
Abschaffungs- Jahre, |
|
Koseritz Neue Deutsche Zeitung |
Porto
Alegre(RS) |
6x |
1942 |
|
Deutsches Volksblatt |
Porto
Alegre(RS) |
6x |
1942 |
|
Kolonie |
Santa
Cruz(RS) |
2x |
|
|
Vaterland |
Porto Alegre (RS) |
2x |
-- |
|
Serra post |
Cruz Alta
(RS) |
2x |
-- |
|
Der Freie Arbeiter |
Porto
Alegre(RS) |
1x |
1927 |
|
Deutscher Anzeiger |
N.
Württemberg (RS) |
lx |
1927 |
|
Kolonie Zeitung |
Joinville
(SC) |
2x |
1942 |
|
Blumenauer Zeitung |
Blumenau
(SC) |
2x |
1938 |
|
Joinvillenser Zeitung |
Joinville
(SC) |
1x |
• " |
|
Urwaldsbote |
Blumenau
(SC) |
2x |
1941 |
|
Rundschau |
Brusque (SC) |
lx |
1939 |
|
Der Kompass |
Curitiba
(PR) |
3x |
1942 |
|
Die Zeit |
Curitiba
(PR) |
3x |
1925 |
|
Deutsche Tages Zeitung |
Curitiba
(PR) |
6x |
1928 |
|
|
Quelle: GHESE. 1927 e SEYFFERTH. 1981.
Im Verhältnis zur Politik, verbleiben
die Kritiken dieselben; man führt hier nur eine Neuheit ein:
die deutsche Regierung wird auch kritisiert und in einigen
Momenten, in ihrer Unwirksamkeit der brasilianischen Regierung
gleichgestellt, diese wird als eine Gruppe von Oligarchen
angesehen, welche für sich immerwährend die Macht erhalten,
und das Land verschulden. Weil der Kredit an den Ausländischen
Banken gekürzt ist, bemühen sich dieser brasilianischen
Politiker um die Erhöhung der Verbrauchsmittelsteuern zu
erreichen, sodass der Kostenaufwand der Mittel und
Armenklassen übermässig teurer wird. Man bedauert es, dass die
Brasilianer so geduldig sind und fragt sich ob das
demokratische System wirklich das Passendste fürs Land ist
(KVK, 1924). Zu diesen Beobachtungen, füge man noch ähnliche
Kritiken der Weimarer Republik zu, die als eine Gesellschaft
von Parteien die ihre Versprechungen nicht hielten, regiert
wurde (KDB, 1923). Wegen dieser Enttäuschungen, verstärken
diese Schriftsteller ihre Ratschläge in Hinsicht auf die
Organisation dieser sub-Gesellschaft, mit einer
Selbstgesetzgebung dieses Landes in dem sie leben.
Wenn sie sich über das öffentliche Leben
äussern, tun sie es nicht um eine gewisse Gesamtbewegung zu
ermuntern, sondern als eine zusätzliche Schlussfolgerung
welche ihre selbst-Einengung förderte.
Nach Giralda
Seyferth Meinung, (1981), in den unmittelbar folgenden
Nachkriegsjahren bemerkt man, dass sie sich, in der Suche
einer Wiederentscheidung der Ideale des Deutsch-brasilianertum charakterisieren, in
dessen Namen bewirbt sich die Verteidigung dieser Grundregeln:
Die Rechte des Deutschbrasilianischen
Bürgers seien, in diesem Fall: der Gebrauch der deutschen
Sprache im privaten Leben; die Erhaltung der Privatschulen
welche in deutscher Sprache unterrichten, "wo in manchen
Gegenden luso-brasilianische
Kinder und sogar afro-brasilianische lernen, auf Kosten der
Deutschen”, das Wahlrecht haben, welches ihnen das
Staatsgrundgesetz des Landes, zuspricht, und nicht eine Stelle
des zweiter Klasse Bürger annehmen, und den Brüdern, welche
aus der alten Heimat stammten, Hilfe zu leisten (SEYFERTH,
1981, S. 83).
Es handelte sich um einen taktischen
Beschluss der luso-brasilianischen
Gesellschaft und ihre Gemeinschaft. Sie beteiligten sich, nur
des Wahlrechtes, des politischen Lebens des Landes,
unterordneten sich den Gesetzen, würden aber, sich von
jeglichen Druck der ihre kulturelle Gleichmachung erforderte,
freihalten. "Für die Brasilianer, sind die Immigranten und
derer Nachkommen immer noch Deutsche", behauptete die
"Blumenauer Zeitung" in 1929, (apud
SEYFERTH, 1981, S. 87), in einer Ansicht welche es vorhatte,
alle Versuche einer Integration in die Gesellschaft, als eine
Gruppe mit kulturellen Eigenheiten, zu verschliessen.
Die Einwendungen dieser Zeitung,
bekommen einen klareren Ausdruck, wenn man die Ortschaft wo
diese Zeitung gedruckt wurde, in Betrachtung zieht: Blumenau
wurde schon, von jeher, als das Sinnbild der Immigration und
der deutschen Kultur betrachtet, eine Stadl in der Mehrzahl
von Deutschen bewohnt, wo man sich nur der Deutschen Sprache
bediente, alle waren protestantisch, usw.; solch ein Merkmal
hatte seine positiven Effekte, hauptsächlich, wenn die
Politiker und Intellektuellen welche sich der Kolonisation
begünstigten, diese als eine Bevölkerungspolitik und der
Ausgleichung der Arbeitskräfte, sahen; in Gegensatz, besonders
die Anti-Germanisten, sahen in Blumenau das Urbild der
"deutschen Gefahr" und das Sinnbild der Möglichkeit einer
ethnischen Einschliessung. Ausserdem war das relative
wirtschaftliche Gewicht der deutschen Bevölkerung in Santa Catarina grösser als in Rio Grande do Sul und in
Paraná, was ihnen verhalf, zu einer bedeutenden politischen
Darstellung in der staatlichen und städtischen Volksverwaltung
gewährleisteten.
Dennoch ist es sonderbar, dass gerade in
diesem Staate, die ersten Massnahmen gegen den exklusiven
Gebrauch der deutschen Sprache in den privaten Schulen,
getroffen wurden.[72]
Dieser angebliche Gegensatz kann sich
dem Grund beigesellen, dass die Segmente der regierenden
Klasse von deutscher Herkunft die vorgefasste Meinung hatten,
ihren nationalen Ruf zu erhöhen, durch eine klare Äusserung
ihrer patriotischen Gefühle in Beziehung zu Brasilien. Zu
diesem Entschluss kommt man, wenn man sich, mit den
Ereignissen über Lauro Müller, befasst; der Grund aus welchem
dieser Politiker sein Platz in dem Auswärtigen Amt verlor,
während des ersten Weltkrieges, muss das Risiko des
Deutschtums für diejenigen die eine Integration auf ein
institutionalisiertes öffentliches Leben erstrebten.
Andererseits, in Rio Grande do Sul, konnte man diese vorausgesetzte Entsagung schon
seit dem Anfang der Republik, beobachten, was sich nach
Kriegsschluss verstärkte, in Hinsicht auf das Sinnbild der
"deutschen Gefahr", aber auch wegen der eigenartigen riogrander Politik. Dort,
organisierten die Oligarchien, welche besser artikuliert
waren, als in den beiden anderen Staaten, eine stark
zentralisierte Volksverwaltung; auf diese Art, verhinderten
sie den Zutritt der Vertreter der Mittelklasse zu den
offiziellen Ämtern. Ausserdem achteten die Riograndenser
Leiter immer mehr auf die Zahl der Vertreter, der
Deutschbrasilianer in ihren politischen Handlungen, also in
den Wahlen.
Wenn auch ihre Wirtschaft weniger
wichtig war als die des Staates Santa Catarina, wurden
ihre Interessen gut beachtet, und nach den Wahlergebnissen zu
schätzen, das Spiel der Schutzbefohlenen gab, annehmlich, gute
Wirkung, denn in diesen Gegenden siegte fast einstimmig, die
Situations-Partei.
Nach Gertz Meinung,
(...) man kann es nicht leugnen, dass
zwischen der Regierung und der deutschen Bevölkerung sich ein
Tauschhandelt abspielte. Die Regierung versuchte es zu
verhindern, dass die selbständigen Kräfte, welche sich als ein
starker Widerstand bilden konnte, sich in den Koloniezonen
entwickelten. Im Gegensatz, entwickelten sich dort
Institutionen und Organisationen, die keinen ausdrücklich
politischen Charakter hatten, welche aber trotzdem, nicht in
konkreten Zuständen von der Regierung aus nicht als unbekannt
betrachtet werden (GERTZ, 1987. S. 54)
In Paraná, war die Absonderung in
Hinsicht auf die staatliche Politik ein logisches Verlaufen
ihrer eigenen Geschichte, die ersten Immigranten in Rio Negro und
Ponta Grossa unterhielten sich seit ihrer Herkunft, von den
anderen Schichten, abgesondert. Diejenigen, welche aus
Joinville nach Curitiba verzogen, ebenso auch jene die nach dem
ersten Weltkrieg gekommen sind, zählten nur eine verminderte
Zahl der Bevölkerung (ungefähr 5 bis 6%), in einem Raum
welchen sie mit Immigranten anderer Herkunft, wie zum
Beispiel: Italiener, Portugiesen, Polen, Russen, Japaner und
Litauer teilten. Aus diesen Gründen, weckten sie die
Aufmerksamkeit der Regierungen und der lokalen Intellektuellen
zur Zeit beider Kriege. Ansonsten, waren die Immigranten als
arbeitsame und gutgesittete, wie alle europäischen
Arbeitskräfte; ihre folgsame und vorausgesetzte Absonderung
der politischen Sache, erlaubte es ihnen, ohne grössere
Probleme, ihren Eintritt in der feierlichen Geschichte des
Staates, zu mindestens, bis zum zweiten Weltkrieg.
Eine gesammelte Lektüre der Druckschriften dieser
Jahrzehnte, erlaubt es uns zu behaupten, dass die Betrachtung
über das Deutschtum eine Haltung der Empfehlung zum Gehorsam
den brasilianischen Vorgesetzten und Pflichten, eine mehr oder
weniger bewusste Strategie um ihre teuersten Werte, wie
Schule, Sprache und ihre kulturellen Vereinigungen zu
bewahren. Man nimmt es an und empfiehl den Unterricht der
portugiesischen Sprache ebenso die Geographie und Geschichte
Brasiliens, aber sodass sie ein Instrument, die ihnen nur
diente um ihnen in ihre Arbeit und in den Handelswesen mit
anderen Schichten der Gesellschaft zu verhelfen (KDB, 1921 und
1923). Ebenso, um "dass sie nicht betrogen würden und als ein
Stimmenvieh des Politikers, dienten". (KVK, 1926). In ihrem
privaten Leben, dass nicht nur im Familienleben, aber auch in
irgendeinen Vereinigungsraum, sollten die deutsche Kultur und
Sprache erhalten bleiben.
Diese Haltung der Ergebenheit kann nicht
verstanden werden als ein Resultat der Konflikte, die während
des ersten Weltkrieges hervorgerufen wurden, oder von ihren
eigenen Erfahrungen mit der inneren Politik. Sie ist auch die
Wirkung des Erscheinens einer Sprache mit einem totalitären
Charakter, welche schon in Europa gewärtig war.
Wir hatten schon die Gelegenheit zu
behaupten, dass der Umlauf des Massenmediums mit dieser
Tendenz widerspiegelt ein politisches und bewegendes
Solidarverhältnis mit den Begebenheiten nach dem ersten
Weltkrieg, welche die Deutschen in ihrem Lande wie auch
ausserhalb angegriffen haben.
Wir behandeln auch die Wirkungen des
Sinnbildes der "Deutschen Gefahr" über die Politiker und
brasilianische Intellektuellen, deren Überlegungen und
Haltungen eine Reihe von Entscheidungen gegen die Immigranten
dieser Herkunft, hervorriefen.
Es war deshalb vorauszusehen, dass nach
solchen Erfahrungen, die Deutschbrasilianer sich immer ihrer
ursprünglichen Kultur näherten, und deswegen, sich von den
Vorschlägen sich der Kultur des Zufluchtslandes zu
integrieren, abwendeten. Aber ausser dieser überlegten Neigung
zum Widerstand gegen die Assimilation werden diese Meinungen
durch neue (oder erneute Agenten des Deutschkulturellen
Imperialismus ermutigt, worüber, wenn auch nur kurzfassend, es
sich lohnt, einige Betrachtungen zu erörtern.
Hitlers
Deutschland und das Auslandsdeutschtum
Mit dem Aufstieg der
national-sozialistischen Bewegung werden eine Reihe von
Vereinigungen, die sich für die Erhaltung des Deutschtums im
Ausland interessierten, wiederlebelebt, welche mit
pragmatischen Absichten oder in Hinsicht auf wirtschaftliche
Interessen auf kurzer oder langer Frist, ebenso auch die
subjektiven, wie die Notwendigkeit zur Bekanntmachung der
nazistischen Lehre, nur um den Wunsch sie erkannt und
bewundert zu sehen, zu erreichen.
Der Einfluss der nazistischen Ideologie
machte sich in den deutschen Kolonien des Süden Brasiliens
spürbar seit Anfang der Jahrzehnte des Jahres 1920, durch den
"Volksbund für das Deutschtum im Ausland", wie auch durch ein
Teil neuer Immigranten (Neudeutscher), die in dieser Zeit nach
Brasilien kommen. Aber, gleichwie die nationalsozialistische
Bewegung sich verstärkt, übernimmt sie eine grössere
Wichtigkeit, denn ihre Anhänger und Sympathisanten können von
da an, mit der Hilfe neuer und auch stärkere Organisationen,
rechnen, wie mit dem "Deutsche Auslands- Institut" - (DAI)
und, ab des Jahres 1928, mit der Auslandsorganisation der
NSDAP - (AO). Wesenheit welche das DAI einverleibte, und sich
ihr in der Tat überwiegte. Die AO wurde von der Partei aus
gegründet, mit der Absicht eine gegen-Propaganda über die
Betrachtungen der Gegner des national-sozialistischen Bewegung
zu organisieren. Von den ersten ausländischen Gruppen,
zeichnen sich die von Paraguay aus, die in 1929, in der
Schweiz, in 1930, in Argentinien und in Brasilien, in 1931
gegründet wurden.[73]
In den Statuten der lokalen Gruppe
Paraguays, konnte man Informationen erreichen, die uns
verhelfen ihre Richtlinien auf kurzer Frist, zu bestimmen; sie
wollten Geld sammeln, die sie die Partei senden wollten, in
der Zeit des Aufstiegs, wie auch eine informelle Unterstützung
ihrer Aussenpolitik, wenn schon an der Macht, erobern.
Ausserdem, war die AO ein Informationszentrum über die
Möglichkeiten einer Veranstaltung günstiger Handelsunternehmungen
mit
ihrem Land; die Nazifizierung der
Deutschen im Ausland hatte noch eine andere Absicht, die wäre,
ein Reserve-Heer aus Bürger des Reiches zu bilden, um wenn es
nötig wäre, sie zu einem eventuellen militärischen Konflikt zu
rekrutieren. Zu ihrer Gründung wirkte mit dem Grund den sie
selbst beobachteten in den Jahren die dem Aufstieg des III
Reiches vorangingen; die Sympathisanten ihrer Lehre im
Ausland, machten sich verantwortlich für eine ausdrucksreiche
Zahl von Stimmen in den Wahlen 1930, Erfolg welcher von ihnen
als ein Symptom der Unzufriedenheit dieser Landsmänner mit den politischen Verfahren der
sozial-Demokraten und der Kommunisten eingeschätzt wurde.[74]
Diese beiden letzten Faktoren, wie die
Möglichkeit der militärischen Rekrutierung und ihre
Wahlunterstützung, brachten es dazu, dass diese Wesenheit in
ihren Reihen nur Reichsdeutsche aufnahmen, denen es auch
Vorbehalten war einige Rechte über die Sozial-Politik, die zur
Zeit in Deutschland geschaffen wurden oder jene die schon
vorhanden waren; selbst wenn sie auch in definitiven Charakter
im Ausland lebten.[75]
Für die Sympathisanten der Bewegung,
welche nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besassen und
sich dieser Unterstützungsgruppen einreihen konnten, gründeten
sie den "Bund der Freunde der Hitlerbewegung", eine besonders
wichtige Wesenheit in Hinsicht auf den Umlauf jener Ideen
unter deutschbrasilianischen Vereinigungen, Schulen und
Kirchen.
Die AO empfahl ihren Gliedern und
Sympathisanten nicht an der lokalen Politik ihrer Gastländer
teilzunehmen. Ausserdem, sollten sie nicht ihre Ideen an den
Ausländer verbreiten (Empfehlung die nicht immer beachtet
wurde), denn wie selbst Hitler schon versicherte, "der
Nationalsozialismus keine Exportware sei"; die Mitglieder
sollten sich, wie eine Elite des Reiches benehmen. (JACOBSEN, 2968, S. 140)
Gemäss den Druckschriften der AO sollten
ihre Mitglieder die "Zehn Gebote" beachten, von denen sich die
Folgenden, hervorheben:
1.
Befolge die Gesetze des Landes, dessen Gast du
bist.
2.
Die Politik deines Gastlandes, lasse dessen
Bewohner machen. Dich geht die Innenpolitik eines fremden
Landes nichts an. Mische dich nicht in diese, auch nicht
gesprächsweise.
5.
Sieh in jedem Deutschen draussen deinen Volksgenossen,
einen Menschen deines Blutes, deiner Art und deines Wesens.
Gib ihm die Hand ohne Ansehen seines Standes. Wir sind alle
"Schaffende" unseres Volkes.
10.
Schliesse dich den Parteigenossen in deinem
Aufenthaltsort an. Besteht dort ein Stützpunkt oder eine
Ortsgruppe, so sei ihr ein disziplinierter und rühriger
Mitarbeiter. Stifte nicht nur keinen Streit, sondern sei mit
allen Kräften bemüht, aufkommende Unstimmigkeiten zu
schlichten. [76]
An diesen Ermahnungen, kann man
beobachten, dass die Gebräuche dieser Organisation sich nur an
Deutsche, oder an jene, die die deutsche Staatsangehörigkeit
hatten; in anderen Texten, wurde, einschliesslich, angesucht,
dass die Mitglieder ihre Handlungsweise geheim hielten; der
Hauptpunkt über diesen geheimen Charakter jener Handlungen,
scheint sich als eins der Teile welche die Regeln dieses
Systems durchlaufen, zu gestalten. Laut der Aussagen Jacobsens,
Das Ziel (ihrer Aussenpolitik) im
Grossen war abgesteckt und damit die allgemeine Richtung
gewiesen. D.h. jedoch nicht, dass die NS-Führung dazu konkrete
Pläne mit Daten. Phasen, und Alternativen ausgearbeitet hätte.
Die Nationalsozialisten haben z. T bewusst abgelehnt, einzelne
Methoden oder Wege zur Stabilisierung und Ausweitung der Macht
festzulegen. Denn alles hing für sie davon ab, in welcher
Situation und unter welchen Umständen sie handeln konnten. Das
hatte für die in der Aussenpolitik agierenden NS-
Führungskräfte bestimmte Konsequenzen. Jeder von ihnen (oder
jede Gruppe) bemühte sich, den Intentionen des "Führers" nach
seinen Vorstellungen konkrete Gestalt zu geben. Zwar wussten
sie nicht, wie, wann und unter welchen Voraussetzungen das
einmal abgesteckte Ziel erreicht werden konnte, aber in ihrem
Arbeitsbereich leisteten sie zur Verwirklichung desselben
einen partiellen Beitrag. (JACOBSEN.
1968, S. 599)
Aber die Bestimmung, dass nur Reichsdeutsche als
Mitglieder in die NSDAP im Ausland aufgenommen werden dürfte,
verglich sich mit der Ideen der Volksgemeinschaft, so wie sie
von den Deutschbrasilianern in Brasilien verstanden wurde,
ganz besonders jene welche sich dieser Lehre zugewandt hatten;
diese Neu-Bekehrten spürten einen Missionsdrang, der sie dazu
führte das Neue Deutschland zu verbreiten, und gleichfalls
verschiedene bürgerliche Äusserungen des Beitrittes zu der
Lebensordnung. Diese Äusserungen hatten nicht nur das Ziel,
auch nicht den Vorzug, neue Mitglieder zu erobern (welche,
laut ihrer Meinung, ihre Staatsangehörigkeit erreichen oder
auch nicht erreichen konnten welche sie bei der AO angesucht
hatten), aber die öffentliche Behauptung ihrer Anwerbung zu
jener Weltanschauung.
Andererseits, einige derer, welche sich
eines starken Darwinismus zuwandten, hatten die vorgefasste
Meinung eine Art Vorauswahl der Einzelwesen auszuführen um
festzustellen welche das Recht hätten, dieser neuen
Gesellschaft anzugehören, um abzuschätzen in welchen Masse die
ältesten Immigranten dieser Herkunft, wirklich reine Arier
waren, wozu sie die rassischen Unterscheidungszeichen
benutzen, wie die Verurteilung der Rassenmischungen, und, von kultureller Seite, wurde
die Abschätzung durch die Beurteilung des rechten Gebrauches
der deutschen Sprache, des Wissens der Geschichte, der
Geographie und der Literatur des Herkunftsvaterlandes benutzt (KDB, Kalendermannstandrede,
1936, 1937, 1938). Ausserdem waren sie stolz auf ihren
überlegenden Stand, wenn sie das deutsche Bürgerrecht hielten,
und nicht immer waren sie zu einer Ausdehnung dieser Rechte an
andere Immigranten geneigt (GERTZ, 1987, s. 92 usw.).
Solche Rechtfertigungen waren nicht in
den Träume Bohles zugegen, den
wichtigsten Leiter der AO; er behauptete, zum Vorsatz dieser
Konflikte, dass alle in rechtschaffene Deutsche verwandeln
müssten, dafür wäre es am wichtigsten gute rechtschaffene
Nazis zu werden.
Er näherte sich dem romantischen Begriff der
Volksgemeinschaft, was man aus einer Erwähnung seiner
Schriften ersehen kann, wo er über die weltliche Anerkennung
Deutschlands schreibt:
Auslanddeutsche und deutsche Seefahrer
sind die Künder deutscher Arbeit und deutschen Geistes in
aller Welt. In fünf vergangenen Jahren nationalsozialistischer
Aufbautätigkeit sind die hineingewachten in die grosse deutsche Volksgemeinschaft, sind
heute die Vorposten Grossdeutschlands in allen Teilen der
Erde. Und überall, wo Auslanddeutsche leben, da kommt zu ihnen
der deutsche Seemann als Mittler und Träger eines deutschen
Willens, der nichts weiter kennt als friedliche Arbeit in Ehre
und Gerechtigkeit.[77]
Die Bildung der Zellen der AO in
Brasilien und mit ihnen, der Beginn des Rechtstreits der
Zugehörigkeit der deutschen Gemeinde, beginnt mit der Gründung
von Ortsgruppen und der Verbreitung des Propagandamaterials
der Partei. Dieses Material verhilft auch zur Gründung neuer
Vereinigungen, wie zum Beispiel, die "Hitlerjugend", die
"Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Frauen", die "Deutsche
Arbeitsfront" und selbst des Verbandes "25 de julho", welcher eine grössere
politische Beteiligung der Deutschen in Brasilien erforderte,
im Gegensatz was zu der Ortsgruppe
der NSDAP gefordert wurde (KDB, 1924 und 1929, ).[78]
Da die Zahl der Beteiligten Mitglieder,
Sympathisanten und Propagandisten sehr gross war, und dieselben freiwillig handelten
und in all den Bezirken des Süden Brasiliens verstreut lebten,
ist es uns unmöglich die Entwicklung ihrer Handlungen in der
ganzen Zeit, in der sie wirkten, zu verfolgen n.
Ausserdem sind die Dokumente die' noch Auffindbar sind, sehr dünn und dazu noch, durch das Lesen
der Opposition, verdächtigt. [79]
[80] Aus diesen Gründen, begrenzen wir uns,
auf die Beschreibung der hauptsächlichsten Formen der
Organisation der Propaganda, so wie auch über verschiedene
Themen die durch sie verbreitet wurden.
Die Mission der
Auslandsdeutschen
Das auserwählte Material zur Analyse des
Einflusses des Nationalsozialismus in den Druckschriften in
deutscher Sprache in Brasilien, erlaubt es uns zu
beschliessen, dass ihre hauptsächlichsten Beauftragten das
gewünschte Publikum in drei verschiedenen Gruppen teilten, was
uns zu drei Abwägungen der Auslegungen auf dem Gebiet der
schriftlichen Sprache, wie auch den Umlauf des
Propagandamaterials, bedingt.
Die erste Gruppe bestand aus der Elite
der Partei, was ihrer Beteiligung im Ausland, anging; es
handelte sich um Beamte der Organisation und um einen kleinen
Teil der Vertrauensmänner. Es waren die Mitglieder der AO in
Deutschland und die Kundschafter der Lehre in verschiedenen
Ländern (Schaubild Nr. 7). [81]
Denen wurden Informationen zugeteilt, welche als offiziell
galten, und vertraulichen Charakters waren, unternahmen eine
Vorwahl ihrer Mitarbeiter von Seiten der internen Verwaltung
der Wesenheit. [82]
|
Quelle: JACOBSEN, 1968, S. 151 |
|
Schaubild 7 |
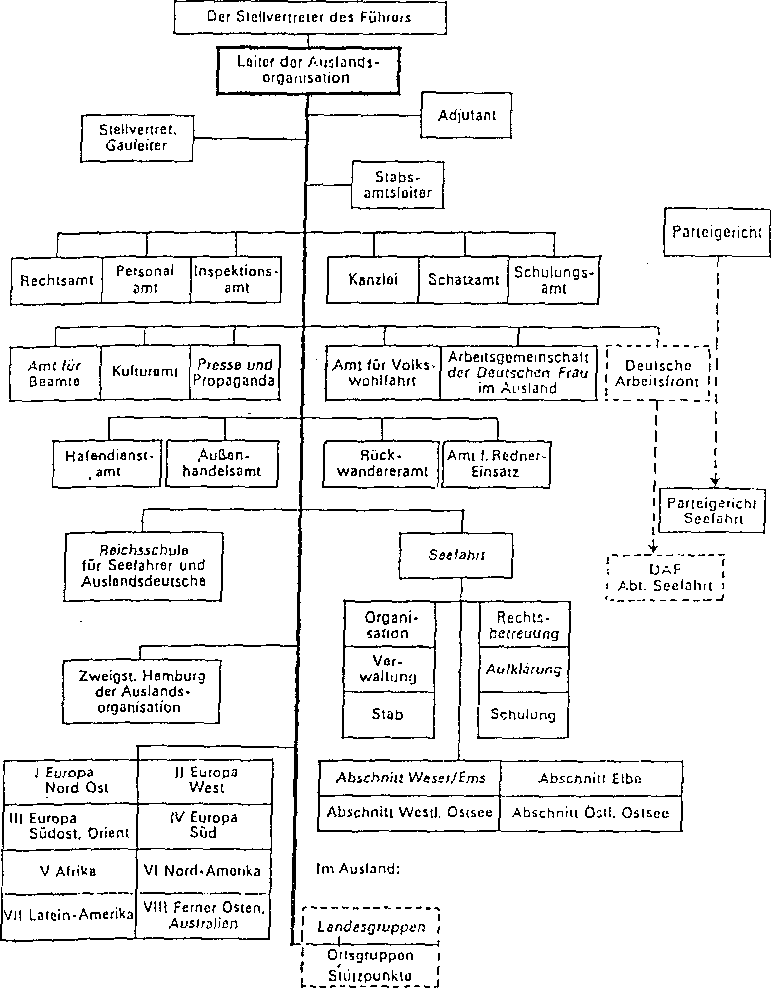
|
Auslandsorganisation der NSDAP 1937 |
Wir können zwei wichtige
Charakteristiken um die Gesamtheit der Texte, welche der
bürokratischen Elite bestimmt waren, unterscheiden. Die Erste,
welche in den Jahren 1932 bis 1936 vorkam, hat einen
pragmatischen Charakter, der von der Notwendigkeit des
Kennenlernens der strategischen Punkte in den Gebieten wo sich
ihre Arbeit produktiver zeigen sollte, bedingt war. Die Texte
zählten die Gegenden der Konzentration der deutschen
Bevölkerung auf aller Welt, auf, gaben ihren wirtschaftlichen
und sozialen, wie auch den politischen und kulturellen Umriss,
an, die Zahl der Volksgruppen, ihre, wichtigsten festlichen
Daten und Zeitschriften, an, wie auch die Schwierigkeiten
welche sie in Hinblick auf die Gesetzgebung des Gastlandes,
durchzustehen hatten. Zur gleichen Zeit, waren die Grundregeln
der Organisation ständig im Umlauf, mit der Emphase zur
Grundregel der nicht Einmischung in der lokalen Politik und
zur Verbreitung des Nazismus nur unter Reichsdeutschen.
Laut Seifert, ein Mitglied der AO,
würden die Zellen der NSDAP in Gegenden eingesetzt, wo man
eine kulturelle, politische und ideologische Homogenität um
die germanische Angelegenheit beobachten konnte. Es würden
Personen, verschiedener besonderer Berufe in diesen Gegenden
geschickt, welche sehr schnell das Feld ihrer zukünftigen
Beschäftigung kennenlernen sollten. Je nach der
Leistungsfähigkeit jeder Ortsgruppe, wäre es möglich neue
untergeordnete Gruppen zu bilden und natürlich eine grössere
oder kleinere finanzielle Hilfe zur Ausbreitung ihrer
Aktivität zu erhalten.[83]
Ab 1936, verlieren dieselben Urkunden
langsam ihren technischen oder auch den informierenden
Charakter; zu diesen Betrachtungen, reiht sich noch
die Druckschriften einer noch grösseren Zahl von anderen
Informationen, welche die Abschätzung der Bewegung vorhatten,
und gleichfalls noch die Eintragung in einer Liste der Briefe
und Ausschnitte von Zeitungen und Zeitschriften anderer
Länder, wo sich ihre Zellen gebildet hatten: es handelt sich
um Erklärungen, ohne den Triumphton beiseite zu lassen, die
Verfolgungen welche sie ertragen, von Seiten der Regierungen,
oder von der empfangenden Gesellschaft, oder auch noch von
Seiten der "Verräter" der Bewegung. Welche sich als die
Leidtragenden der Verfolgung ausgeben, verraten die "wahren"
Urheber die für diesen Zustand verantwortlich waren; die
Juden, und in geringerer Zahl, die Kommunisten und die
Alliierten. Man bemerkt, zum Beispiel, ein Bericht aus 1935,
in welchem man die Existenz von Strassenverkäufer in São
Paulo, in grösster Zahl Juden, welche von der Regierung nicht
tributzinspflichtig sind, aus Grund ihrer Verkaufstaktik.[84]
Die Gefahr bestand in dem Grund, dass ihr Reichtum zu ihren
heimlichen Interessen angelegt wurde, was dem Deutschtum
Sorgen verursachte. In einem Brief des Jahres 1939, offenbart
ein Deutschamerikaner, dass wegen der lauten Propaganda der
Juden, wurde es den deutschen Immigranten verboten, die
deutsche Sprache öffentlich zu gebrauchen. Zur selben Zeit,
verständigt der "Wochenspiegel" seine Leser, dass "ein
gemeines jüdisch-englisches Weib" verleumdende Nachrichten
über Hitler und den Nationalsozialismus in der Presse von Rio
de Janeiro verbreitete.
In den Jahren 1941 und 1942, wurden alle
öffentliche Massnahmen der brasilianischen Regierung gegen die
Immigranten dieser Herkunft, in allen Einzelheiten
beschrieben, um zu zeigen, dass wenn in der Vergangenheit die
Filme {300 im Ganzen) Radioprogramme und Flugschriften die
leicht in Brasilien gefördert wurden, war das Deutschtum in
diesem Moment, isoliert. "Wir sind führerlos", beschliesst
eines der Berichterstatter, der letzten Monate des Jahres 1942.
Diese zweite Tendenz, welche wegen der
Einschränkungen geprägt war, scheint uns, im ersten Moment,
sogar naiv, denn die Zahl der Juden welche von ihnen
aufgestellt wurde, wenigstens in Brasilien, war relativ
ausdruckslos. Ausserdem die Einzelheiten, wie die nicht
Beachtung der einfachsten Massregeln des Landes in welchem sie
wohnten, wie zum Beispiel, die Flagge des Reiches, öffentlich,
aufzuziehen, die Feier des Sieges des Nationalsozialismus an
den Feiertagen des Gastlandes, oder die Voraussetzung, dass
die armen Landwirte einen ausdrucksvollen Beitrag an die
Partei abgeben könnten, scheint uns als Ausdrücke einer
unwirksamen Ansicht die es nicht wert ist, ernst genommen zu
werden. Man muss aber berücksichtigen, dass solche
Informationen auch als Hilfsleistung zur Propaganda des
Regimes in Deutschland dienten. [85]
Nachrichten von schätzenden und
anerkennenden Druckschriften der Massnahmen der Regierung,
welche vom Ausland kamen, oder auch der Grund, dass es in weit
entfernten Gegenden Gruppen des Grossdeutschlands gab, trug
dazu bei um einen Effekt des Wiederauflebens der
nationalistischen Gefühle, die wichtig waren um die tägliche
Wiederherstellung der Macht und der Verführung des Regimes. Es
wirkt zu der Bestätigung unserer Hypothese die Zuflucht des
"Mythos der jüdischen Verschwörung", auch in den Gegenden wo
diese Gruppe nicht zahlreich und nicht politisch wichtig war;
da ist die Wahrhaftigkeit der Begebungen weniger wichtig als
das ideologische Solidarverhältnis mit den Betrachtungen der
Nazis in Deutschland. Ausserdem würden solche Ausarbeitungen
wahrscheinlich noch dazu beitragen, dass die AO ihre eigene
Existenz an ihre Obrigkeiten legitimierte und eine
Unterstützungsgruppe zahlreicher in ihrem eigenen Lande wäre.
Die zweite Textsammlung verstanden wir
als die der Mitglieder der Parteizellen im Ausland zugedacht
waren und den wirkungsfähigen, auftauchenden Leiter zu dienen.
Es handelte sich um eine zweite Schicht der Propaganda
Ausarbeitung; wenn die Erste sich einer selbst-überzeugenden
Notwendigkeit solch einer Politik widmete, diese eine grössere
Anzahl Texte verfasste, welche den glaubwürdigen Mitgliedern
zugeführt wurde, sollten dazu beitragen die Leser zur Tat bei
den verschiedenen deutschen Siedlungen, anzuregen. Zur
Erklärung, geben wir einige Beispiele; Schmidt Decker,
Gaupropagandaleiter, in einem Artikel, unter dem Titel Die
Arbeit des Kulturamtes 18
lehrt die Leser damit die Auslanddeutschen weiterhin eine enge
Gemeinschaft und stete Kontakte mit der Kultur des Reiches
beibehalten. Für Schmidt, ist die Ausbreitung deutschen
Literatur, der Musik, des Theaters und der Malerei auf dem
ersten Plan der Aktivität jener Organisation. Deswegen,
empfiehlt er die Gründung gut ausgestatteter Bibliotheken zur
Ausübung dieser Aufgabe. Er behauptet noch, dass die Zahl der
nicht beruflichen Künstler im Ausland, "erschreckenderweise”
wächst - und dass durch seine Abteilung, Vorträge des Führers
durch Radio an die Deutschen im Auslande übertragen worden
sind. [86]
E. Stempel, im selben Jahrweiser,
behauptet dass die vorzügliche Beschäftigung der AO und des
Nationalsozialismus im Ausland, die Einprägung der
gemeinschaftlichen, volksbestimmten Mentalität ist, denn, wo
die Rasse sich rein erhalten würde, da würde man ein Stück
deutschen Bodens vorfinden. [87]
Wolfgang Haessler, seinerseits bemerkt, dass die AO zwei
grundlegende Aufgaben habe: eine gerichtliche Orientierung der
Deutschen im Ausland und der deutschen Rückwanderer. Er
bezieht sich auf die Regelung der Bürgerschaft, wie er
behauptet, "eine deutliche Empfehlung des Führers". Ausser der
Regelung und der Bewilligung des Bürgerrechtes an die
Ausgewanderten, die Organisation einer Massenübersiedlung der
Deutschen die wieder in die Heimat zurück wollen, gleichwie
eine Handwerksübung und sofortige Anstellung im Arbeitsmarkt.
Paralell zu diesen Beschäftigungen
werden die Beratung und Betreuung der einzelnen Volksgenossen
zur Durchsetzung ihrer privatrechtlichen Ansprüche
(Rechtsbetreuung) [88]
Schliesslich, unter den ausgewählten
Beispielen, fügen sich die Behauptungen Kirchners ein, für
diesen ist die ausdrücklichste Aufgabe der AO die deutsche
Wissenschaft zu entwickeln: nach seinem Urteil, sind die
besten und vielleicht auch die wichtigsten Wissenschaftler
aller Welt, deutscher Abstammung. Mit dem Aufstieg des
Nazismus, bekam die deutsche Wissenschaft einen immer grösser
werdenden Fortschritt. Nach seiner Meinung, war die
Wissenschaft so wichtig, dass sogar die Juden versuchten unter
sich, grosse Denker zu erziehen, um selbstverständlich die
Welt beherrschen zu können. Er beschliesst in dem er behauptet
es wäre notwendig wahlmässig die Deutschstämmigen in aller
Welt, zu der national-sozialistischen Angelegenheit zu bringen. [89]
Was uns bemerkbar wurde ist, dass die
Orientierung dieser unzähligen Beamten eine Mannigfaltigkeit
der Haltungen und Meinungen aufweist, die uns erlauben zu
folgern, dass sie vorhatten: in verschiedenen Ansuchen zu
wirken oder (und nicht ausschliesslich), dass sie nicht, für
sich selbst, Klarheit hatten, welche, letzthin, der Grund der
Partei-abteilung war.
Wenn dieser Vernunftschluss richtig ist,
ist es wahrscheinlich behaupten zu können, dass dasselbe politkratische Bild, welches Peter Hütenberger offenbart, als er die
verschiedenen Beziehungen unter den verschiedenartigen
Organisationen die im Innern des Systems wirkten, analysierte,[90]
es ist in mikro-Niveau gültig, das heisst, die Handlung der
deutschen im Ausland zu verstehen. Hier, zerstückelte Mächte
und nicht immer vollkommen bewusst der Absichten des Kerns des
Regimes, entwickelten ihre Aktivitäten auf eine anarchische
und verwirrte Art, eine Situation die verglichen werden kann,
mit dem was später die post-moderne Bürokratie vorstehen soll.
Diese Betrachtung schien nur wichtig,
weil sie uns zu dem Verständnis der verschiedenen
Betrachtungen und Ausführungen der Pangermanisten und Nazis in
Brasilien, verhilft; wenn für einige, die Teilnahme an die
lokale Politik verhindert werden sollte, für Männer wie Brühl,
zum Beispiel, sollte die NSDAP den Landwirten verhelfen in die
Politik der Staaten in welchen sie lebten, einzutreten, im
Namen des gleichen Blutes und der gleichen Rasse, für die
Bewahrung ihrer Interessen zu streiten (Volk und Heimat, 1935,
S. 38-40).
Wenn einige die Hilfe der Deutschen
welche das Bürgerrecht nicht besassen, verboten, andere, wie
Bohle selbst, bemühte sich darum, dass alle in der
Organisation eingeschlossen werden sollten. Für eine Gruppe
sollte die Taktik sich auf die Förderung der Freizeit sein.
Feste und Volksfeierlichkeiten, andere handelten auf
aggressiver Art, und noch andere, meinten es wäre sehr
wichtig, dass es eine Einschreibung in der Partei gäbe. Und,
beinahe alle, wie es ja schon bemerkt wurde, erwarteten dass
ihre Pflichterfüllung von ihren Obrigkeiten anerkannt würde.
Die dritte Gruppe, welche eine grössere
Aufmerksamkeit wert ist, bezieht sich auf die Lesergemeinde,
beschränkt sich natürlich, auf die, welche die deutsche
Sprache beherrschten.
Diese Textsammlung, die wir als die
Verbreitung der Lehre nennen können, wurde, hauptsächlich
durch einen Kalender befördert, der in diesen Jahren
herausgegeben wurde, der "Volk und Heimat”, von der Deutsche
Morgen Verlags aus São Paulo, wo der Anti-Semitismus, der
Anti-Bolschewismus und der Sieg Hitlers (als eine täglich
erneuerte Tat) waren die dauernden Schlagzeilen. Es ist aber
auch wichtig die Artikel, Fotos und Bilder, welche in den
traditionellen Druckschriften erscheinen, wie auch einige
Texte Bücherauszüge waren, sowie auch Flugblätter, in dieser
Zeit herausgegeben wurden, da hauptsächlich die Ersten ein
treues und stetes Leserpublikum hatten. Wir begehren nicht das
ganze Material zu analysieren, aber nur einige Themen, welche
wir sehr illustrativ schätzen, und welche eine eigene
Gesprächsdichtung mit dem Inhalt welcher ihnen vorausging,
haben.
Die Feier des Sieges
Die Nachricht über Hitlers Sieg wird fast in allen Schriften
Die dreissiger Jahre sind Grund
unzähliger Feiern und auch Gedächtnisfeiern in den Kalendern
und anderen Druckschriften der deutsch-brasilianischen
Gesellschaft. Im Jahre 1924, feiert die deutsche Einwanderung
in Brasilien ihre Hundertjahrfeier, aber erst in 1934, also
zehn Jahre später, wird der 25.er Juli als staatlicher
Feiertag in Rio Grande do
Sul eingesetzt. Im Jahre
1929 stirbt Wilhelm Rottermund,
eins des Symbols der deutschen Kultur in Brasilien und in den
Nachruf-Ehrenfeiern, erinnert man sich an sein wichtiges
Schaffen als Pfarrer und Schriftsteller (KDB, 1930). Im selben
Jahr, sein Nachfolger, Hermann Dohms, erreicht die
Angliederung der Evangelisch-Lutherischen-Kirche in Brasilien
an den Deutschen Evangelischen Kirchbund.
In 1931 begeht der "Kalender für die
Deutschen in Brasilien" sein 50-jähriges Bestehen und in 1934,
der "Koseritz Volkskalender",
seine 60 Jahre.
In diesem Jahrzehnt wird Getülio Vargas das Oberhaupt der
brasilianischen Nation, ein "gaúcho"
der von Seiten der Deutschen hochangesehen wurde, und welcher
in seinen Betrachtungen, ihnen grosse Hoffnung in Hinsicht auf
ihr wirtschaftliches Schaffen, machte.
Im Jahre 1933 wurde Adolf Hitler
Deutschlands Kanzler und versprach die Wiederherstellung des
Landes dank der Arbeitskraft und des Willens seines Volkes,
und dass unter seiner Führung, das III Reich gegründet würde
betrachtet und wie eine Revolution behandelt:
Die Umwälzung in Deutschland, die
"nationale Revolution" oder der "Aufbruch des Volkes", ging
von dem Gedanken nicht aus, dass der Staat das Volk ist, zu
dessen Dienst sich jeder einzelne unterordnen muss. Während in
den demokratischen Regierungsformen der Staat nichts weiter
als das Werkzeug 1st, dass dem Menschen die volle Möglichkeit
der Entfaltung bieten soll, stellt der Nationalsozialismus das
Volk, dargestellt durch den Staat, an erste Stelle. {KDB.
1934, S. 134)
Hitlers Sieg wird auch als der Triumph
des Willens eines Volkes unter der Leitung des Führers
angekündigt, und von nun an, alles was in Deutschland von
jetzt ab, sich ergibt, wird dieses Willens spiegeln. (KVK,
1934, S. 97-98)
Der Feier-Geistes, welcher von den
Gedächtnisfeiern der Immigranten und ihrer Nachkommen, wie
auch von dem Sieg des Nationalsozialismus begründet war,
erweckt in zahlreichen Journalisten und Schriftsteller den
Willen, um einem nie gekannten Masse, die Erinnerungen und
Andenken der Immigration wiederherzustellen und erzeugen
dadurch eine sogenannte "offizielle Geschichte" die das
interne Zusammenhalten der Gruppe erreichen und den Heldenmut
dieses Segmentes in Brasilien anfordern sollte. Ob es Einzelne
Geschichten waren (von einer Kolonie oder eines Individuums)
oder eine Geschichte die der gesamten germanischen Bevölkerung
in diesem Lande, anging, sie charakterisierten sich nicht
mehr, als einfache episodische Erzählungen die in dem lokalen
Patriotismus begründet waren. Man verlangte von diesen
Geschichten, dass sie die Gegenwart dieser Gesamtheit
orientierte und es erlaubte, dass alle sich als Träger einer
gemeinsamen Vergangenheit erkannten. Es waren Schäften die
wissenschaftlich sein vorhatten, denn sie hatten eine genaue
Richtlinie und Einleitung der Dokumente, wie auch ein ebenso
genaues Verzeichnis der Namen und Daten; es handelte sich um
das "germanische Element” (das deutsche Volkstum)
augenscheinlich zu machen, ein Geist der' unter allen Gliedern
dieses Volkstums herrschte und der Ihnen eine Zukunft mit
grossen Schöpfungen, zusagte.
Wie jeder Geschichte durch den anthropogonischen Begriff orientiert
war, so war die subjektive Ansicht noch vielmehr
augenscheinlich: sie verfolgten ihre Herkunft und dadurch,
fanden sie Gründer, welche die Pioniere, der König, die Kirche
oder die eigene Immigration sein konnte. Ihr Stil
charakterisierte sich durch Zeichen in der Art der
Erzählungen, welche sich der religiösen Betrachtungen ähnelten
- eine feierliche Sprache mit Begnadigungen der Vergangenheit,
mit Einschaltung von Gedichten und Einberufungen grosser
Helden.
Aus diesen Erzählungen, entnehmen wir
drei wichtige Beispiele, weil sie auf interessanter Art, diese
Beschreibungen erläutern.
Maria Kahle, Autorin des Buches Siedler
in Itajahy, war keine Immigrantin und wohnte auch
nicht immer in Brasilien. Sie kam in 1913 als Vertreterin der
Firma Bayer & Co, in Rio de Janeiro; während des ersten
Weltkrieges, wurde sie in Blumenau ansässig, wo sie fürs Rote
Kreuz, 400.000 Mark sammelte um ihren Volksgenossen zu helfen.
Sie fuhr nach Deutschland im Jahre 1920 zurück und kam erst wieder
im Jahre 1934 nach Brasilien um der Herausgabelinien einiger
deutschbrasilianischen Zeitungen zu helfen.
In diesem oben genannten Roman, erzählt
sie die Geschichte dreier Generationen einer selben Familie,
welche nach Blumenau im Jahre 1852 eiwanderte, deren
Erfahrungen illustrierten die wichtigsten Ereignisse der
Immigranten deutscher Herkunft. In diesem Roman, wird eine
chronologische Struktur gezeigt, wo einfache, arme, arbeitsame
und mutige Männer und Frauen, von einem traditionellen und
gemeinschaftlichen Geist gefördert, die verschiedenartigen
politischen Konjunkturen ihrer Zeit, entgegentreten.
Das Buch beginnt mit dem Leben ihrer
Roman-Figuren noch in Deutschland, einer, ist Hans, welcher
verfolgt wurde, weil er in der revolutionären Bewegung für die
Einheit Deutschlands in 1848 gekämpft
hatte. Enttäuscht
mit seiner politischen Niederlage, entschied er sich nach
Blumenau auszuwandern, trotz des Widerstandes seiner Frau
Margareth, welche in dem Verlauf der Erzählung die Liebe und
das Heimweh zur Heimat, symbolisiert. Der Zweite, Phillip,
entscheidet sich das Vaterland zu verlassen, weil er sich
seiner Stiefmutter verliebt hatte, eine verbotene Liebe,
dessen Enttäuschung er durch sein ganzes Leben
hindurchschleppte.
Die hauptsächlichste Charakteristik
Margareth, wie wir schon vorher nannten, war die Liebe zur
Heimat, und auch zu ihrem Gatten und den Kindern. Ihr Erbteil
ermöglichte es der Familie die Kosten der Reise zu bezahlen;
ihre häusliche Arbeitsamkeit half den Arbeiten des Mannes
ausserordentlich. In dem sie den Kindermärchen erzählte, half
sie in der Erhaltung der Muttersprache, und trotz ihres steten
Heimwehs, ermutigte sie alle, um der Arbeit und den täglichen
Schwierigkeiten zu bestehen.
Die Männer arbeiteten unermüdlich in der
Landwirtschaft, Bemühung die erst nach zwanzig Jahren, belohnt
wurde. Die Kolonie machte Fortschritte und bald gab es ein
Städtchen mit Schulen und einer Kirche. In derselben Zeit in
der die Familie die Früchte der Bemühungen erntet, erlebt
Deutschland die Vereinigung durch Bismarck, und alle
identifizieren sich mit den Ideen des Grossdeutschlands.
Die dritte Generation verfolgt die
Ereignisse des ersten Weltkrieges; in diesen Kapiteln, ist
Maria Kahle besorgt alle Begebenheiten und ihre Folgen, in den
kleinsten Einzelheiten für beide Länder, zu beschreiben. Zwei
männliche Glieder der Familie entscheiden sich, freiwillig,
sich zum Dienst des deutschen Heeres, anzuwerben. Als sie
dann, im Jahre 1919, vom Kriege zurückkehren, erzählen sie von
den Konsequenzen der Niederlage in Europa. Dieser Erfahrung
hilft ihnen festzustellen, dass der deutsche Traum vernichtet
wurde, und, dass es sich nicht lohnt ihn in Brasilien, zu
verteidigen. Trotzdem, einige Jahre später, als sie die
dauernden Nachrichten der Schwierigkeiten im Heimatland
verfolgen, begeistern sie sich auch wieder zu der
Wiederherstellung der Ehre ihres Volkes beizuhelfen,
da sie ja von den Entsetzlichkeiten welche die deutschen
Brüder erlitten haben, verschont wurden. Diese
Gewissenhaftigkeit entspringt in dem Moment, als das jüngste
Glied der Familie, der Enkel Hans, entdeckt, als er seine
Reliquien untersucht, dass sein Grossvater zu der Bewegung des
Jahres 1848 gehörte; er fühlt dann, dass er der Erbe der
Mission seiner Vorfahren ist, und entscheidet sich, nach
Deutschland zu fahren, denn jetzt, hatten sie ja einen Führer,
der sie zu der Einheit führen konnte.
Die Verfasserin
beendet die Erzählung mit folgenden Worten:
Hatte Deutschland nicht ein Unrecht auf
seine Kinder, auch auf die ferngewanderten? Blieb Deutschland
nicht immer die Mutter, die ihnen Blut und Art und Seele gab -
die Mutter, die Macht hatte auch über ihre Träume in der neuen
Heimat, und in diesen Träumen sie rief?
Der zweite Verfasser den wir hervorheben ist Karl
Oberacker. Er war Pfarrer und Hess sich, definitiv in
Brasilien, nieder. Anders als Maria Kahle, versuchte er, eine
wissenschaftliche Abhandlung seiner Geschichte über die
deutsche Einwanderung, zu geben. Seine Arbeiten wurden von
Personen die sich für das Thema interessierten, in Deutschland
wie auch in Brasilien gelesen, so legte er die Immigration als ein kulturelles Phänomen, aus und widmete
sich, in einer methodischen Weise den Eintragungen der
Vergangenheit. [91]
Chronologisch beginnt seine Geschichte
im Jahre 1824, als die erste kaiserliche Kolonie sich in São
Leopoldo niederliess.
In seinen Betrachtungen in Hinsicht auf
das soziale Profil und den politischen Tendenzen dieser
Gruppe, behauptet Oberacker sie seien konservativen, endogam und isolieren sich der
Empfangsgesellschaft, eigene Charakteristiken der
Bauern-Mentalität, welche der Verfasser als positiv schätzt.
Er erinnert sich, dass die Immigranten
immer der monarchischen Regierung zugeneigt waren; diese
Haltung ist mit ihrem Konservatismus harmonisch; dessen
ungeachtet, wurden sie, während des Kaiserreiches,
unterschiedlich behandelt, weil sie Ausländer waren und der
evangelischen Religion angehörten; er bezieht sich mit
Lobsprüchen auf die Handlungen Koseritz
und Rotermund, Leiter dieser Gemeinde in dieser Zeit.
In dem Text, in welchem er sich auf die
Hundertjahrfeier der brasilianischen Republik bezieht, schätzt
er dieses Ereignis als sehr ausdrucksvoll für die Gemeinde
welche er begutachtet, denn, durch diese neuen Regime,
erreichten die Glieder das Recht sich in die
institutionalisierte Politik einzureihen.
Seine Geschichte zeichnet immer ein
Abstand zwischen der deutschbrasilianischen Gemeinde und den
anderen Segmenten des Landes, ab; jene sind Freunde oder
Nachbarn der Anderen, immer gewillt zu helfen zu Gunsten der
wirtschaftlichen Entwicklung, aber in keinem Moment, wurden
sie, als Landsmänner anerkannt.
Oberacker zeigt seinen Widerstand zu
irgendwelcher Art von Mischung und seine Verpflichtung mit dem
Deutschtum in verschiedenen Momenten, wie zum Beispiel, mit
einem scharfen Kommentar welches er gegen Koseritz hervorbrachte, dieser, mit
dem Blick seiner politischen Wichtigkeit, hatte nicht den Sinn
des Blutes und der Rasse verstanden. Übermässig liberal,
verheiratete sich mit einer Brasilianerin, und von seinen
Erben konnte man nichts, dass sich mit der Grösse seines
Vorfahrens vergleichen lassen konnte, erwarten (...) (apud GERTZ, 1987, S. 92)
Der eigenartigste dieser drei Verfasser,
die wir ausgewählt haben, ist Friedrich Sommer, ein
Pangermanist weniger verschwiegen als Oberacker. Derweil Maria
Kahle die Geschichte des Deutschtums in Brasilien einweiht in
1848 und Oberacker in 1824, Sommer behauptet, dass es in 1419
beginnt, als die ersten Deutschen ihre ersten Kontakte mit
Portugal unternahmen.[92]
Die Auswanderung dieser Sippen nach
Portugal, und später nach Brasilien, wird von diesem
Verfasser, als ein nicht trennbarer Instinkt ihres Charakters,
der starke Wunsch zur Erweiterung ihres Lebensraumes,
angesehen. [93]
Anschliessend, organisiert der Verfasser
eine lange Liste von Namen, die sich in den verschiedensten
Handlungen und Aktivitäten in der brasilianischen Gesellschaft
auszuzeichnen. Er beweist statistisch, dass für 40
Brasilianer, wenigstens Einer ein deutscher Erbe war und auch,
dass 20% der brasilianischen Bevölkerung reine Deutsche waren.
Er versichert, dass selbst die Bandeirantes irgendwie Elemente dieser Herkunft
hatten, wie auch die Wissenschaftler welche mit Mauricio de
Nassau kamen, - er selbst war ein Deutscher der im Dienst der
holländischen Regierung stand. Er bezieht sich auf die
Autorität Oliveira Viannas um seinen Thesen Glaubenskraft zu
verleihen, denn, laut der bestätigenden Meinung, dieses
Verfassers besass die brasilianische Aristokratie einen
dolichokephalen Schädel, also arianisch. Die Prämisse, dass
das Blut die Rasse bestimmt und die Rasse das kollektive
Schicksal, kann durch diesen Artikel bemerkt werden:
Denn was sind unsere Auslanddeutschen
anderes als deutsche Blutsinseln Im Völkermeer, Vorposten und
Stützpunkte, jeder Träger deutschen Erbguts aus uraltem
Stoffe. Das lässt sich nicht durch ein paar Jahrzehnte oder
Jahrhunderte Aufenthalt im Auslande verwischen. Die deutschen
Ahnen sind im Blute vorhanden, sie werden fortgeerbt bei jeder
Heirat, weitergetragen durch die Zukunft, und sie lassen sich
nicht ausrotten; den zäh sind wir Deutschen, das muss man uns
lassen, und so sind auch die Erbkeime,
die von uns ausgehen, untilgbar. (S. 42)
Diese drei Erzählungen, die wir als eine
Sammlung heldenartiger Erinnerungen betrachteten, erlaubt es
uns einige interessante Beobachtung zu machen, sowie auch die
Abbildungen welche sie auf sein Leserpublikum hinzuleiten.
Maria Kahle bemerkt in den Lesern den
Wunsch der Rückwanderung, eine idealisierte Sehnsucht nach der
Heimat, jetzt wiederhergestellt. Aus diesem Grunde,
wahrscheinlich, identifiziert sie die Revolutionäre von 1848
die bei der deutschen Siedlung in Brasilien zugegen waren -
wie die Nationalisten welche den Aufstieg Hitlers in 1933
vorbereiteten, als ob die Zeitpanne, zwischen diesen beiden
chronologischen Grenzsteinen, für die Bauern, eine leere Zeit
darstellte, als ob in sie immer auf die gegenwärtigen
Ereignisse gewartet hätten.
Oberacker ist ein Sozialwissenschaftler
und deshalb, weiter von dem Publikum entfernt, derweil er
berichtet, ist er auch ehrgeiziger in Hinsicht auf mögliche
Effekte seiner Betrachtungen über die Gesellschaft. Ausserdem
war er ein Deutschbrasilianer, und war sich auch bewusst, dass
nicht jedes Mitglied des Deutschtums nach Deutschland
auswandern konnte. Pragmatisch in seiner Art betrachtete er
die Hypothese, dass es möglich wäre, sich vereinigt zu
erhalten in einem Staate, welcher sie zu einem Weg in der
Richtung der Entwicklung zu schreiten, benötigte.
Wahrscheinlich glaubte er, wie auch schon Arthur de Gobineau davon überzeugt war, [94]
die überlegenen Rassen würden natürlicherweise über alle
anderen die Erhabenheit erreichen. Die Nähe der
nationalistischen Ideenwelt der Deutschen im Ausland mit dem
Land ihrer Herkunft, könnte zu einer grösseren Annäherung der
beiden Staaten verhelfen, wie es schon von seinen
pangermanistischen Vorgänger aus Hamburg eingegeben wurde.
Die Ideen Sommers über die Herkunft des
germanischen Volkes scheinen uns näher den
nationalsozialistischen Begriffen in Hinsicht des arianischen
Mythos. Für Sommer, die Rasse, ergo, die Nation; bildet sich durch die
Blutsverwandtschaft und nicht durch die Ähnlichkeit des
Charakters oder die sprachliche Identität. [95]
Es ist das Blut welches die wirkliche und unauflösliche
Verbindung herstellt und die Kohäsion der individuellen Zellen
versichert, von welchen sich der soziale Organismus bildet.
Diese Kenntnis von Voigt ausgearbeitet,[96]
der Eingeber der eugenischen
Politik während der Nazi-Regimes erlaubt es, dass Sommer die
germanische Geschichte erforscht von dem Moment an in dem der
erste Deutsche sich des Landes näherte welches Brasilien
kolonisierte.
Die Schriften der Verfasser, wie Kahle,
Oberacker und Sommer die, die Geschichte dieser Volksgruppe
niederschreiben, geben den Lesern ein, dass sie die
Möglichkeit haben, effektive Mitglieder eines anderen Reiches
zu sein, dazu müsste nur ein Erfordernis beobachtet werden: in
definitiv, die Bedingung als Gäste des Landes in dem sie
lebten, anzunehmen. Über diese besondere "Historiographie",
äussert sich Sommer:
Es bleibt jetzt der deutsche Volks- und
Blutsgenosse in Brasilien, wie an allen Punkt der Erde, ein
Teil der Hundert Millionen, die sich, unabhängig von
zeitlicher und räumlicher Trennung, als Angehörige eines
Volkes, eines Stammes, einer Familie betrachten. sich
gegenseitig mit gleicher Achtung und Treue umfassen und sich
die Hand reichen und stützen, wenn es Not tut. Aus diesem
Bewusstsein einer hoffnungsvolleren Zukunft und aus den
Erkenntnissen einer ebenso stolzen, wie leidvollen
Vergangenheit, schöpfen wir Brasildeutschen die Kraft, täglich
von neuer deutscher Arbeit auf brasilianischen Boden zu
Deutschlands Ehre und für Brasiliens Grösse zu leisten. (S. 44)
/
Als man behauptete, dass die dreissiger
Jahre, eine Zeitspanne in der die Homogenisierung der
Betrachtungen, in deutscher Sprache in Brasilien ihre Grenze
in dem Erfahrungen erreicht hatte, ist es nötig zu bedenken
dass dieselbe Presse, die, in grossen Massstab für diesen
Prozess verantwortlich war, nicht die inerten Unterschiede und
die Spannungen zwischen den Leitern des Deutschtums,
Schriftstellern und dem Leserpublikum, entfernt hat.
Aus diesem Grunde, eine dieser Frage,
welche von da ab, die Erwartungen der Zeitungen und Kalender
ausfüllen, sich dem der Assimilationsprozess beziehen, welches
hauptsächlich von Mitgliedern der jungen Schichten dieser
Subgruppe erlebt wurde, in der Tat, hat dieser Prozess ein
Verhältnis der Selbständigkeit der Vertreter des Deutschtums,
beibehalten, mit Ausschluss des ersten Weltkrieges, als Viele
zur Isolierung gezwungen waren, wegen der Diskriminierung, die
sie leiden mussten. Aber, im Allgemeinen, war die natürliche
Tendenz der Enkel und Urenkel der Immigranten sich in den
brasilianischen Schulen einzuleben und dann, sich in dem
Arbeitsmarkt der empfangenden Gesellschaft, einzuschalten,
denn die Möglichkeit sich in den wirtschaftlichen Arbeiten die
von ihrer eigenen Gemeinde angeboten wurden, immer weniger
waren.
Die Assimilation der Deutschen wird auch
von anderen Wissenschaftlern, die sich demselben Thema
widmeten, 29 bestätigt.
Diese Feststellungen bewahrheitet sich in den
Analysen von PAIVA (1984) und WILLEMS (1980), für welchem,
dieser Zeitabschnitt, einer in dem die Gewohnheiten der Kultur
der Vorfahren stark vernachlässigt werden, befindet sich, dass
es notwendig ist, die Jugend zum Deutschtum, zu erobern. 3(3
Um die Gesinnungen zu analysieren,
welche die Verteidiger des Nationalsozialismus in der
Lesergemeinde beschützen, suchten wir eine Spalte aus dem
"Kalender für die Deutschen in Brasilien" aus/ unter dem Titel
"Kalendermannstandrede”, welcher mit Hilfe eines literarischen
Kniffes, versucht mit den verschiedenen Tendenzen und
Stellungen der Leserpublikum ein Gespräch zu führen. Der
Kalendermann, der Herausgeber des Kalenders, ist ein
erdachter Musterreiter, der ungefähr einmal im Jahr das
Kaufhaus (a
Venda) einer
schon langbestehende Kolonie, besucht,31 wo er gute Ratschläge
gibt, Nachrichten bringt und den dort anwesenden Informationen
bringt, in einem einfachen Gespräch.[97]
[98]
[99]
Während er mit den Anwesenden Erörterungen macht, welche
oftmals anderer Meinung sind, gebraucht er Namen und
verschiedene Berufe, alle erdacht, welche aber in der
Gesamtheit, eine bestimmte Typologie des dort anwesenden,
verschiedenartigsten Betragens.
Die Gefahr welche die Vollständigkeit
der Gruppe sind, laut des Kalendermanns, ausser der
Assimilation die schon bei der Jugend bemerkt wird, (KDB,
1933, S. 19-26) auch selbst den Arbeitsrhythmus dem sie
untertan sind. Für ihn, die übermässige Sorge mit den
täglichen Bedürfnissen, trennen die Menschen von den höheren
Werten des Lebens.[100]
Eine andere Gesinnung wird auch von ihm
betrachtet - die Klagen und Uneinigkeiten zwischen den
Neudeutschen und den Deutschbrasilianern (die neuen
Immigranten und die Deutschen die in Brasilien schon länger
lebten); das wurde auch durch ein Gespräch in dem Kaufhaus
wiedergegeben, eine Unterhaltung, wo der Lehrer sich bei dem
Pfarrer über die Betrachtungen der neuen Bewohner ihm
gegenüber beschwerte; sie erniedrigten ihn, weil er nicht
Hochdeutsch sprach. Klagte noch über ihr arrogantes Benehmen
in Hinsicht auf die Gewohnheiten der einfachen Leute. In dem
Moment, springt der Kalendermann ein und fordert alle auf, auf
die Notwendigkeit der Einigkeit zu achten, denn es gäbe einen
gemeinsamen Feind - "den Materialismus". Laut des
Kalendermanns,
Steht Schulter an Schulter in deren
entschlossener Wahrung - haltet zusammen gegen den gemeinsamen
Feind, des öden Materialismus, der euch schliesslich doch hur
eine Trostlos-kalte Fratze zeigt statt der versprochenen
Erleuchtung, und der euch nur in geistige und seelische
Versumpfung treibt. (KDB. 1931. S. 45)
Die Nennung dieses internen Feindes ist
wohl an die Leiter der sozialistischen Bewegung in Porto Alegre gerichtet, welche im Jahre 1920 der
"Sozialistischen Arbeiterverein” gründeten, und schon in
dieser selbst Jahrzehnte eine offene Opposition den
Pangermanisten und Nazis ausübte. (KNIESTEDT, 1989, S. 144).
In der Kalendermannstandrede wurde auch
über die Gleichgültigkeit der Deutschen in Hinsicht auf die
Deutsche Geschichte, angedeutet (KDB, 1933, S. 19-26); für
Pastor Rothmann, wäre es nötig sie an den ersten Weltkrieg und
seine schädlichen Folgen in den Kolonien zu erinnern, wie auch
seine unausdrucksvolle Hilfe an
die Brüder der Übersee. Als Pastor Rottmann sich auf die
Jugend bezieht und deren Abweichungen der Kultur ihrer
Herkunft, lobt er den Bauern, der Wächter der Traditionen und
das Symbol der romantischen Kultur, unschuldig und wenig
aufnehmbar des externen Einflusses. Als er den Jüngling mit
dem Bauern vergleicht, nennt er ein Sprichwort, der so gut die
Vergänglichkeit der Leidenschaft der modernen Welt, wie auch
die "rote Gefahr", darstellen konnte - "Heute Rot, morgen
Tot", rät er, und beschliesst seine Rede.
Um die Worte des Pfarrers zu bestätigen,
warnt der Kalendermann:
Wir sind noch ein Heer
ohne Führer, eine Kirche ohne Turm, ein Baum ohne Krone. Und
um dieses gilt unser stiller Kampf. Deshalb ermahne ich euch,
ihr lieben Stammesbrüder, stellt euch nicht abseits, sondern
sagt freudig ja. wenn auch an euch der Ruf ergehen wird,
beizutragen zu dem grossen Bund der deutschstämmigen
Brasilianer. Ihr aber, die ihr Berufen seid zum Führeramte an
unserem Volk, lasst nicht ab, zur Einigkeit zu mahnen und den
Zusammenschluss vorzubereiten, der kommen muss, wenn wir nicht
untergehen wollen. (KDB. 1933, S. 26)
Im KDB der Im Januar 1934 herausgegeben
wurde, brachte die Nachricht, dass in Hinsicht auf die
Meinungsverschiedenheiten der deutschen Gemeinde, wenigstens
in den Augen des Kalendermanns, fanden einen Weg zur Einigung.
Schon auf der ersten Seite des Kalenders gibt man den Sieg
Hitlers bekannt. In der Spalte "Kalendersmannstandrede"
- kommt der Musterreiter ins Kaufhaus und erzählt lachend:
"jetzt haben wir einen Führer von dort oben": Von allen, der
Einzige der keinen Enthusiasmus zeigt ist der Vertreter der
Katholischen Kirche, Pater Nicolaus, welcher sich des
Kulturkampfes in der Zeit Bismarcks erinnert und die
Verfolgung des Klerus. [101]
Der Kalendermann antwortet:
Machtet euch keine Sorge. Wir sind alle
Christen!...) Sorgt dafür, dass unsere Schulen immer besser
werden. (...) denkt nicht immer nur an Geld und Besitz,
sondern erinnert euch, dass es auch noch andere Güter im
menschlichen Leben gibt. (...) Wir sagen immer: es fehlt der
Führer zum wahren Volkstum, oder zur wahren Politik. Wir
verbannen - sei die Zeitungen und Vereine unserer Führer!
(...) Schaut auf das deutsche Volk! Als das Land soweit war.
dass es den Führer brauchte, da wurde er ihm geschenkt und
zwar aus dem Volk heraus. (KDB. 1934. S. 32)
Es ist interessant zu bemerken, dass der
Kalendermann nicht die die Anwesenheit eines politischen
Leiters hervorhebt, aber die Presse, der man die Aufgabe
zuspricht das Amt eines Wegweisers der Handlungen seiner Leser
zu sein. Wenn das die Art darstellt um auf sich die Funktion
einer Führung zu beziehen, er, der Herausgeber, der für die
Herstellung einer Zeitung verantwortlich war, dazu noch eines
Kalenders und verschiedener Schulbücher, oder ob diese
Empfehlung, den Wunsch nicht das Abbildung eines anderen
Führers, aber das des Deutschlands Führer zu sein, ist es uns
nicht möglich zu antworten. Der Grund, dass man die
germanische Kultur in Brasilien leiten wollte, jetzt schon
eine Bewegung, dank der kulturellen Industrie, verleitet uns
an die Herausforderung welche durch die Propaganda gemacht
wurde zu glauben, sei es, die Körper frei zu lassen, wenn nur
die Seelen sicher eingekerkert waren (ADORNO & HORKHEIMER,
1985, S. 125 u. w.J.
So, neben dem Foto von
Massenversammlung, der Fahnen, von Hitler als er das Volk auf
den Strassen begrüsst, der neuen Sinnbilder der deutschen
Nation, Karikaturen der europäischen Gegner, Werbungen des Arzneisyrups, landwirtschaftliche
Maschinen, Seifen, usw., die Kalender und Zeitungen dringen
auf die Organisation der deutschbrasilianischen Politik, wegen
der Notwendigkeit des Widerstandes ihren Gegnern gegenüber,
berechtigt.
Der erste Feind, von dem schon die Rede
war, ist der Materialismus, wegen seines atheistischen
Charakters, wie auch als politisches System, weil es der
Nationalismus widersetzt. In der Tat, die Memoiren Kniestedts,
ein Anarchist aus Porto Alegre,
beschreiben die Konflikte von
den geglückten Anträgen des Sozialistischen Arbeitervereins,
kommend.
Es ging alles gut; überall gab es
Mitwirkungen. Dass stellte einen Balken in den Augen der Nazis
dar, welche zu dieser Zeit, sich ihre Geckenhaft zeigten.
Stahlhelm, Ludendörfler, der
Konsul, die Hitler-Jugend, alle hatten ihre Gruppe hier.
Wir kümmerten uns nie um sie, aber sie
kümmerten sich umso mehr um uns. Nach einigen Versuchen der
Vereinigung dieser revolutionären Brüder der Rechten, gelang
es den Braunen sich zu behaupten. Gründer der Nazigruppe war
ein Spezialist in Emailleartikeln
- Ehricht - ein
gewesener junger kommunistischer Militant (...) (1989, S.
146-47)
Die politische Organisation des Deutschtums
berechtigte sich nicht nur als Existenz einer linken
Opposition, denn, laut den Behauptungen desselben Kniestedt,
stellten diese die Mehrheit des deutschbrasilianischen
Segmentes, dar.
Die AIB (Agáo Integralista
Brasileira) war auch eine Drohung zur gewünschten
Vereinigung, und als der Kalendermann die portugiesischen
Nativisten nennt, ist es gut möglich, dass er sich auf jener
Partei, bezieht.
Die AIB zieht verschiedene Mitglieder
der deutschen Gemeinde, zu sich an, hauptsächlich in Santa Catarina und in Paraná. Ausserdem verbreitete sie die Idee
eines Nationalismus der den Gebrauch irgendwelcher Sprache
oder Sinnbilder verurteilt ausser den Nationalen. Aus diesem
Grunde, wirkte er in einer Art, welche die Massnahmen gegen
die Handlungen der Ausländer im Land, vereinte. Aber eine
andere Drohung, scheint uns noch gefährlicher, für die
Tradition welche die Deutschen bewahrten: die
Nationalisierungs- Bewegung, welche, die deutsche Schulen als
einer ihrer Hauptziele hatte. Ausser dieser Bewegung, rechne
man noch seit 1934, das Verbot der Aktivitäten aller
ausländischen Vereinigungen im Lande, und letztlich, schon im
Jahre 1940, die Untersagung der Druckschriften die fremde
Sprachen benutzten. Mit diesen offiziellen Massnahmen,
radikalisiert sich die Betrachtung der Pangermanisten; wie zur
Zeit des ersten Weltkrieges, der Druck zur Endogamie, die
Bewahrung der deutschen Sprache sind die Leitmotive die sich
stark herausgeben. Wiederum, beschreiten sie das Recht des
freien Ausdrucks, man vergleicht die Rassenmischung einer
Praxis die selbst unter Tieren, unmöglich ist, und der Tausch
einer Kultur um die andere ein unzulässiges Erfordernis; aber
langsam, verlieren diese Betrachtungen nach und nach ihre
Kraft, bewahren ihre echten Merkmale nur im Kalender "Volk und
Heimat".
Vom Jahre 1936 ab, entstehen Fotos der
brasilianischen Obrigkeiten, Lobreden zu ihrem Leben und der
ihres Volkes immer mehr; man empfiehlt auch dass die
deutsche Sprache nicht Öffentlich gebrauchen sollte, und die
Nachrichten über die offizielle Politik der brasilianischen
Regierung ersetzt die Seiten, wo früher die deutsche Politik
verbreitet wurde.
Als die Nationalisierungspolitik sich
verstärkt, im KDB von 1939, verabschiedet sich der
Kalendermann im Kaufhaus, mit der Behauptung, dass er nicht
mehr in diese Kolonie kommen würde. Im Jahre 1940, fallt diese
Spalte aus. Im Gegensatz, bekommen die Leser einen anderen
Besuch; den des Getülio Vargas
der aus Blumenau kommt und ihnen eine Botschaft bringt;
Ich kann es nicht unterlassen, meine
Überraschung und meine Bewunderung auszudrücken, die ich beim
Betreten eines Munizips wie
Blumenau empfunden habe, eines Munizips,
das im Kernpunkt des kolonialen Gebietes liegt, von dem man
sagte, dass dort die portugiesische Sprache unbekannt und das
Gefühl der Brasilität erstorben
sei.
Ich habe die gegenteilige Empfindung.
Ich habe überall und von allen Selten den Ausbruch
freiwilliger und feuriger Begeisterung, das Gefühl
brasilianischer Brüderlichkeit und Liebe zu unserem Lande, den
ausdrücklichen Wunsch, unser Leben als Brasilianer mitzuleben, bemerkt. Diese
Verwandlung, die niemand verdunkeln darf, wurde mir von allen
Seiten bezeugt (..) (...) Es sind 90 «Jahre verflossen,
seitdem die ersten deutschen Kolonisten im Tale des Itajahy eintrafen. (...) (...) Man
sagt, es kostete viel, dass sie sich in die nationale
Gemeinschaft einfügten und die portugiesische Sprache
erlernten. Aber die Schuld liegt nicht bei ihnen; es ist die
Schuld der Regierungen, die sie isoliert in den Wäldern in
grossen Gemeinschaften, ohne Verbindung Hessen. Alles was die
Kolonisten damals verlangten, war zweifacher Art, Sie
förderten nur zwei Sachen: Schulen und Strassen. Strassen und
Schulen. (...)
(...) Die Regierung, die um Stimmen
warb, verlor alles Ansehen, weil sie von den Abstimmungen
abhängig war, und der Wechsel dieser Abstimmung diente nicht
den wahren Interessen der Nation.
Heute sind die Sachen geändert. Die
politischen Parteien, die früher regionale Verbindungen ohne
nationale Ziele waren, wurden aufgelöst. die Regierung kommt
nicht mehr zu den Kolonisten, um Stimmen zu werben; die
Regierung hat väterliche Gefühle für sie und nähert sich
ihnen, um ihnen zu helfen (...)
Jetzt ist diese Bevölkerung, die so
viele Jahre ihre' Tätigkeit auf dem Boden unserer Erde
entfaltet hat und die aus den Kindern und Enkeln der ersten
Einwanderer besteht, brasilianisch. Alle sind Brasilianer (...) Aber
Brasilianer sein heisst nicht nur die Gesetze Brasiliens
achten und seine Behörden ehren. Brasilianer sein heisst,
Brasilien lieben. Es ist das Gefühl, das da sagt: "Brasilien,
du gibst uns das Brot; wir werden dir unser Blut geben! (KDB.
1941, S. 44-45).
In diesem selben Jahr, wurde der Umlauf
jener Zeitungen, welche noch die deutsche Sprache gebrauchten,
verboten; neue Aufstände, neue Boykotts gegen Elemente dieser
Herkunft wurde organisiert. Im Gegensatz aber zu dem ersten
Weltkrieg, nahmen an diesen Demonstrationen nicht nur
Vertreter der bürgerlichen Gesellschaft teil, aber auch
offiziellen Politiker, die jene Initiative im Namen der
Stärkung der demokratischen, westlichen Werte anforderten. [102]
Wenn wir die wichtigsten Momente des
Weges, welchen die Proselyten des Nationalsozialismus gegangen
sind, und den Einfluss über die Druckschriften in deutscher
Sprache beobachten, sind wir verführt, diesen Prozess als eine
Bewegung ideologischen Charakters anzuerkennen, ebenso fahren
wir mit unserer Analyse fort, über die Ausbreitung des
Rassismus Seitens der Pangermanisten, welcher die Mentalität
der Deutschbrasilianer imprägnierte, seit Ende des 19.
Jahrhunderts. Tatsächlich, wenn wir die Ausdrucksweise der
Nazipropaganda, sei es bei der Auslandsorganisation, sei es
von den Pangermanisten die sich dem Nazismus zukehrten, oder
der Neudeutschen, stellen wir fest, dass ihre Logik sich auf
den Bedürfnissen der Verbreitung einer Zusammenfügung der
Kraft-Ideen, begründete, die im Augenschein hatte, das ganze
kulturelle Feld welches beherrscht werden sollte, zu beziehen.
Allerdings, wenn wir die Überlegungen Hannah Arendt analysieren, ziehen wir es vor, uns eines
anderen Weges leiten zu lassen; nach Meinung dieser
Verfasserin, kann die Organisation der totalitären Bewegungen
und Regierungen nicht einer Pyramidenstruktur gleichgestellt
werden, was gesagt werden muss, dass sie nicht einer Beziehung
der Oberherrschaft von oben nach unten beruht; für Hannah (1972, S. 136 usw.), das Sinnbild des
Totalitarismus kann wie eine Zwiebel vermutet werden, denn der
Kern des Systems ist nicht über und auch nicht ausser ihm,
aber in seinem Innern. Um ihn herum, wie konzentrische Kreise,
legen sich die anderen Segmente, die von der Partei - Elite,
ihrer Bürokratie, ihre Glieder, bis zu den einfachen Sympathisanten, an.
Dieses Modell gibt uns das Verständnis, dass es keine
wichtigen Verschiedenheiten unter ihren Gliedern gibt, aber in
den Funktionen die sie ausüben; ist es als ob sie Zellen
eines selben
Organismus wären.
Wir achteten ganz besonders noch darauf,
die Behauptungen von Dominique Pelassy
zu zerlegen, (1983), laut ihrer Meinung, wenn auch die
Ideologie sich der subjektiven Faktoren bedient - oftmals mit den unmittelbaren
Bedürfnisse der Individuen sich vereinigt, wenn auch der
Nazismus sich dieses Mechanismus angenommen hat, die Ideologie
setzt immer die Überzeugung voraus, es ist wichtig
festzustellen, ein Regelbund welche sich einem Fundament
rationaler Ordnung unterordnet; deswegen, wird sie immer
verletzbar und zur Widerrede empfänglich sein. Zum Unterschied
dieses Prozesses, das mythologische Abbild dessen sich der
Nazismus genährt hat, verhinderte diese Möglichkeit, in der
Hinsicht, dass seine Mitglieder nicht nur passive Elemente des
Diskurses waren, aber gleichzeitig derer Erzeuger.
Was aber das Verständnis dieser
Begebenheiten erschwert, Seitens des akademischen Denkens,
ist, dass irgendwelcher Versuch, sich zu organisieren oder
eine intellektuelle Ordnung einer symbolischen Materie zu
geben, bringt uns dazu die fundamentale Unordnung welche ihr
zu eigen ist, zu verraten.
Diese Analyse scheint uns noch
verwirrender, wenn man versucht ihre Effekte in einer
Gesellschaft, die von weitem den Aufstieg und die Befestigung
der Bewegung, beobachtete, und die von dieser Bewegung, in
einigen Momenten gefangen wurde, zu studieren. Diese
geographische Entfernung, welche eine grössere Idealisierung
jener Begebenheiten erlaubte, mit der Mannigfaltigkeit der
überlegenden Verschreibungen, vereint, welche nicht immer
untereinander übereinstimmten, wie schon beobachtet wurde,
ergab die Möglichkeit verschiedenartiger Weise aufgenommen zu
werden, was, in der Zäsur, unzählige Risse in jener
politischen Kultur, herausforderte.
In diesem Sinne, wenn auch die Bewegung,
die im Süden Brasiliens sich offenbarte, in den
Deutschbrasilianer einen galvanisierenden Effekt hervorruft,
der die Behauptung ihrer kollektiven Identität nicht
begünstigte, wie es das Deutschtums- Prinzip in den
vorgehenden Jahrzehnten getan hatte. Denn verwarfen die Nazis
verschiedene Teile dieses sozialen Segmentes, aus völkischen
kulturellen oder politischen Gründen. Sie nahmen nicht jene
die, nicht die deutsche Sprache perfekt beherrschten, an, auch
nicht die "Mestize", oder die nicht die deutsche Bürgerschaft
besassen, die sich an der internen Politik beteiligten;
derartige Handlungen, erzeugten dass ihre Vertreter sich
weniger als Verbreiter einer Lehre die sich verallgemeinern
sollte, betrugen, eher aber als Mitglieder einer Sekte, die
sich von allen anderen absonderte und alles verwarf, was "auf
der Aussenseite" ihrer eigenen Gruppe war; entsagten dieser
Welt, um würdig zu sein, wenn sie sich treu bewahren würden,
zu dem was die andere Welt ihnen bieten würde.
So wie, das Deutschtum zur Stärkung der
sozialen Zusammenschliessung führte, und sie inwendig
einförmig machte (Blut, Sprache, Kultur) so erreichte der
Nazismus die äussere Einförmigkeit, denn, in Anbetracht des
sektiererischen Charakters ihrer Leiter, wurden alle, wie
Bohle es erträumte, als vollständige Deutsche, ergo, wie vollständige Nazis, angesehen.
Aber, bis zur Zeit des Estado
Novo (Neuen
Staates), welches ihren "Einigkeit" unterbrach, das
Deutschland Hitlers wirkte in Ihnen, ein naheliegendes Gefühl,
wenn nicht das gleiche, welches sich spüren lässt, durch eine
Erfahrung religiöser Art, aus; und die Religion, ihrerseits,
verwandelt sich in einer Bewegung säkularen Charakters, die in
der Öffentlichkeit eindringt und in ihr, ihre Nation, ihren
Leiter und ihr Volk, ankündigt, Ausarbeitungen, die wir, in
dem' nächsten Kapitel, versuchen werden zu analysieren.
PIETISMUS,
PATRIOTISMUS UND NATIONALSOZIALISMUS
Visto terem sido os cristäos a mancharem-se com os horrendos
crimes de
Auschwitz e Buchenwald, quando a
sua obra foi
terminada, o seu
Deus tornou-se Impossivel.
Dietrich Bonhoeffer
In dem 30. Jahrzehnte, schlossen sich
die Evangelischen Gemeinden, die sich in Santa Catarina und Paraná Niederhessen, [103]
[104]
an dem
"Deutschen Evangelischen Kirchenbund" an, wie es auch die
Riograndenser Synode schon in 1928 gemacht hatte. Dank dieses
Entschlusses ermöglichte sich eine politische Annäherung
zwischen die deutschbrasilianische Pfarrerschaft und die
Mutterkirche, sowie die Hoffnung einer ausdrucksvollen
finanziellen Hilfe aus Deutschland, sei es für die
auftauchenden Gemeinden, oder für diejenigen, die schon
konsolidiert waren; solche Verbindung erforderte
zur Erneuerung,
einen ständigen Vertreter der Mutterkirche in Brasilien im
Range eines Propstes, der auch das Deutsche Konsulat streng
vertrat.
In 1933, organisierten sich die
"Deutschen Christen" in einer para-ekklesiastischen
Assoziation mit korporativem Charakter, die praktisch von der
Kirchenleitung unabhängig war, aus Pfarrern und Laien bestand,
deren Hauptziel die Pfarrerschaft und Gläubigen auf die
nationalsozialistische Ideologie, durch ihre "neue Theologie"
hinzuziehen.
In den folgenden Monaten war die Anzahl
der "Deutschen Christen", unter der Führung des Pfarrers Erich
Knäpper so gewachsen, dass die
soziale Beziehung der Evangelischen Vereine eine
organisierende und prägende Macht wurde. Diese Gruppe spielte
eine so bedeutende Rolle, dass in kurzer Frist, in der
Riograndenser Synode mindestens zwei Drittel ihrer Mitglieder
sich mit der Nazilehre identifizierten, und sich in der NSDAP
eingegliedert hatten; dieselbe Tendenz war auch, in grossem
oder kleinem Masse, in anderen Synoden zu bemerken.
Man kann diesen Siegeszug auch auf die
religiösen Veröffentlichungen hinweisen, wie der "Kalender für
die Deutschen in Brasilien", "Der Junger Kämpfer", "Deutsche
Evangelische Blätter für Brasilien", "Evangelische
Volksblatt", "Synodalkalender", usw., welche in ihren
Leitartikeln die Begeisterung zur nationalsozialistischen
Machtergreifung, erklärten.
Die Leistungen der "Deutschen Christen"
unter den Jugend- Vereinigungen wachsen nicht in
arithmetischer, sondern in geometrischer Progression; diese
stiegen von 12 Ortsgruppen zu 79, die zu mindestens 3.000
Mitglieder umfassten, welche einem auserlesenen
Rassebewusstsein imprägniert wurden, sowie auch von dem
missionarischen Geist um die Seele für Deutschland und für
Christus einzulösen.
In 1936, wurde die "Evangelische Jugend"
"Jungvolk” genannt, und ähnelte immer mehr der Laienbewegung
"Deutschbrasilianer Jugendring”, eine Organisation die zu der
"Hitlerjugend" in Deutschland angeschlossen war.
Es ist interessant die Hymne des
"Jungvolkes" hervorzuheben, welche ihr Gelöbnis ab 1936 wird:
Wir geloben:
Dir. Gott der Vater
dient die junge Schar,
Dein Wort bleibt
heilig, wie es immer war.
Wir sind bereit.
Dein ist die Zeit!
Wir geloben:
Dir. Volk der Väter,
sind wir ganz geweiht.
Dein Blut vergeht
nicht, denn wir sind bereit.
Keiner zerbricht.
Steige zum Licht!
Wir geloben:
Dir. Land der Väter
gilt der schwere Schwur
Die
Heimaterde sei uns heil’ge Flur.
Wir sind die Wehr!
Dein ist die Ehr!
(apud
DREHER, 1984. S. 145)
Diese fast sofortige Annahme des
Nationalsozialismus von Seiten der
Deutsch-Evangelischen-Kirche in Brasilien soll im Lichte der
politischen Konjunktur Deutschlands gedacht werden; in 1933,
verteidigte eine Gruppe aus der Deutschen Pfarrerschaft, die
sich auch "Deutsche Christen" nannten, den christlichen
Charakter der Revolution und rief die Partei als ein
Kampf-Instrument gegen den marxistischen Atheismus auf;
ausserdem, wurde die rassische und politische Säuberung unter
den Kirchenmitgliedern geprägt - eine Rede, die gegen die
Liberalen Theologen und andere durch den
Assimilationsprozesses zu dem protestantischen Glauben
bekehrte Volksgruppen gerichtet wurde. Die "Deutsche Christen”
hatten noch vor, die Vereinigung aller evangelischen
Konfessionen unter einem einzigen Führer - den Reichsbischof -
laut des Führer-Prinzips - sowie den des demokratischen
Parlamentarismus endlich ablösenden Führergedankens, und
die Einheit der Kirche mit dem Staat zu erreichen (BRACHER,
1973).
Unter dem doktrinären Gesichtspunkt,
mussten die Theologen sich umorientieren, mit der Verweigerung
des opferreichen Lebens Jesus Christus, und bei der
Verminderung der Wichtigkeit des Apostels Paulus, der die
Verbreitung des Evangeliums in alle Nationen und Völker, sowie
die Gleichheit aller Menschen vor Gott predigte.
Die Mitglieder der "Glaubensbewegung
Deutsche Christen" verstanden, wie die National-Sozialisten,
die Vorteile der Bewegung über die parlamentarische Debatte zu
leiten, weil diese Regeln und Prinzipien berücksichtigt werden
mussten.
Laut Sauberzweig,
Was freilich die Menschen hätte stutzig
machen müssen, war dies, dass die Deutschen
Christen - von
Anfang an mit denselben Methoden vorgingen, wie der Staat bzw.
die Partei (...) Sie verlangten (...) die Annahme des
Arierparagraphen in der Kirche, was darauf hinauslief, die
staatlichen judenfeindlichen Gesetze In der Kirche
einzuführen, Pastoren und Kirchenälteste mit jüdischem Blut
aus ihren Ämtern zu entfernen. Ja schliesslich allen Christen
jüdischen oder halb- und vierteljüdischen Blutes die Teilnahme
an den christlichen Gottesdiensten zu untersagen,
(SAUBERZWEIG, 1959. S. 303-304)
Laut Bracher, (1973), und Aygoberry, (1969), kämpften die
"Deutsche Christen" auch gegen jede Idee, die sich ihnen
widersetzte, seien es säkulare oder religiöse, im Namen der
Abschaffung des Alten Testamentes in der Kirche, eines
Arianischen, Christens, und noch eines vermeintlichen
messianischen Charakters des deutschen Volkes.
So eine, in Vergleich zu den
evangelischen Traditionen verzerrende Vision, könnte
selbstverständlich nicht, von allen Gliedern der Pfarrerschaft
und der Ganzheit der Gläubigen akzeptiert werden, denn ihre
Prämissen waren auf, durch vier Jahrhunderte religiöser Kultur
gegründet. Die aufgeklärten Mitglieder der "Deutschen
Christen" bestanden nur in 10 oder 15% der Protestanten in
Deutschland (NOVAK, 1981). Wenn diese von der Pfarrerschaft
geduldet wurde, ist es nicht der Annahme ihren Thesen zu
verdanken, sondern die relative Sympathie der Kirchobrigkeit
in Hinsicht des Regimes. Laut Aygoberry
(1979, S. 45-50), Anfangs feierten verschiedene Vereine,
welche die kleine Bourgeoisie repräsentierten, die Siege des
Nationalsozialismus als eine Erneuerung des Patriotismus und
einen Triumph über die Plutokratie. Die Arbeit- Mystik, der
anti-Individualismus und der moralische Konservatismus sind
andere Übereinstimmungen von der sozialen und politischen
Ethik der Kirche. (BRACHER, 1973, S. 126). Aus diesem Grunde
verachtete die Evangelische Kirche die Divergenz zwischen
diejenigen und ihrer Stellungen.
Allerdings, waren der Rassismus, die
Gewalt und die Vergötterung des Führers sowie der
diktatorische Charakter des Regimes für die allmähliche
Distanzierung beider Institutionen verantwortlich. Aber trotz
dieses Widerspruches, die Lehre der Trennung der beiden
Reichen (die weltliche und geistliche Herrschaftsweise), deren
Prinzip forderte, dass man beide "als die höchsten Gaben
Gottes auf Erden in Ehren halten müsse", trug dazu bei einem
grossen Teil der Gläubigen gegen der Regime-Tätigkeiten zum
Schweigen zu bringen.
Andererseits waren laut Sauberzweig die
"Deutschen Christen" nichts anderes, als der getarnte Arm der
Partei, um dieser auch auf dem kirchlich-christlichen Gebiet
die Macht zu sichern. Dass sie nicht lange den Klerus
verwalteten, kann man auf das Wahlresultat von 1930 und 1932
hinweisen: von 22.000.000 Protestanten, stimmten 9.000.000 in
der SPD und KPD, ein Prozentual, das geklärt werden kann,
durch die intensive Politisierung der Theologie dieser Epoche
(NOVAK, 1981, S. 296). In dieser Richtung,
könnte die "Deutsche Christen" Bewegung auch als eine Reaktion
zu solchen Tendenzen verstanden werden.
Ausdrucksvoller als die "Deutschen
Christen" wurde die Betätigung der Bekennenden Kirche, eine
Fraktion des protestantischen Glaubens, die in manchem Gebiet
bis 40% der Pfarrerschaften umfasste, welche einen
systematischen Widerspruch gegen die Nazis ausübte.
Unter der Leitung Karl Barths, der erste
Theologe, der die haupt-theologische Prämisse der Resistenz
zum Nationalsozialismus vorlegte,[105]
versammelten sich verschiedene Theologen aus vielfältigen
theologischen Tendenzen von denen Dietrich Bonhöffer hervorgeht. Er war der
politisch-intellektuelle Beauftragte der Bewegung.
Er verteidigte die Säkularisation des
Christentums, und erkannte den Nazismus als eine neue
Religion, die in der Vergötterung des Führers und des
Rassebegriffes begründet war. Laut Bonhöffer,
wurden die Grenzen zwischen beide Ordnungen, in dem Masse von
der, weltlichen Macht vergewaltigten, dass die Christen, nicht
nur sich widersetzen sollten, sondern auch unbedingt, eine
radikale Interferenz in der gegenwärtigen Geschichte
unternehmen müssten.
In Brasilien, wurden die Deutsche
Christen" sowie die Glieder der Bekennenden Kirche tatkräftige
Teilnehmer der politischen und kulturellen Ereignisse, aber,
während der "Deutschen Christen" einen wesentlichen Einfluss
auf die Gläubigen ausübte, wurden die Mitglieder der
Bekennenden Kirche Mitglieder rasch unterdrückt, sei es von
den offiziellen Massnahmen des Klerus, sei es von ihrer
täglichen Tätigkeit. Viele von denen wurden wieder nach
Deutschland geschickt, andere hatten die Geldmittel ihrer
Pfarre in der Synode untergebracht, und andere mussten ihre
offiziellen Verpflichtungen verlassen (DREHER, 1984, S. 149
usw.)
Anlässlich solchen Benehmens ist es
interessant, ein Geschehen dieser Epoche zu erwähnen.
Ein Deutschbrasilianischer Pfarrer
fragte Karl Barth brieflich, über die Nichtbezüglichkeit des
Glaubens zum Volkstum in der brasilianischen Evangelischen
Kirche.
Barth antwortete:
(...) Sie können und sollen sich über
das irdische Grunddatum Ihres Gemeindelebens: dass ihre Leute
Deutsche sind und dass der berechtige Wunsch besteht, dass
ihnen ihr Deutschtum erhalten bleibt - sie können und sollen
sich darüber keinen Augenblick hinwegsetzen. Aber es müsse der
Versuchung widerstanden werden, das irdische Datum mit
himmlischem Datum zu verwechseln oder es ihm als Faktor von
gleicher Würde zu koordinieren. Dann wären bei den zwei
Göttern der Deutsche Christen (...) Der Deutsche könne dem
Pfarrer zwar seine Hoffnungen und Nöte vortragen als der unversöhnte, blinde, sündige Mensch,
der er nun einmal ist. und doch aufgenommen mit seiner ganzen
Existenz in der Kirche des Herrn- (...) die wirkliche
Durchdringung des Primates des Wortes Gottes ist
selbstverständlich Sache dieses Wortes selber und ganz allein,
und darum dürften Sie sich in der ganzen Sache keine Skrupel
machen, sondern wenn Sie im Glauben und im Gehorsam stehen,
mag jenes Unheil je und dann geschehen - wie doch in unserem
Tun auch in dem besten Leben je und dann grösstes Unheil
geschieht - und es wird ihnen und ihrer Gemeinde endlich und
zuletzt doch alles zum Hell ausschlagen. Und also ... hinein
denn ihre nun einmal nötige Deutschtums- Arbeit. pecca. pecca
fortiter! [106]
Gegen diese Behauptungen, widersetzten
sich scharf die Glieder auf der Synodalversammlung des Jahres
1934, denn laut den Pfarrern, Volkstum sei nach Gottes
Ordnung, und zwar als Ordnung der Welt. Blut und Rasse,
Volkstum und Volk, Geschichte und Staat seien von Gott
gegebene und gewollte Ordnungen (PRIEN, 1989, S. 416).
Nach der Meinung solcher Pastoren, Barth
und seinen Nachfolger könnte die Konsolidierung des
Anschlusses der Synoden an die Mutterkirche schädigen, ein
Ziel seit langem vom Klerus geplant. Ausserdem, die "rote
Gefahr" und das Risiko der Vermischung, wie ich schon
behauptet habe, wurden Feinde, die neuen Nachfolger gewinnen
könnten, wenn die doktrinären Misshelligkeiten verbreitet
würden. Oder noch schlimmer, die Politisierung der Kirche
könnte, wie es schon in Deutschland geschah, die Einheit der
deutschen Evangelischen Kirche in Brasilien bedrohen.
Diese waren die Gründe dafür, die
Pfarrer der Bekennende Kirche von den Synoden zu entfernen,
wenn sie nicht gezwungen würden ihre Rückkehr nach Deutschland
zu legitimieren.
Ab dieser Konjunktur, wurden die politischen, Auseinandersetzungen
im Rahmen des Machtstreites von Gliedern einer
ideologisch-homogene Gruppe geschaffen, was aber nicht eine
Verminderung der Streite hervorrief, sondern vielfältige und
noch radikalere Misshelligkeiten.
Das ist, ganz generell gesehen, die
Beschaffenheit in der die nationalsozialistische Utopie in
Brasilien die von den Protestanten angenommen wurde.
Angesichts dieses Phänomens, müssen wir
uns fragen, welche waren die fortlaufend und tiefsten
Beziehungen, die es ermöglichten, dass die bis dahin scheinbar
unpolitisch Evangelischen sich plötzlich, zu ihrer alten
Heimat wiederanknüpften? Welche Bearbeitungen uns eine
unentwirrbare Verbindung zwischen den Evangelischen und den
Pangermanisten und Nationalsozialisten einflüstert? In anderen
Worten, gab es wirklich eine Art von Symbiose zwischen
Religion und Politik? Solche enge Verbindung ist nicht von
einer Historiographie aus verständlich, die sich nur durch die
beabsichtigte Ausübung der Männer in der Gesellschaft
organisieren lässt, oder durch die Untersuchung der Praxis der
sich kristallisierenden Institutionen. Die Behandlung dieser
Frage soll untersucht werden, bei der Überlegung über Begriffe
und Vorstellungen, welche in religiöser Welt (bewusst und
unbewusst) gebildet wurden, besonders aus der pietistischen
Tradition, wie es in Brasilien erlebt wurde. Ich spreche hier
von Volksgemeinschaft, Volkskirche, Luthertum und völkische
Identität, Patriotismus und Minderheits-Bewusstsein, sowie die
weltliche Mystik, die die Nation sakralisiert, Formulierungen
derer die seit des 18. Jahrhunderts deutsche religiöse
Weltanschauung imprägnierte, und die im Süden Brasiliens als
eine "Erweckung” zu der Vergangenheit erschienen, gleichzeitig
sakramentlich und säkular. Als ob dieselben aus dem Romantiker
zur Zeit der napoleonischen Herrschaft, Befreiungsträume die
nationalistische Utopie solcher Immigranten bewässern würde,
die Hypothese einer apokalyptischen Jetztzeit, die sie von
ihrer Geschichte ablösen würde, schien in der Hitlers Figur,
und in der "Deutschen Christen" Bewegung zu verkünden.
Aber bevor man die von den Pietisten bearbeitete kulturelle Welt analysiert, ist es nötig, dass die institutionelle Bahn der deutsch-brasilianischen Evangelischen Kirche imÜberblick behandelt wird.
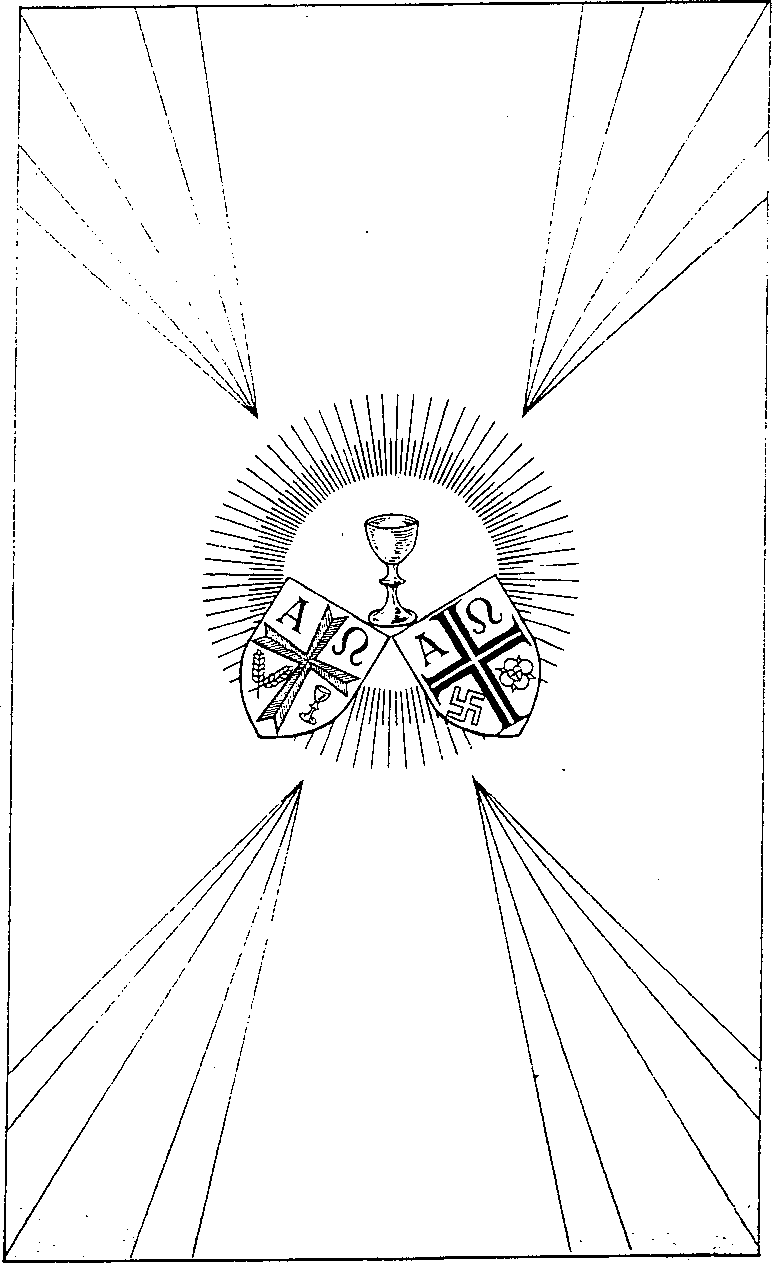
|
Das Sinnbild der Evangelischen Lutherischen Kirche in Brasilien |
Die Evangelische
Kirche deutscher Herkunft in Brasilien
In seiner Eröffnungspredigt der
Synodalversammlung des Jahres 1900 in Porto Alegre, hatte Pfarrer Schlegtendal
gesagt, er wäre stolz, weil das deutsche Volk in Brasilien, in
deutscher Sitte und deutscher Art, rein und stark sich
erhalten hätte, was, seines Erachtens, ein Hinweis des
deutschen Charakters wäre. Und er erklärte noch, sicher dass
seine Zuhörer sich belohnt fühlen würden, dass von nun an, die
Deutsche Evangelische Kirche besorgt sein würden, mit der
Aufgabe es zu erziehen, zu koordinieren und durchzuführen,
damit sie ein Vorbild des Deutschtums in Brasilien sein
könnte.
Und tatsächlich, selbst wenn das Wort
Deutschtum nicht notwendigerweise dieselbe Bedeutung für den
Immigranten (besonders diejenigen, die seit lange in Brasilien
waren) und für den Pfarrer hatte, die Möglichkeit um
finanzielle Hilfe und geistliche Fürsorge zu bekommen,
entsprach der Erwartung der Gläubigen, die sich in dem
Beispiel der katholischen Kirche orientierte. Über diesen
Bedarf, zitieren wir, beispielsweise, die Aussage eines
Kolonisten, der sich seines Grolls gegen die Indifferenz
seiner Kirche dem Einwanderer gegenüber erinnert:
Man spricht immer viel von Vaterland und
der Mutterkirche. Ich werde aber nie vergessen, wie wir vor
unserem Auszuge aus der Heimat zum letzten Male in der Kirche
waren, und was uns dort gesagt ist. Leute, wurde uns von dem
Pastor gesagt, ihr geht hinaus in die Unbekannte Fremde unter
ein Volk fremder Sprache und anderen Glaubens. Niemand wird
sich um euch kümmern, niemand nach euch fragen, Ihr werdet
euch selbst überlassen sein, keine Glocke wird euch in die
Kirche einladen, kein Pastor euch das Evangelium predigen und
die Sakramente spenden. Ihr aber haltet fest an eurem Glauben!
- ja, das hat man wahr gemacht. Niemand hat sich um uns
gekümmert, niemand nach uns gefragt, wo doch die Kirche schon
mehr als 40 Jahre besteht. Was soll nur daraus werden, worauf
sollen wir uns noch verlassen? (apud
PRIEN. 1989. S. 91)
Diese beiden Stellungen, von Schlegtendal und dem Kolonisten,
symbolisieren in einem gewissen Masse, die politische und
kulturelle Geschichte der Evangelischen Kirche deutscher
Herkunft in Brasilien. Einerseits, die Erhaltung des
evangelischen Glaubens, trotz der einfachen Bedingungen, wie
die Abwesenheit der Pfarrerschaft, die Anwesenheit einer
offiziellen Religion und die Mangel an Mittel für den Bau der
Tempel. Andererseits, der nationalistische Protestantismus,
welcher genauso wie der Alldeutscher Verband die religiöse
Treue der Gläubigen als ein Kompromiss mit den Interessen der
deutschen Nation verstand. "Luthertum ist Deutschtum" -
behauptete man zu dieser Zeit.
Ich will es nicht unterschrieben haben,
die Thesen behaupten, dass alle Bestrebungen der Deutschen
Evangelischen Kirche in Brasilien wurden einer
imperialistischen Taktik untergeworfen. Ich will auch nicht
behaupten, andererseits, dass die protestantische Religiosität
sich auf ganz verschiedener Weise entwickelt hätte, wenn die
Mutterkirche keine Interferenz in den brasilianischen
Gemeinden ausgeübt hätte.
Nach meiner Meinung orientieren sich alle ekklesiastischen Institutionen,
unabhängig von ihren eventuellen Amalgamierungen mit den
säkularen Mächten, immer von einem geistlichen Prinzip aus. In
diesem Sinne, wurde die Verbreitung des evangelischen Glaubens
zum Imperativ, eine Aufgabe, die als eine apostolische Mission
angesehen wurde, womit man sogar vermeintliche Wünsche der
Erhaltung der kulturellen Identität ihrer Gesprächspartner
benutzen dürfte. [107]
Als Schlegtendal
oder selbst Rotermund die Endogamie vorschlugen, wurden sie
selbstverständlich von Volkstumsideologie, imprägniert, aber
unter gemischte Ehe verstand man auch die Vermischung mit den
Katholiken, eine hegemonische Religion, welche die
Konsolidierung des evangelischen Glaubens in Brasilien
bedrohen könnte.
Ausserdem die Entstehung verschiedener
Sekten, wie die der Mormonen und Adventisten, die in Brasilien
sich am Anfang des 20. Jahrhunderts niederliessen,
repräsentierten ein ständiges Risiko für den Protestantismus,
so in Europa wie in Amerika.
Was wirklich am Anfang passierte, war
eine Gleichzeitigkeit zwischen Sprache und Interessen der
Gläubigen und der institutionellen Führung der Kirche; wenn
einerseits, die nationalistischen Pastoren die Unabhängigkeit
der brasilianischen Gemeinden bedrohten, andererseits, muss
man berücksichtigen dass die Anwesenheit einer formellen
Pfarrerschaft, nach der Meinung vieler Einwanderer, viele
Vorteile ermöglichten, wie die Verteidigung des Luthertum, als
eine formelle Religion und die Repräsentation der
Evangelischen in Hinsicht auf die katholischen und säkularen
Institutionen. Ausserdem, die verschiedenen Vereine von der
Kirche direkt oder indirekt gegründet, trug dazu bei, die
politische und ökonomische Organisierung der Einwanderer zu
fördern, wie man die sogenannte Rotermunds Ära schon erwähnte,
eine Periode, die sich mit der Andeutung eines korporativen
Projekts unter den Deutschbrasilianern charakterisierte.
Ich habe mit diesem Gedankengang vor, zu
behaupten, dass es immer eine Art stillschweigender
Übereinstimmung zwischen den, Gläubigen und der Pfarrerschaft
gab, was einen gewissen Einfluss der Deutschen Kirche
begünstigte. Wenn die Konsolidierung solcher Kontakte nicht
früher geschaffen wurde, muss man sich erinnern, dass während
des Kaiserreiches, Brasilien offiziell katholisch war, und die
Empfehlung gegen jede Art von doktrinären Interferenzen, zum
Teil, in Rücksicht genommen wurden. Aber trotz dieser
Hindernisse, war die Abwesenheit einer formellen Pfarrerschaft
damals weder absolut noch standhaft, und hing von jedem Gebiet
ab. In der von der kaiserlichen Regierung gegründeten
Siedlungen, wurden Spenden zugewiesen um Pastoren zu
verpflichten; eine ähnliche Anregung geschah in den privaten
Kolonien, wo die aufgebauten Tempel auch als Grundschule
dienten. Gebe man noch dazu, die selbständigen Anregungen der
Immigranten, welche mit ihren eigenen Mitteln ihre Pfarre und
Pastoren erhielten.
Aber nur um die Jahrhundertwende, kann
man es beobachten, eine ausdrucksvolle Zahl von Pastoren aus
Deutschland kam; und von nun an, darf man über einen
bedeutenden Einfluss des Alldeutscher Verbandes und des
nationalistischen Protestantismus reden.
Die Erhaltung des evangelischen Glaubens
in dem 19. Jahrhundert kann auch aus anderer Sicht gesehen
werden: es ist nämlich so dass die evangelische Kultur sich
nicht so intensiv auf eine formelle Autorität, wie die in der
katholischen Kirche, beschränkt. Es gab in Mittel-Europa,
England, U.S.A und Canada
viele populäre religiöse
Bewegungen, die unabhängig von einer Institution und formeller
Leitung entstanden waren; Mennoniten, Anabaptisten, Waldenser,
Herrenhüter, unter anderen, sind Beispiel für solche
Mentalität. Jede solche religiöse Bewegung widersetzt sich
gegen die romanische Kirche selbst bevor der Reformation, und
viele, von denen widersetzten sich sogar der Luther und Calvin
Nachfolgern, weil sie einen "neuen Konstantinismus"
bei der Institutionalisierung der Reformation predigten. Es
ist zu vermuten, dass diese Erfahrungen und Anwendungen die
Immigranten in ihrem Alltag beeinflussten; in diesem Sinn, ist
die sogenannte Missachtung der Pastoren, wie Rottermund und Borchard beobachteten,
nicht ein Anzeichen des Unglaubens, sondern doch die
Unwichtigkeit, welche die Gläubigen den Priestern verliehen.
In Folge dieses Prozesses ist eine
andere Herausforderung zu beachten, welche die Mutterkirche
bei der Abordnung akademischer Pastoren nach Brasilien, im
Augen sehen musste; es bestand aus der Homogenisierung ihrer
Lehre. Die verschiedenen Herkunftsgebiete der Einwanderer und
auch der ersten Pastoren sind auch die Gründe für den
doktrinären Pluralismus, der in Süd-Brasilien zu beobachten
ist, welche ihre Sitten und religiösen Äusserungen,
beeinflusste.
Auch durch die Biographie der ersten
Pastoren und Missionare, die nach Brasilien ausgesandt wurden,
kann man diese Lage erweisen: einige derer kamen aus der
reformierten Kirche - die vom Calvinismus beeinflusst wurde.
Andere waren Missionare aus der Basler-Mission, pietistischer
Prägung; noch anderen, aus der ursprünglichen lutherischen
Tradition, die seit des 19. Jahrhunderts zwischen Philo-
Pietisten, Orthodoxen und Liberalen geteilt wurden; es gab
auch verschiedene politische Tendenzen, wie die Liberalen,
Nationalisten und Sozial-Demokraten, sowie theologische
Divergenzen. Es ist noch hervorzuheben, diejenigen, die aus
den USA kamen, welche stark von dem Fundamentalismus
beeinflusst wurden. Und die nicht minder wichtig waren, die
aus den Erweckungs- und Heiligungsbewegungen entsandte
Missionare und Prediger, die spontan und auf, selbständige Weise nach
Brasilien kamen, als ob ein göttlicher Befehl zu beachten
wäre.[108]
Diese vielfältige kulturelle und
doktrinäre Erbschaft nennen die Kirchenhistoriker
"Konfessionellen Indepentismus",
ein Begriff, den man akzeptieren kann, wenn er nicht zu dem
brasilianischen Vorbild eingeschränkt wird, denn, auch in
Europa, charakterisierten sich viele Gemeinden durch ihre
Unabhängigkeit des Klerus.
In diesem Sinn, die Bestrebung der
zentralisierenden Politik der Mutterkirche gegenüber den
unabhängigen Gemeinden, sowie ihre Homogenisationslehre,
wurde nicht ohne starken Widerstand geschaffen, und würde auch
nicht guten vollständigen Erfolg sogar in den heutigen Tagen
haben. (DREHER, 1984)
Die Spannung und der Pluralismus
zwischen den alten Gemeinden und den akademischen Pastoren
waren immer in der Tagesordnung. In seinen Memoiren, erzählt
Pfarrer Hasenack, zum Beispiel,
dass die Aussendung eines Pfarrers in die Wolgadeutschen -
Kolonien in Paraná, am Anfang abgelehnt wurde, denn, nach
Meinung der Einwanderer, wurde der Pfarrer als ein
inoffizieller Überwachungsbeamter der Regierung angesehen.
(FUGMANN & BREPOHL, 1927). Die Pommern, ihrerseits, waren
nur an den häuslichen Gottesdienst gewöhnt, der aus einer Familien- Versammlung bestand, und
deren biblische Auslegung, nach freier Ansicht der Teilnehmer
geschaffen wurde (PRIEN, 1989). Nicht selten, gab es auch eine
nominelle Religiosität, die sich in den sonntäglichen
Gottesdienst besuchen, Taufen und Hochzeiten einschränkte.
Aber dank der Verbindung zu der
Mutterkirche und der daraus folgenden Zunahme der finanziellen
Hilfe, sowie die Zahl der Pfarrerschaften, fingen die Pfarrer
allmählich an Einfluss zu erheben, um die Synoden zu
organisieren, deren Leitung sich immer mehr der ekklesiastischen Politik in Berlin
unterordnete.
Allerdings, während des Oberkirchenrates
von akademischen Theologen und Pastoren koordiniert wurde,
orientierte sich die Basis der Pfarrerschaften Missionare nach
der Prämisse ihrer para- ekklesiastischen
Vereine, welche sie unterstützten. Ihre Praxis wurde auch von
den alltäglichen Erlebnissen und Erfahrungen orientiert, durch
die Kontakte mit ihrer Pfarrkinder. Diese Pfarrer waren
verantwortlich für geistliche Fürsorge und Beratung, während
die Obrigkeiten der Synoden die Rolle der
Verwaltungs-Bürokratie spielten, und trotz ihrer theoretischen
Ausbildung, hatten sie selten Beziehungen mit den Gläubigen.
Wir haben nicht genügend Unterlagen, die uns
erlaubten würden, diese Dissonanz zwischen die Leitung der
Kirche und die Pfarrgemeinden genau einzuschätzen. Aber es
gibt viele Beispiele dafür, die uns zu mindestens über eine
gewisse Spannung erlaubte Auslegungen zu machen. Nach der
Meinung der ersten Missionare der Gnadeauer
Mission, zum Beispiel, wurde ihre Tätigkeit als ein Drohung in
Hinsicht der Kircheneinheit gesehen, denn ihre Lehre wurde als
nicht kohärent mit dem Augsburger-Bekenntnis berücksichtigt.[109]
Die Marburger Mission, ihretwegen, wurde
aus denselben Gründen kritisiert, und noch bei der Gründung
einer weiblichen religiösen Ordnung, das Mutterhaus Bethania, welches Gemeindeschwestern
ausbildete. Weil es das Zölibat empfahl, wurde es als
Gegensatz zu den Artikel 23 der Augsburger-Bekenntnis
beurteilt.
Immerhin, wurde die Gnadeauer Mission von den Synoden
geduldet, und behandelte ihre Nachfolger als Mitglieder.
Die Marburger Mission welche aus der
lutherischen Kirche in 1932 entstand, hat in Brasilien die
Denomination "Igreja de Cristianismo Decidido"
(Kirche für Entschiedenes Christentum) gegründet.
Selbst Rottermund
äussert seinen Widerwillen gegen die Pietisten, die er als
Fanatiker beurteilte, und er fürchtete, dass ein neuer
Mucker-Prozess erscheinen würde. Die Ähnlichkeit zwischen
Pietisten und den "Muckern", nach Rotermunds Meinung, bestand
aus ihrem Glauben und Emphase an den Chiliasmus und der
Christus- Wiederkunft, was gegen die lutherische Lehre gesehen
wurde.
Seitens der Missionare erkannten sie
nicht die akademischen Pastoren als Autorität um ihre
Beschäftigung zu orientieren, denn ihre Ideen wirkten keine
Resonanz bei den Gläubigen aus. Sie waren die echten Vertreter
der Volkskirche, um einen ursprünglichen Begriff des Pietismus
zu gebrauchen.
Diese Spannungen, laut der erforschten
Quelle, hatten die Einheit der Synoden mindestens bis zu den
30. Jahrzehnte nicht bedroht. Bis zu dieser Zeit, wurden die
pietistischen Missionare von der Kuppel geduldet, und in
einigen Fällen, zu höheren Aufgaben eingeladen, denn sie übten
einen wichtigen Einfluss bei den Gläubigen aus; sie wurden
weitgehend verantwortlich für die Formulierung einer gewissen
religiösen Kultur, deren Besonderheiten zur Erhaltung ihrer
Traditionen und Sitte beitrug, sowie eine gewisse Vorstellung
ihrer Geschichte.
Um die historische Bahn der von der
pietistischen Kultur geprägten Gemeinschaft in Brasilien zu
verstehen, verzichten wir auf eine Methodologie die,
zahlreiche Autoren und Schriften erforscht würden, mit dem
Ziel die Gesamtheit ihrer Äusserungen zu analysieren.
Stattdessen, ziehen wir es vor, eine sich erschöpfende Analyse
über einen einzigen Verfasser, wegen seiner sozialen
Erfahrungen als Schriftsteller und Pfarrer.
Friedrich Wilhelm Brepohl,
von dem 151 Veröffentlichungen erschienen, wie Bücher,
Flugblätter, Broschüren, Zeitungsartikel, usw.,[110]
war einen Evangelischer Pastor, der in Lapa
und Ponta Grossa sein Amt ausübte; er wurde auch Beirat des
deutschen Konsulats in Paraná und übte starken Einfluss in die
deutschen Vereine aus. Er spielte weder eine führende Rolle in
den Synoden noch in dem theologischen Raum. Wir können nicht
behaupten, dass er unter allen Pfarrern sich am stärksten der
pietistischen Lehre verpflichtete, wenn er auch in dieser
Tendenz ausgebildet wurde; und sein Kompromiss mit dem
Deutschtum und dem Nazismus wirkte nicht ein wirkungsvolles
politisches Verfahren in Hinsicht der deutschbrasilianischen
Gemeinschaft. Allerdings, offenbaren seine Diskurse und seine
Praxis ein Vorbild, dass exemplarisch in verschiedener
Hinsicht zu dieser Dissertation berücksichtigt werden kann.
Schliesslich, wurden viele Pastoren Pietisten, jeder so
radikal, dass sie sich nicht für die säkulare Geschehen
interessierten, sei es in Brasilien oder in Deutschland; viele
Pastoren und Laien, die sich mit dem Deutschtum
identifizierten, und in dessen Namen, hofften sie dass sie
eine starke Verbindung mit der deutschen Heimat erreichen
würden, die ihnen erlaubten, mit der Hypothese des
Separatismus zu rechnen; nicht weniger, sich vom Nazismus
verführen lassen, mit dem Verständnis solche Lehre sei eine
natürliche Entfaltung des Deutschtums, oder im Gegenteil, die
Verkörperung dieser Lehre als eine Neuheit revolutionären
Charakters, die ihnen eine entscheidende Macht verleihen
könnte. Aber es ist nicht einfach. Jemanden zu finden, der
gleichzeitig Pietist, Pangermanist, Nationalsozialist,
Schriftsteller, Pastor und Journalist wurde, und der sich hin
und wieder als Zuschauer des politischen Geschehens, hin und
wieder als Sympathisant der Bewegung, hin und wieder als
echter Militant der Partei benahm. Und dazu am Ende des
Prozesses, im Gegenteil zu der Mehrheit der Pastoren, welche
die deutsche Staatsangehörigkeit besassen, die nach
Deutschland zurückgefahren sind, als die Verfolgung von Seiten
der brasilianischen Polizei gegen die Nazis begann, wurde Brepohl in Porto Alegre, verhaftet, Episoden seiner Geschichte, die er
selbst registrierte.
Trotz der Parteilichkeit seiner
Zeugnisse, bietet er uns Indizien einer Erfahrung an. die uns
die nazistische Bewegung in Brasilien auf anderen Weg
nahekommen lässt, das heisst, nicht durch öffentliche
Demonstrationen oder Devise, aber von der politischen
Mentalität die von dem Nazismus bekehrten Individuen, ihre
objektiven Gründe, aber auch ihre subjektiven Absichten,
hatten.
Der Brepohls
Auswahl verdanken wir nicht nur das Vorhandensein vieler
Quellen über seinem Leben und seinen Schriften; was
interessant wird ist ihn in seiner konkreten Erfahrung
kennenzulernen, in der Tat, dass er sich nähren liess von
einem Wissen, dass nicht nur zu einer einzigen Schicht
gehörte: sein Pietismus entstand aus einer echten populäre
religiösen Kultur, welche unter den niedrigen Schichten
Deutschlands gepflegt wurde, - "Die Bibel ist die Aufklärung
der armen Leute" - äusserte sich einmal ein Pietist des 19.
Jahrhunderts. Andererseits, war der gelehrte Gedanke säkularen
Charakters nicht ihm unbekannt, denn er studierte, zum
Beispiel, Literatur und Geschichte autodidaktisch, und die
Philosophie, hat er sicher bei seinen theologischen Studien
gelernt. Was sich um Politik handelte, scheinen die
Erfindungen in der Massenkultur orientiert worden sein, sowie
sie sich in der Weimarer Republik äusserte: Der Hass gegen die
Parteien, der Anti-Semitismus, einen besessenen Nationalismus,
und einer äusserlichen Reaktion gegen alles was als Synonym
der Modernität berücksichtigt werden könnte. Mit diesen
politischen Instrumenten, verteidigte Brepohl
Ideen die seinem utopischen Streben zur sozialen Erneuerung
widerspiegelten.
Diese Überlegungen führen uns zu Carlo Ginzburg. Dieser schlägt nach Bakthin
vor, das Leben und die Werke eines einzelnen Individuums als
empirischer Ausgangspunkt zu wählen, um die vielfältigen und
wechselseitigen Einflüsse zwischen der Kultur der beherrschten
Klassen und der herrschenden Klasse zu untersuchen, wobei er
die These von einem Kreislauf verteidigt, in Hinsicht der
Annahme auf eine unverrückbare Hegemonie der Herrschenden über
die Beherrschten, hinweist (1987, S. 11-34).
Ginzburg erklärt die Vorteile einer Einzelstudie in
Vergleich zu einem strukturellen Ansatz:
An diesem Punkt eröffnen sich nun zwei
Möglichkeiten: entweder man opfert die Erkenntnis des
individuellen Elementes zugunsten der (mehr oder weniger
streng mathematisch formulierbaren Verallgemeinerung, oder man
versucht - sich langsam vortastend - ein anderes Paradigma zu
erarbeiten, das sich auf die wissenschaftliche Erkenntnis des
Individuellen stützt (wobei es sich um eine
Wissenschaftlichkeit handelt, die völlig neu zu definieren
wäre). ... (GINZBURG. 1988. S. 100)
Nach seiner Ansicht, ist das von ihm
vorausgesetzte Indizienparadigma hilfreich, um aus dem Dilemma
von Rationalismus und Irrationalismus herauszukommen.
Ausserdem erlaubt uns diese Methode, die
Beziehungen zwischen der Privat Sphäre und der Machtausübung,
mit allen dazu gehörenden Elementen zu erklären; die
Leidenschaften, die persönlichen Gefühle, die
Glaubensrichtungen, die Werte, die täglichen Zwänge. (GINZBURG, 1989, S. 143-206).
Ausserdem ist es nach einem weiteren
Vertreter dieses historiographischen Ansatzes, Hans Medick, notwendig, und das Modell Ginzburgs ein gutes Beispiel dafür, nicht nur die
Unterschiede zwischen verschiedene Kulturen, sondern auch
jene, die zwischen
Mitglieder einer einzelnen Gemeinschaft bestehen,
zu erkennen. Diese Unterschiede können zu einem
Abhängigkeitsverhältnis führen, zu Widerstand, Resistenz oder
Kooperation, welche nur durch die Aktion konkreter Individuen
verständlich werden, die aktiv in dem Prozess des Kampfes um
Bedeutungen, eingreifen (Medick,
1984, S. 295-319).
Wenn man auf dieser Weise den Lebenslauf
von Brepohl nachzeichnet,
bedeutet, dass wir uns einen Gedanken- und Gefühls- Richtungen
nähern, die dazu dienten, die Spannungen entgegenzutreten,
denen die Deutschbrasilianer während der ersten Jahrzehnte
dieses Jahrhunderts in Brasilien ausgesetzt waren.
Aber dies bedeutet auch, und dies nicht an zweiter Stelle, die vielfältigen Verbindungen, die das Individuum an seine Gesellschaft bindet, zu der er selbst auf individuelle Art beiträgt, zu verstehen, deren genaue Reproduzierbarkeit, in grossen Massstab, unmöglich ist.
Friedrich
Wilhelm Brepohl
Über Luther sagte ihm ein Freund. dass
er der Befreier der Christenheit sei. "Ja", antwortete er,
"ich bin es und ich war es. Aber wie ein blindes Pferd, das
nicht weiss wohin sein Herr es führt.
Friedrich Wilhelm Brepohl
wurde am 3. April 1878 in Katernberg (Essen), als Sohn eines
Bergarbeiters Namens Ludwig und von Louise, geb. Blum,
geboren. In seiner Biographie heisst es, dass er ausser
Pastor, Buchhändler, Verleger, Redakteur, auch ein Forscher
der deutschen Auswanderung in verschiedene Regionen war, sowie
auch Forscher der Kultur und Völkerkünde der Zigeuner. Zu
diesen Aktivitäten zählt noch eine Stellung als Beirat am
deutschen Konsulat in Paraná, wohin er 1925 auswanderte.
Seine Ausbildung ist die eines
Theologen, aber viel Zeit widmete er auch Studien anderer
Gebiete, wie der Kultur von ethnischen und religiösen
Minderheiten, der Geschichte des deutschen Volkes, dem
landwirtschaftlichen Genossenschaftswesen, der sozialen
Sicherheit und der deutschen Literatur. Er schrieb auch einige
Gedichte, die er als Überschrift für seine Schriften und
Predigten benutzte.
Brasilien war nicht das erste
ausländische Land in dem er gelebt hat. Noch sehr jung, mit 20
Jahren, ging er aus Deutschland fort um
sich im theologischen Seminar in Florenz in Italien ausbilden zu lassen, wobei
er die finanzielle Unterstützung eines entfernten Verwandten
seiner Mutter hatte, die von französischen Hugenotten
abstammte - einer Familie, die von pietistischen Erfahrungen
stark gekennzeichnet war. Bald nachdem er den Kursus
abgeschlossen hatte, liess er sich in Locarno in der Schweiz
nieder, wo er seine Laufbahn als Pastor und Prediger begann.
Dort lernte er auch seine zukünftige Ehefrau kennen, Julia Hoffmann, mit der er später fünf Kinder hatte.
Im Jahre 1903 heiratet er und drei Jahre
später geht er als Prediger nach Serbien; von dort geht er
nach Ungarn, wo er ausser Pastor auch seine Tätigkeiten als
Redakteur und Schriftsteller beginnt, fest verbunden mit para-ekklesiastischen Organisationen, die
die Verbreitung der evangelischen Lehre unter dem einfachen
Volk zum Ziel hatten.
Im Jahre 1912 geht er zurück nach
Deutschland, wo er zuerst in Wiesbaden, einer Stadt nahe bei
Frankfurt, wohnt. Dort widmet er sich etlichen Aufgaben, die
ihm möglicherweise wegen seiner Erfahrungen mit Missionen
erteilt wurden, die den Deutschen im Ausland helfen sollten;
er wird als Koordinator der Arbeitskommission für die
Darstellung des Deutschtums und der deutschen Kultur im
Ausland ernannt, er gründet die "Vereinigung zur Verbreitung
guter Deutscher Literatur" - VDL, er wird Direktor der Mission
zur Evangelisation der Kriegsgefangenen von Deutschland und
Österreich und Vertreter des Roten Kreuzes, um Mittel zur
Anschaffung von Bücher für diese selbe Gruppe zu bekommen.
Seine Erfahrung und sein Einsatz während
des ersten Weltkrieges gewährten ihm die Ausübung einer
hervorgehobeneren Funktion als der vorherigen, als Koordinator
der Propaganda- Abteilung der preussischen
Forschungsgesellschaft für die Landwirtschaft; so wird er 1917
nach Zossen, einem Vorort von Berlin, versetzt, wo er neben
dieser weltlichen Tätigkeit auch die Aufgabe als Koordinator
der geistlichen Fürsorge für Flüchtlinge aus den
Nachbarländern hat, und ausserdem ist er auch hier noch
Koordinator der VDL.
Im Jahre 1925 wird er von der
Missionsabteilung für das Ausland der deutschen evangelischen
Kirche nach Lateinamerika entsandt. Er beginnt seine
Tätigkeiten in Lapa und zwei
Jahre später geht er nach Ponta Grossa, wo er sieben kleine
Kongregationen in der Umgebung versorgt und die in ihrer
grossen Mehrheit von deutschen Immigranten aus dem Osten
aufgesucht werden. Er kam als Koordinator der Volksmission,
einer para-ekklesiastischen
Organisation, die sich nicht nur um das seelische Wohlbefinden
der Gläubigen kümmerte, sondern auch um ihre materiellen
Belangnisse. Durch diese Organisation, gründete er in Paraná
zwei Informationseinrichtungen für die sozialen Rechte der
eingewanderten Arbeiter: die Sozialhilfe für arme Immigranten
und die zentrale Genossenschaft der Landarbeiter in deutscher
Sprache. Er unterstützt ausserdem die Einrichtung der
Marburger Mission in Paraná, die ihren Gläubigen eine
ärztliche und soziale Hilfe bietet.
Neben diesen Aufgaben führt Brepohl seine Arbeit als Redakteur und
Verleger der VDL fort, was ihm ermöglicht die meisten seiner
Schriften als Broschüren herauszugeben, sowie auch die
Schaffung einer Lokalzeitung in Ponta Grossa. Er publiziert
auch etliche Artikel in religiösen und in weltlichen Zeitungen
wie zum Beispiel die "Deutsche Zeitung", "Kalender für die
Deutschen in Brasilien" und "Volk und Heimat".
Im Jahre 1933 geht er zurück nach
Deutschland, um sich mit der neuen politischen Lage zu
familiarisieren und auch um Mittel für die
deutschbrasilianischen Genossenschaften und für die VDL zu
beschaffen und auch um sich über die neuen sozialen und
politischen Rechte der Deutschen, die im Ausland leben, zu
unterrichten; als er dann zurück in Brasilien ist, tritt er in
verschiedene Vereine zur Verteidigung des Deutschtums ein.
Seitdem organisiert er am laufenden Band Debatten über das
Deutschtum, die Kirche und das, neue Deutschland, bis er mit
dreien seiner Kinder gefangen genommen wird. Am Kriegsende
entfernt er sich von den meisten seiner beruflichen
Tätigkeiten sowie auch von der Führung der durch ihn
gegründeten Vereinigungen, indem er sich ausschliesslich der
Ausbreitung seiner Memoiren und der Lektüre und Organisation
eines Archivs über die deutsche Auswanderung nach Brasilien
widmet, die er nicht vollendet, da er 1952 in Ponta Grossa
stirbt.
Brepohls berufliche und ekklesiastische
Karriere, gekennzeichnet durch eine eifrige geographische und
soziale Mobilität, beeinflusst natürlich sein persönliches
Leben; zu gleicher Zeit können seine Entscheidungen und sein
Verhalten als ein Reflex seiner eigenen Erfahrungen verstanden
werden.
Seit seiner frühesten Kindheit musste Brepohl vielen und bestimmt
unerwünschten Änderungen gegenübertreten, sowie auch
Widrigkeiten die mit seiner sozialen Lage verknüpft waren.
Sein Vater wurde Witwer als er gerade drei Tage alt war, aber
er heiratete noch drei Mal und wurde Vater von sieben Kindern
- zu viele, als dass er sie alle unterhalten konnte, zumal er
ein Arbeiter war, der vielen politischen Problemen
entgegentreten musste, da er in Verbindung zu
sozialdemokratischen Bewegungen stand. Die finanziellen
Schwierigkeiten der Familie wurden nicht nur die politische
Stellung seines Vaters Ludwig verschlimmert, sondern auch
dadurch, dass er trank, was Brepohl
emotionell und physisch von seinem Vater entfernte. Laut
seiner Memoiren,
Als ich meinen Vater zum ersten Mal sah,
war er schwer betrunken im Hause meiner Grosseltern. Er wurde
als verlorener Sohn angesehen. Wenn ich von ihm hörte, wurde
er nur als Betrunkener oder Sozial-Demokrat (...) erwähnt. Andererseits
erzählte man mir,
dass meine Mutter, die ich nie kennenlernte, eine fromme Frau
war. die ihn aus Liebe heiratete und sicher war, dass ihre
Liebe ihn ändern würde.[111]
Aus diesen Gründen wurde Wilhelm von
seinen Grosseltern väterlicherseits grossgezogen. Sie waren
ein Ehepaar mit strenger Tradition und strengen
Erziehungsmethoden, was in ihm zweispaltige Gefühle
hervorrief; sein Grossvater, soweit er sich erinnern kann, war
ein autoritärer Mann, der ein Konflikt-Verhältnis zu seinem
Sohn hatte wegen seiner Trinkerei und seiner politischen
Zugehörigkeit - Brepohl musste
immer als hartnäckigen Anhänger der Monarchie und als Mann,
der die Sozialdemokraten hasste, an ihn denken. Für den
Grossvater war alles was unkorrekt, ungerecht und die Ordnung
störend war, ein Synonym für Sozialdemokratie. Er arbeitete
als Chef einer Kohlenmine und hatte sich daran gewöhnt die
Arbeiter ständig politisch zu verdächtigen; ausserdem hatte er
eine Abneigung gegen jede intellektuelle Laufbahn, da er es
für eine wirkungslose und unnütze Tätigkeit hielt. Laut diesem
Lutheraner fügten sich auch die Pastoren in dieses Urteil, sie
wurden von ihm als ein notwendiges Übel angesehen, da sie zu
Erhaltung der Disziplin bei den untergeordneten Klassen
dienten; aber trotzdem fand er, sie wären der Arbeit nicht
sehr zugeneigt und verglich sie mit fliegenden Händlern, die
ihre Arbeiter ausnützten.
Er wünschte sich, dass sein Enkel ihn
als Meister des Kohlenwerkes ablöste und deshalb hatte er oft
Streitigkeiten mit ihm, da er sich so frühzeitig mit Lesen
beschäftigte. Er befürchtete, dass sein Enkel, sowie auch sein
Sohn und sein Bruder, sich zu einem Sozialdemokraten
entwickelte. Andererseits war seine Grossmutter, sowie auch
ihre beiden Brüder, die von einer Bauernfamilie aus Westfalen
abstammten, sehr fromm und sehr liebevoll mit dem kleinen
Wilhelm; bei ihnen lernte er die erste Lehre der pietistischen
Orientierung, und dank ihres Eingreifens wurde die Resistenz
des Grossvaters gegen Wilhelms Religiosität gemildert. Von
ihnen erhält er seine ersten Geschenke, Ratschläge, sowie
kleine Reisen, was ihm ein Trost bedeutet vor den Besuchen ins
väterliche Haus und vor der Strenge des Patriarchen dieser
Familie.
In der Jugend wird er vom Virus der
Kinderlähmung angegriffen, was einen Teil seines rechten Armes
und Beines lähmte und ihn viele Wochen ans Bett band. Trotz
der Krankheit erweckte er bei seinen Lehrern die
Aufmerksamkeit durch seine hervorragenden Leistungen als
Schüler in der Grundschule, die in ihm einen zukünftigen
Intellektuellen sahen. Aber es war der Konfirmandenunterricht
der örtlichen Gemeinde, der ihn zur pastoralen Mission führte.
Laut seiner Memoiren,
(...) es war nicht so
sehr wegen der Sonntagsschule, wo alles sehr dogmatisch war
und sich immer wiederholte, sondern weil ich dort einen Freund
kennenlernte, der Mennonit war und der mich zu den
Zusammenkünften in seiner Kirche mitnahm: und alles was ich
dort hörte, sich auf sehr überzeugende Weise bei mir
einprägte: es war ein Glauben, der sich auf das wirkliche Wort
Gottes aufbaute und nicht nur auf Glaubenssätze, durch die
Arbeiten die ich machte, wurde ich bald von den Lehrern als
jemand der für die missionarslaufbahn berufen war, erkannt.
Die nicht Übereinstimmung des
Grossvaters mit den religiösen Neigungen des Enkels waren
verantwortlich für sein Fortgehen aus Katernberg. Er kam unter
die Obhut eines entfernten Onkels mit Namen Carl von Schmidtz, der für seinen Unterhalt
verantwortlich war. Ihm hatte er zu verdanken, dass er in die
Sekundarschule und später ins evangelische Seminar in Florenz
kommt. Seine Zuneigung zum Onkel und sein Argwohn gegen seinen
Vater wurden am Anfang seiner Karriere als Schriftsteller
klar, da er das Pseudonym Carl von Schmidtz-Hofmann
benutzte, als er, noch in Ungarn, einige Texte über die Kultur
der Zigeuner herausbrachte. Aber den Vater und den Grossvater
erwähnt Brepohl fast nie so
ausführlich in seinen Texten, auch nicht als er seine
Erfahrungen über die unvergessliche Zeit der deutschen
Monarchie oder die Erlebnisse in seinem Geburtsort beschreibt.
Seine ersten Gehälter als junger Pastor
in der Schweiz müssen sehr bescheiden gewesen sein, denn
nebenher arbeitete er als Gärtner bei reicheren Familien, um
sein Einkommen etwas zu verbessern. Und als Gärtner, eine
körperliche, untergeordnete aber sehr naturverbundene
Tätigkeit, erwähnt Brepohl öfter
diesen Beruf als eine Metapher der Hingabe zur Natur und zur
Heimat. Als solcher erregt er das Aufsehen einer Malerin, die
zehn Jahre älter ist als er, Julia Hofmann, seiner zukünftigen
Ehefrau. Mit ihr erlebt er ein Universum, das für sein
vorheriges Leben sowie auch für das protestantische,
asketische und nationalistische Europa, sich total anders
darbietet: das kulturelle Milieu des Monte Verità. Es handelte
[112]
sich um ein kleines Dorf in Locarno, das Julias Schwester, Ida Hofmann,
sich erwarb. Sie waren Töchter eines Kohlenwerkbesitzers in
Ungarn. Idas Gefährte, Henri Oedenkoven
war der Sohn eines reichen Industriellen aus Antwerpen. Sie
gründeten dort eine anarchistische Gemeinde, wo zuerst acht
bis neun Freunde von ihrer eigenen Arbeit und ihrem
Privatvermögen lebten: sie bildeten eine sich selbst
versorgende Gemeinschaft, wo alle die verschiedensten
Tätigkeiten ausübten, wie zum Beispiel Bienenzucht,
Landwirtschaft, Künstlerisches oder Intellektuelles, wobei
jedem der gleiche Wert angemessen wurde. Sie setzten sich für
die Freikörperkultur ein, für den engen Kontakt zur Natur, die
sexuelle Befreiung, den Vegetarismus und die Flucht aus der
bürgerlichen Zivilisation. Sie schufen eine alternative
Gemeinschaft, wo es keine Autoritäten, Vorurteile oder die
Notwendigkeit der ökonomischen Ausbeute gab. Mit der Zeit
hielten sie es für notwendig ein kleines Gasthaus zu
errichten, um Freunde und Sympathisanten ihrer Bewegung zu
empfangen. Es war ein kleines Geschäft, das ihnen das
Überleben, solange sie eine Gruppe waren, erleichtern würde.
Der Monte Verità wurde von Künstlern, Philosophen, politischen
Flüchtlingen und von vielen anderen Leuten besucht. Einige
kamen aus purer Neugierde und andere als Schüler. Unter ihnen
sind zu erwähnen Hermann Hesse, Isadora Duncan, Bakunin, Lenin, Trotsky,
Paul Klee und eben Lily (Julia)
Hofmann, deren Malerkarriere durch die der "Frau Pastor"
ersetzt wurde (LANDMANN, 1979, S. 26 u. w.).
Wir wissen nicht, inwiefern das
Zusammenleben mit den Anarchisten Brepohls
politische Mentalität beeinflusst hat, denn er erwähnt nie
diese Erfahrung, nicht in den Auszügen seiner Memoiren und
auch nicht in den Texten, die er in den darauffolgenden Jahren
schreibt, als das Ehepaar schon mit zwei Kindern die Schweiz
verlässt, um in der evangelischen Mission in Ungarn tätig zu
sein. Der Kontakt zu dem Paar Hofmann-Oedenkoven
blieb erhalten, sei es durch die familiären Bande sowie auch dadurch, dass es letzteren
finanziell besser ging, was daraus zu schliessen ist, dass die
Anarchisten die Reisespesen der Brepohls
von Deutschland nach Brasilien übernahmen, sowie auch die
Spesen ihrer ersten Monate in Curitiba. Das
war auch die Stadt in die die Leader des Monte Verità Anfang
der zwanziger Jahre definitiv auswanderten. [113]
Auf jeden Fall, wenn Brepohl sich
durch deren Theorien hatte erobern lassen, zeigt es sich, dass
er sich gleich in den darauffolgenden Jahren total davon
entfernt hat; er wird zu einem enthusiastischen Nationalisten
und Anhänger der Monarchie, den religiösen Traditionen, die er
in seiner Kindheit und im Seminar in Florenz erlernte,
zugewandt.
Ausser seiner religiösen Arbeit, widmet
er sich auch der Verbreitung der guten deutschen Literatur,
wie die der romantischen Autoren und etlicher Texte
moralischer Bildung. Er wünschte die deutsche Kultur, sei es
von weltlicher oder religiöser Anschauung über die
territorialen Grenzen hinaus als ein Instrument zur
Bewahrung seiner kulturellen Identität, zu verbreiten.
Es ist interessant zu erwähnen wie Brepohl, laut seinem eigenen Bericht,
zu dieser Aufgabe erwachte, die sich in "seine Lebensmission
verwandelte". [114] Er erinnert sich daran, dass im Jahre
1910, in der Zeitschrift "Die Lese” ein Artikel herausgegeben
wurde mit dem Titel "Wie gewinnt man das Volk für gute
Literatur", eine Art Umfrage an den Leser auf die er mit einem
eigenen Artikel antwortete; darin beschreibt er die
angewandten Mittel der für die Herausgabe von vulgären Texten
verantwortlich waren, die von ihm als Schundliteratur
bezeichnet wurde; seiner Bewertung nach regt diese den Appetit
des Publikums aufgrund der Propaganda an und garantiert ihren
Verkauf durch Abonnements und durch die niedrigen
Herstellungskosten wegen der grossen Auflagen, wodurch die
Ware extrem billig wird und ihre Schirmherren reich macht.
Ausserdem wurde dieses nach Brepohls
Ansicht auch angeregt durch die Tatsache, dass Tausende
unseres Volkes zu Arbeitsmaschinen wurden und im
Maschinenbetriebe des Alltagslebens untergingen. So kam es,
dass viele dahinvegetierten ohne höhere Ideale. Der
Bildungstrieb im Menschen wurde im Volke unterdrückt. Dagegen
versuchte man durch grausame Urteile, zum Beispiel sklavischen
Gehorsam und Furcht grosszuziehen. Nicht ethische Motive,
sondern Furcht sollte das Volk zu guten Staatsbürgern machen.
(1917. S. 9)
Um gegen die Wirkungen dieser Tendenzen
anzugehen, suggerierte Brepohl
die Anwendung derselben Methoden zugunsten der Broschüren, die
durch die pietistische Lehre oder in der romantischen
Literatur inspiriert waren.
Im Jahre 1912 gewann sein
Unternehmerprojekt einen wichtigen Auftrieb, etwas was ihn für
sein Vaterland arbeiten liess. Preussens Minister erliess ein
Gesetz gegen pornographische Filme und Brepohl
wurde vorübergehend als Zensor engagiert. Die Ausübung dieser
Funktion wies ihn "auf die Sünden des deutschen Volkes und auf
ihre untergründigen und dunkeln Seiten "hin und so beschloss
er Texte herauszugeben, die das Volk über die Schäden der
pornographischen Literatur und der Filme aufklären sollten.
Dadurch erhielt er finanzielle Unterstützung zur Organisierung
von Wander-Bibliotheken und ausserdem vom Roten Kreuz, um den
Gefangenen dieselben Broschüren oder Bücher, gebraucht, sowie
auch Bibeln oder Gravuren des Heimatlandes kostenlos zu
schicken. Zu diesem Zeitpunkt ist er, in Wiesbaden, auf halbem
Weg zum Monte Verità, wo freie Liebe praktiziert wurde, und
nach Katernberg, seinem Geburtsort, wo vielleicht seine
Halbbrüder sich befanden, wahrscheinlich als Arbeiter, Sklaven
jener Maschinerie im Arbeitsprozess der Industrie.
Von Wiesbaden geht er nach Berlin, wo er
ein Amt in der Propaganda-Abtei1ung der preussischen Landwirtschaftsforschungsgesellschaft
antritt,
ein weltlicher Beruf in einer halbstaatlichen Firma, wobei er
aber nicht seine Tätigkeiten in der VDL vernachlässigt.
Obwohl zu der Zeit seine professionelle
Situation ihm einen sozio-ökonomischen Auftrieb erlaubt,
entscheidet er sich gerade zu dieser Zeit nach Amerika als
Pastor der Evangelisationsmission für das Ausland,
auszuwandern. Die Gründe zu seinem Aufbruch sind nicht sehr
klar; mal sagt er den Intellektuellen von Weimar zum Opfer
gefallen zu sein, die von ihm verlangten, dass er sich an die
Partei anschliessen sollte - obwohl er nicht den Namen des
Verbandes erwähnt; mal hebt er hervor, dass er nach Amerika
gerufen wurde, um dem Deutschtum im Ausland zu dienen oder
dass er durch die Kommunisten in seinem professionellen
Aufstieg behindert wurde. Laut zwei seiner Söhne war Brepohl verschuldet, da er einen guten
Teil der Erbschaft seiner Frau einem Freund geliehen hatte.[115]
Die Tatsache ist, dass gewollt oder ungewollt, er 1925 mit
seiner Frau und seinen fünf Kindern nach Brasilien kommt.
Obwohl er vorhatte in Buenos Aires, seinem gewünschten Ziel,
eine Gemeinde zu übernehmen, lässt er sich letztendlich in
Paraná nieder. Zuerst geht er nach Lapa
und gleich darauf nach Ponta Grossa als Koordinator der
evangelisch-lutherischen Volksmission.
Seine erste Gemeinde bestand aus
Deutsch-Russen. Um ihnen beizustehen, reiste Brepohl ständig von Kolonie zu Kolonie
oder auch bis nach Curitiba, um Hilfe und Auskünfte, die ihm
nützlich sein könnten, zu holen. Er hielt Kontakte mit
offiziellen Autoritäten in Deutschland und Brasilien aufrecht,
sowie auch mit Vertretern des Mutterhauses, indem er über den
Verlauf seiner Arbeit in den Kolonien berichtete und auf ihre
Bitten und Forderungen einging. Als guter Beobachter der
Sitten und Bräuche aller Volksstämme, die er besucht, hatte er
seine Erfahrungen mit dieser Gemeinde in Broschüren, Büchern
und Zeitungsartikeln niedergeschrieben und herausgegeben,
wodurch er als Spezialist für deutsch-russischer Kultur
bekannt wurde.
Wie es unter Pastoren oder Beamten im
Ausland üblich war, sollte seine intensive Hingabe in der
Missionarsarbeit ihn zu einer gehobeneren Stellung in der
Evangelischen Kirche führen oder wenigstens ihm eine gute
Altersversorgung einbringen und in beiden Fällen die
Möglichkeit zu einer Rückkehr nach Deutschland. Aber die
Ereignisse nach 1933 brachte seine Pläne zum Scheitern; mit
dem zweiten Weltkrieg wurde eine eventuelle Rückwanderung in
sein Vaterland noch unwahrscheinlicher.
Durch diese Beobachtungen kann man
erkennen, dass Brepohls Leben
seit seiner Kindheit von ständigen Migrationen gekennzeichnet
war. Aber es ist nicht nur das. Noch wichtiger ist, dass er
viele Erfahrungen durchgemacht hatte, die ihn immer in
schwierige Situationen brachten, seien sie ökonomischer,
sozialer, psychologischer oder politischer Art, wie zum
Beispiel, zwischen dem Sozialismus des Vaters und dem
Konservatismus des Grossvaters; zwischen der Nichtgläubigkeit
dieser und dem Pietismus der Grossmutter; zwischen der
Monarchie und dem Anarchismus; zwischen dem Adel seines
Stiefvaters und dessen Frau und seinem eigenen sozialen Stand.
Ausserdem gab es noch viele Übersiedlungen ins Ausland, wie
Italien, Schweiz, Ungarn und Brasilien; aus dem Ruhrgebiet zum
Monte Verità oder in ein Vorort Berlins; aus der Hauptstadt
Paranás, wo die reicheren Deutsch-Brasilianer lebten in die
Kolonien des Innern; aus der absoluten Sicherheit, dass durch
das neue Deutschland all seine Anstrengungen in seiner Arbeit
anerkannt würden - in eine fast totale Ungewissheit im Alter.
Eine dauernde, schwierige Situation, als
ob man sich immer als permanenter Immigrant fühlt, führt,
konkret oder mythisch, dazu immer in die Welt zurückzuschauen,
die man verlassen hat und in die zu schauen, die nun die meine
sein wird. Man muss die Vorteile und die Nachteile berechnen,
die bei solch einer Änderung auftauchen, man muss der Angst
vor dem Neuen und dem Groll des Zurückgelassenen
gegenübertreten, man muss vergessen, aber auch ins Gedächtnis
zurückrufen.
Aber Brepohl
war nicht irgendein Auswanderer: er war nicht so arm, dass er
Schlange stehen musste bei einer Kolonisationsgesellschaft, um
Platz auf irgendeinem Schiff zu bekommen. Er war ein Mann, der
studiert hatte, und obwohl seine Schriften von der gebildeten
Berliner Bourgeoisie verachtet wurden, wurde er unter den
Deutschbrasilianern als ein Gelehrter und eine
vertrauenswürdige Autorität anerkannt, jemand der sie mit
einem anderen Milieu ihres Vaterlandes in Verbindung brachte,
als nur diesem ihrer Dörfer und ihres alltäglichen Lebens.
Aber auch als Pfarrer macht er eine
schwierige Situation durch. Durch seinen Pietismus mochte er
wohl von der Führung der Synode
nicht sehr geschätzt gewesen
sein. Im Schoss der Bekehrenden Kirche war kein Platz für
seinen radikalen Patriotismus; er wurde auch nicht von den
Laien-Pfarrern anerkannt, da er ein Reichsdeutscher war und im
Übrigen befand sich die Gemeinde, der er diente, am Rande der
ekklesiastischen evangelischen
Politik. Alle Wochen musste er hin und her reisen, um sich mit
seiner Gemeinde, dem Konsul oder mit seiner Familie zu
treffen.
Unter diesen Umständen der ständigen
Reisen sucht Brepohl einen
einsamen Dialog, der gleichzeitig der einzige Sichere ist-, er
widmet sich der Lektüre und der Produktion von Broschüren,
denn die Literatur, sei sie weltlich oder religiös, wurde ihm
zur ständigen Begleiterin.
Der Pietismus oder
der Sieg der aufgeklärten Religion über die Wissenschaft und
die Aufklärung
Wie wir schon hervorgehoben hatten,
begleitet der Pietismus Brepohl
in seiner ganzen erzieherischen und intellektuellen Ausbildung
seit seiner Kindheit bei seinen engsten Verwandten bis zu
seiner Ausbildung im Seminar in Florenz. Aber dieses ist auch
eine Erscheinung seiner Zeit und der eigenen ekklesiastischen deutschen Geschichte.
Während die akademische Theologie sich vor allem in der
Jahrhundertwende der Auslegung von Schriften unter den
Kriterien der profanen Wissenschaften, seien sie positiv oder
geschichtlich, widmete, experimentierte ein guter Teil der
Gläubigen eine Auffrischung des Glaubens von reisenden
Pastoren und Missionaren, inspiriert, die die relativ
unabhängige Form des hohen Klerus in armen Siedlungen, auf
öffentlichen Plätzen und vor den Fabriken predigten. Sie
sprachen über ihre wichtigsten Notwendigkeiten, das Bereuen
ihrer Sünden, die Liebe Gottes zu jedem einzelnen Zuhörer.
Es waren religiöse Bewegungen und
Manifestationen, die als Reaktion zum Materialismus und zur
liberalen Theologie auftauchten und die von derselben Lehre
geleitet wurden, die die religiösen Bewegungen des 17.
Jahrhunderts inspirierten.
Bevor wir versuchen den Pietismus nach Brepohls Lektüren und Anwendungen zu
verstehen, sowie auch dessen Einfluss in den
deutsch-brasilianischen Gemeinschaften, halten wir es für
interessant, wenn auch kurz, über die hauptsächlichen Aspekte
seiner Geschichte zu schreiben.
Im Gegensatz zu den Mennoniten oder den
Methodisten, hat der Pietismus keine Spaltung in der
Reformationskirche provoziert. Es handelte sich um eine
Bewegung von populärem Charakter, die sich in den Gemeinden
unter den Pastoren, die an die armen Schichten der
Gesellschaft gebunden waren, bildete, um die ekklesiastische Politik der
lutherischen Orthodoxie in Frage zu stellen, die nach ihrer
Meinung die theologische Reflexion auf ein zu hohes Niveau hob
und die Gläubigen im Stich liess, um sie den weltlichen Regeln
zu überlassen und dadurch die herrschaftliche und die
ökonomische Ausbedeutung zu rechtfertigen. Diese Lehre
beabsichtigte eine Rückkehr zur ursprünglichen Religiosität
des lutherischen Glaubens, durch eine Erweckung, eine
Wiedergeburt zum wahren Glauben.
Jacob Spenner (1635-1705), einer der
Gründer Bewegung, meinte, wie auch Luther, dass diese
Bekehrung zum Christentum von einem persönlichen Entschluss
jedes einzelnen Individuums abhinge, und dass die Bibel der
einzige Weg zum Glauben wäre und dass die Gläubigen sich
täglich ihrer Lektüre widmen müssten; wie Luther, verstärkte
er noch den universalen Charakter des Priesteramtes und die
Notwendigkeit der gegenseitigen Hilfe unter den Gläubigen.14
Während Luther jedoch forderte, dass die
göttlichen Äusserungen sich ausschliesslich in den Sakramenten
und im Wort Gottes offenbarten, unterscheiden sich die
Pietisten von ihm dadurch, dass sie die Notwendigkeit einer
persönlichen Erfahrung mit Gott hervorheben, was in der
Intimsphäre des Individuums vor sich geht. Für Luther, ist der
"Platz" des Herren das himmlische Reich; für den Pietisten
wohnt er auch im Herzen des Menschen. So kehrt sich der
Gläubige in sich selbst in einer Haltung der Introspektion;
diese bringt ihn zu einem schrittweisen Ersatz der ritualen
Gesten und der rhythmischen Gebete (ohne grosse Wirksamkeit),
zu spontanen Gebeten und dem "Fühlen" von Gottes Gegenwart.
Bei Luther glaubt der religiöse Mensch blind an einen weit
entfernten Gott. Für den Pietisten spricht Gott direkt zu dem
Gläubigen, was man durch eine kultivierte Sensibilität
bemerken kann (KAISER, S.7). Es ist Gott selbst, der den
Menschen sucht um ihm seine Gnade zu erweisen:
Die neue Geburt 1st ein Werk Gottes, des Heiligen
Geistes, dadurch ein Mensch aus einem Kinde des.
Aus den Schriften von Spenner, Pta
Deslderta, Grundlagen über den christlichen
Glauben, laut SAUBERZWEIG. (1959, S. 34-35), stellt es das
wichtigste Dokument der Bewegung dar.
Zorns und der Verdammnis ein Kind der
Gnade und Seligkeit wird, aus einem Sünder ein Gerechter durch
den Glauben, Wort und Sakrament; dadurch auch unser Herz, Sinn
und Gemüt, Verstand, Wille und Affekten erneuert, erleuchtet,
geheiligt werden in uns nach Christo Jesu zu einer neuen
Kreatur, denn die neue Geburt begreift zwo Hauptwahrheiten in
sich, die Rechtfertigung und die Heiligung oder Erneuerung.
(Arndt. 1555-1621. apud
SAUBERZWEIG, 1959. S. 25)
Aber dieser neue Mensch mit dieser
Sensibilität ausgestattet darf uns nicht dazu verleiten den
Pietismus als eine Lehre zu verstehen, die sich auf das
kontemplative Leben beschränkt. Der Mensch muss seine Liebe zu
Gott durch seine Taten bezeugen, sowohl die im Zusammenhang
mit sich selbst, als auch jene die die Liebe zwischen den
Glaubensbrüdern ausdrücken. Es gibt also eine Schwankung
zwischen dem Quietismus und dem Aktivismus, der religiösen
Selbstbetrachtung und dem Nachdenken über weltliche
Aktivitäten, der Intimität mit der Familie, der Arbeit, den
Brüdern in Hinsicht auf das spirituelle und emotionelle
Reifen, aber auch zur Entwicklung des materiellen Lebens. 55
Diese Vervollkommnung muss von allen
Mitgliedern der Gemeinde angestrebt werden. Daraus gehen
Gesellschaftsformen hervor, die durch gegenseitige Hilfe
gekennzeichnet sind, wie zum Beispiel die zahlreichen Unterstüzungsvereine zur Hebung der
Erziehung, Gesundheit und Sicherheit. Laut Kaiser können die
Pietisten als die wahren Urheber des sozialen Wohlstandstaates
seit Ende des 18. Jahrhunderts angesehen werden.
*5 wir beziehen uns hier nicht auf die
Rationalisierung der Arbeit mit der Absicht die Produktivität
und den Gewinn zu vergrössern - einer Mentalität die sich,
laut Nipperdey. durch den calvinistischen Puritanismus
imprägniert, aber nicht durch den Pietismus von lutherischer
Herkunft. Laut diesem Autor, "ist die Arbeit für Luther eine
erzieherische Aufgabe, von religiösem, moralischem und
sozialem Charakter (...) die Arbeit ist vor allem eine
Dienstleistung (...) und nicht verknüpft an den Gedanken von
Erfüllung oder Erfolg (1986, S. 39).
Durch diese Überbewertung der
Vereinsgründung und des Begriffes "Gemeinschaft" haben sie
sich aber historisch von den nationalen und politischen
Problemen entfernt [116];
diese Interesselosigkeit wurde zum Teil durch die
organisatorische Struktur des öffentlichen Lebens in
Deutschland begünstigt, wo die politischen Probleme für lange
Zeit praktisch als ein Synonym für bürokratische Untüchtigkeit
angesehen wurden; ausserdem wurden die Einrichtungen, die den
staatlichen Organisationen angehörten, als besonders
artifiziell betrachtet, und zwar aufgrund ihrer vertraglichen
Begriffe, in denen die Auseinandersetzungen über diverse
privat- Interessen mehr nach Rangordnung klangen als vielmehr
nach Zustimmungen, in denen man die eigenen Interessen im
Namen der Allgemeinheit zurückzustellen hatte.
Nach Meinung eines Pietisten des 18.
Jahrhunderts;
Je weniger die Leute selbst wissen, dass
sie eine Sozietät sind, je besser ist's, denn sobald Brüdern
und Schwestern Regeln gegeben werden, so wird dem Heiligen
Geist seine Arbeit gehindert. (apud
KAISER, o/d. S. 731
Aber wenn sie von der
institutionalisierten politischen Macht abkommen, bedeutet das
nicht, das sie keine positive Bindung zur Nation haben. Dem
König, der als gut bezeichnet wird, da er der Gründer des
Vaterlandes ist, sowie Gott den Kosmos erschaffen hat, sollen
sie Respekt und Gehorsam. Im Einverständnis mit Luther werden
ihre Gesetze als ein Ausdruck der weltlichen Macht befolgt,
aber sie widmen ihre grösste Aufmerksamkeit und Hingabe der
spirituellen Tätigkeit.
Die pietistische Bewegung hat, ohne
bedeutsame Spaltungen, mit der offiziellen Kirche bis zu
Anfang des 20. Jahrhunderts in Einklang gelebt, und in vielen
Fällen hat sich die Volkskirche über die Landeskirche erhoben,
aber zu verschiedenen Zeitpunkten auch mit ihren theologischen
Anschauungen und ihre Ethik zwischen der einen und der anderen
Kirche vermittelt. Aber wenn die liberale Theologie eine
intellektuelle Einengung mit dem Rationalismus der
Aufgeklärten vorschlägt, eine nach aussen gewandte
Religiosität und nicht eine aus dem Herzen kommende, und die
Aufgeklärten ihrerseits das Ende der Religion erklären,
erneuern die Pietisten ihre Utopien in dem sie immer
wiederholen, dass eine Bewegung notwendig ist, die die
Gläubigen zur Zentralisierung des christlichen Glaubens
erwecke und dem sie sich ohne jegliche Voraussetzungen
unterordnen sollten. In diesem Zusammenhang organisieren sich
Predigten, Bewegungen zur Erweckung des individuellen
Glaubens, Evangelisationskampagnen und die Organisation
etlicher Departments der Kirche, die ausschliesslich an die
Gläubigen der Diaspora (die Evangelischen, die im Ausland
leben) gerichtet sind.
Es sind diese Organisationen und
Behörden, die Seminare wie das in Florenz unterhalten, sowie
auch die Produktion von religiöser Literatur mit der Absicht,
die Lehre zwischen der unteren und der mittleren Schicht der
Gesellschaft zu verbreiten. Die Broschüren, die von Brepohl geschrieben und herausgegeben
wurden, sind hier ein bedeutsames Beispiel. In diesen
Broschüren bringt der Autor, noch in Europa, seinen Kompromiss
mit denjenigen, die sich öffentlich den neuen Tendenzen der
liberalen Theologie entgegensetzen, zum Ausdruck.
Laut einem seiner Artikel, behauptet Brepohl, dass es im Namen, des "wahren
Glaubens" (eine Bezeichnung, die sich durch die radikale
Ablehnung zur Theologie der Liberalen kennzeichnet), auch
transkonfessionelle Bewegungen legitimiert werden, die nicht
nur die diversen evangelischen Glaubensrichtungen
einschliessen, sondern auch die katholischen: "Der neue
Kulturkampf wird nicht zwischen Protestanten und Katholiken
ausgetragen, wie im 19. Jahrhundert, sondern zwischen
Liberalen und Christen" (1913).
In einem anderen allgemeinverständlichen
Text, erklärt der Autor detailliert welche, seiner Ansicht
nach die "Feinde des Glaubens" waren ]7; in seinem
Anfangsargument fragt er sich nach der Möglichkeit des
Glaubens an die Existenz der Hölle zur Jahrhundertwende. Die
Antwort ist zustimmend, denn die Hölle darf nicht als ein
konkreter und sichtbarer Raum in den Augen der wissenden
Menschheit verstanden werden, sondern als existentieller Raum,
der neu entsteht, wenn die Menschen geistigen Hunger oder
Durst spüren. Und das geschieht in verschiedenen Situationen:
wenn der Mensch nicht mehr zur Kirche geht, wenn der Vater
seiner Familie nicht mehr aus der Bibel vorliest; wenn man
nicht mehr bei Tisch betet; aber auch wenn eine Frau tanzen
geht, oder wenn ein Jugendlicher aus dem Haus geht und seine
Mutter weinend zurücklässt oder auch bei Zusammenkünften von
Freidenkern; hier gibt es Gott nicht, und wo Gott nicht ist,
ist Hölle, die Finsternis, das Gefühl der Verlassenheit. Bei
dieser Denkweise ist das Fehlen der Frömmigkeit, das Ablehnen
der festen moralischen Begriffe, die Sensualität oder der
Kontakt zum weltlichen Denken als Symptome eines Lebens
anzusehen, das sich von den Werten der Hölle lenken lässt,
eines existentiellen Zustands und keines physischen.
Diese Kommentare stammen aus einer Broschüre, die
in Brasilien verteilt wurde, dessen Autor unbekannt ist. Aber
durch den Inhalt und die Zitate kommt man zu dem Schluss, dass
es sich um eine Predigt eines pietistischen Pastors aus
Deutschland handelt aus den 10er. Jahren und dessen Ideen Brepohl als die seinigen annimmt
(BREPOHL. 1933).
Diese ersten Broschüren, die unter der
Wirkung der politischen und kulturellen Ereignisse geschrieben
wurden, die Deutschland beeinflussten, und in einer
Ausdrucksweise, stark die Gegenwart des Erzählers ausdrückt ]8,
stellen eine wichtige Dokumentation für unsere Studien dar,
weil sie uns erlauben, einige Aspekte des Pietismus zu
durchschauen, denen auch in Brasilien durch Brepohl und wahrscheinlich auch andere
Pastoren Ausdruck verliehen wurde.
Der Begriff "Volkstum", zum Beispiel,
anfangs von den Romantikern als Synonym der Volksgemeinschaft
gedacht, hat bei Brepohl eine
tief religiöse Bedeutung. Volkstum grenzt eine Gemeinschaft
absolut von den anderen ab. Aber, wer sind die anderen?
Diejenigen, die noch nicht der Gemeinschaft angehören, sei es
aus Ablehnung, geistlicher Schwäche oder Unkenntnis. So
bedroht der Ungläubige, der schwache Mensch, aber auch der
Kapitalismus oder der Marxismus, also die weltliche Macht,
permanent die christliche Gemeinde. Damit will ich aber nicht
sagen, dass man einfach Luthers oder Augustins Auslegungen
erneuern sollte. Brepohls Ansicht
ist eine andere: absorbieren wurde zum Zwang, aber besser [117]
noch wäre die Ausschaltung der weltlichen Macht, durch
laufende Ausbreitung der religiösen Gemeinde; diese Ausdehnung
sollte sich nicht aus einem vorgeplanten Projekt ergeben,
sondern als ein natürliches Ergebnis der evangelischen
Tätigkeiten, das langsam die Denkweise und die soziale
Organisation weltlichen Charakters ausschalten würde.
Wir können von einem neuen Theozentrismus sprechen, obwohl man
nicht die Existenz einer einzigen Geistlichkeit fordert, wie
in der katholischen Kirche.
Dieser Theozentrismus
sollte nicht nur in den Beziehungen zwischen den
Gemeindemitgliedern bestehen und ebenso wenig auf ihre
alltäglichen Beschäftigungen beschränkt sein; sie sollte in
die innerste Sphäre des Menschen eindringen, wie die ersten
Pietisten es empfahlen. Als Brepohl,
(1916), über die Bedeutung der inneren Freiheit schreibt,
lässt er sich ausführlich über die Entdeckung der
Persönlichkeit aus. Seiner Ansicht nach ist diese nur möglich,
wenn man ein religiöses Leben führt:
Den Alten sind noch die 50er. bis 80er.
Jahre des aufgeklärten 19. Jahrhunderts in Erinnerung, in
denen Glaubensleben für eine pathologische Krankheit müssiger
Köpfe gehalten wurde (...) - nun, diese Zukunftsmusik ist
verrauscht? Warum? (...) Sie erlag unter der erdrückenden
Tatsache des gewaltigen Sehnens nach dem Göttlichen unter den
heute führenden Geistern. (...) und doch ist der Zusammenhang
von Persönlichkeit und Gebetsleben der denkbar Innigste
(denn...) was ist die Persönlichkeit anders, als das
Bei-sich-selbst-sein des Geistes
im Denken, das Prinzip der Einheit, von der alle Handlungen
ausgehen und auf die sich alle nutzend oder schadend zurückzubeziehen?
Diese einsame Haltung, die aber zur
gleichen Zeit einem guten Teil des deutschen Volkes so
geläufig war, verursachte, laut dem Autor, eine Erneuerung
ihrer Kräfte, als es durch den grossen Krieg soviel Leiden ertragen musste. Die
Notwendigkeit Gottes wurde dem deutschen Volk durch den Krieg
bewusst. Laut Brepohl, hat das
Volkstum, ein Erbe der Reform, ihnen den Geist genährt und
wurde zu einer ganz besonderen Erfahrung unter den Deutschen.
Eine Erfahrung, die gleichzeitig von allen durchgemacht wurde;
als wenn zu einem bestimmten Zeitpunkt und aus denselben
Gründen alle zusammen ein Lied singen würden. Durch den Krieg
und dem Leiden haben sich die Bande zwischen den Menschen
erneuert, Konflikte wurden gemildert und selbstlose Gedanken
erweckt. [118]
So hat die Entdeckung des innerlichen Lebens, die zur
Ausarbeitung der Identität jedes einzelnen beigetragen hat,
historisch mit dem Erwachen zur kollektiven Identität
übereingestimmt. Beim Formulieren dieser Einstimmung, lässt
der Autor sich zur Reflexion über das patriotische Gefühl
leiten.
|
Siehe noch: BREPOHL, 1917a |
Unter Heimat verstehen wir hier nicht
das Vaterland, wie man etwa dieses Im Ausland wellend (...)
Unter Heimat im Sinne der Heimatpflege ist jedes Mal der Teil
unseres weiten deutschen Vaterlandes zu verstehen, in dem die
Bewohner durch Abstammung, geschichtliche Vergangenheit, Sitte
und Mundarten zusammen gehören. (...) Wenn im Sommer, nach
Feierabend auf der kleinen Bank vorm Hause, all und jung
beisammen sass, und nun die Alten die Traditionen der Familie
den Jungen erzählten, (...) dann triebe die Alten unbewusst
Heimatpflege. Und wenn beim einfachen Bürgersmann und
Handwerker der zugewanderte Geselle nach gemeinsam
verrichteter Arbeit, (...) seinen Nachbarn, von seiner
Wanderfahrt, von Sitten und Gebräuchen anderer deutscher
Volkstämme erzählte/ dann trieb er Volkskunde, dann erwachte
in den begeisterten Zuhörern der Stolz, ein Deutscher zu sein.
Durch dieses Handeln regt er seinen
Nächsten an zur Ruhe zu kommen und diese Ruhe leitet ihn
folglich zum Gebet. Das Gebet führt zur Selbstlosigkeit und
dazu, dass man an den Nächsten denkt und so kommt man zum
patriotischen Gefühl. Aber damit dieses Gefühl besteht, ist es
notwendig, dass die Menschen in ihre Vergangenheit blicken und
das Beispiel ihrer Eltern betrachten. Und es genügt nicht sich
an den Geburtsort gebunden zu fühlen, man muss ihn auch heben
und die geistigen Güter, die er ausstrahlt, seinen Nachkommen
weitergeben.
Das Bild und die Überlegungen, die in
diesen ersten Texten von F. W. Brepohl
ausgearbeitet wurden, erlauben uns einen von ihm angewandten
Schlüsselbegriff zu bekommen, der alle durchgearbeiteten Themen
durchflicht: das Wort Volkstum, dass hier angewandt wird um
die individuelle Sphäre (besser gesagt, das innerliche Leben),
sowie auch die sozialen Beziehungen abzuschirmen und um ein
Bindeglied zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart - dem
Vaterland, zu bestimmen. Mit ihm macht der Autor einen
Querschnitt in der Zeit, was ihm erlaubt die Erfahrung der
Gleichzeitigkeit für das ganze deutschsprachige Volk zu
verstehen (in Hinsicht auf das erlittene Leid während des
Krieges).
So würde er sich an die Deutschen aus Ungarn,
Serbien, Frankreich, sowie auch an die Deutschen, die in
Deutschland lebten und die durch die Liberalen, die Armut, die
Nichtgläubigkeit, die Modernität bedroht wurden, wenden. Und
durch dieselbe Brille würde er auf seine erste Gemeinde in
Brasilien schauen, die zufälligerweise "Deutsche" waren oder
eben auch nicht, die tief gekennzeichnet waren, von den
pietistischen Bewegungen, durch die Migrationen, durch die
Bedrohungen die mit dem nicht-religiösen Denken verbunden
waren: die Wolga-Deutschen, die vor dem Panslawismus und vor
der bolschewistischen Revolution nach Paraná flüchteten.
Die Neue Heimat [119]
In seiner Funktion als Schriftsteller
betrachtet Brepohl das Leben der
Wolgadeutschen seit 1917 sehr gründlich. Sein Interesse für
sie zeigt sich in seinen Broschüren von da an, wo diese
ethnische Gruppe wegen der Landzerstückelung aus
Erbaufteilungsgründen von Russland nach Deutschland
emigrierte, eine Abwanderung, die sich während der
bolschewistischen Revolution noch verstärkte. Über diese
Ereignisse schreibt Brepohl
verschiedene Artikel, in denen er klarlegt, dass die
Revolution ein wahres Massaker der Kultur und der materiellen
Besitztümer für die Deutsch-Russen hervorrief. Er erwähnte
ebenfalls, dass diese Wolgadeutschen in Deutschland von vielen
als Ausländer diskriminiert wurden. Andererseits bemerkt er
aber, dass die Regierung Unterkünfte für diese Flüchtlinge
schuf, unter anderen, eine in Zossen, wo er zu dieser Zeit
wohnhaft war. Es ist anzunehmen, dass die Zeitschriften des
VDL unter diese Flüchtlinge verteilt wurden,
und die Stellung, die Brepohl
innehatte, gewährte ihm grösseren Kontakt zu den Immigranten.
Das "Massaker" gegen die Wolgadeutschen
ist nach deren Ansicht darauf zurückzuführen, dass sie einen
Drittel der ganzen Bevölkerung Russlands ausmachten, die 24 %
des Territoriums besetzte. Und als die Bolschewiken siegreich
aus der Revolution hervorgehen, werden die Wolgadeutschen
landesverwiesen, weil man sie als Kapitalisten betrachtet und
weil sie im weiss-russischen Heer an der Seite der
Zaren-verteidiger gekämpft haben.
Als sie dann nach Deutschland flüchten,
unterstützt sie auf verschiedene Art die Sozialhilfe einiger
religiöser Institutionen; aber hauptsächlich hilft man ihnen,
andere Siedlungsgebiete zu finden, wie zum Beispiel in
Holland, Kanada, Brasilien und in der Schweiz, da sie durch
die rückläufige nationale Ökonomie in Deutschland vom
Arbeitsmarkt nicht aufgenommen werden konnten. Aus diesem
Grunde wanderten viele von ihnen nach Paraná aus, wo sie ihre
eigenen ethnischen Gruppen fanden, die Mitte des 19.
Jahrhunderts dort eingewandert waren, weil sie aufgrund ihres
panslawischen Nationalismus politisch verfolgt wurden.
Das Interesse Brepohls
an diesen Wolgadeutschen lässt sich hieraus erklären: sein
Freund aus Kindertagen stammte aus einer mennonitischen
Familie und war Sohn eines eingewanderten Arbeiters aus
Ost-Europa; indirekt wurde Brepohl
durch diesen Freund zur religiösen Karriere stimuliert. Hinzu
kommt die Tatsache, dass er sich intensiv mit Ethnologie
beschäftigte und sich stark dafür interessierte, die
Eigentümlichkeiten der verschiedenen Kulturen zu erkunden,
einem Erbe der romantischen Literatur, die er so vergötterte.
Ein anderer Grund war sein starkes Gefühl der Verwurzelung in
die deutsche Heimat, die seine Familie vor mehr als einem
Jahrhundert schon verlassen hatte. Als letztes muss man noch
erwähnen, dass die Wolgadeutschen in Russland ja diverse
Diskriminierungen erlitten hatten, etwas, das für einen
Pfarrer als ein/ Opfer im Namen des Glaubens
anzusehen war.
Das Buch, das Brepohl
als Schriftsteller eben dieses Problems bekannt machte, war: Die
Wolgadeutschen im brasilianischen Staate Paraná, dass er zusammen mit Fugmann23
veröffentlichte. Dieses Werk entstand aus Anlass des
50-jährigen Jahrestages der Immigration dieser Gruppe in
Brasilien, (1927), als Erinnerungsschrift an dieses Jubiläum.
Es handelt sich dabei um eine Erzählung in Form eines Epos
über "Helden des Alltags", die, wenn ihre Namen nicht in einem
Anhang dieses Buches genannt worden wären, immer unbekannt
geblieben wären. Jedoch liefert das Buch, über seine
monografische Darstellung hinaus, viele Informationen der
Deutschen und Deutschstämmigen, die die neue Heimat,
Brasilien, besiedeln. Sie sind also auch Mitbegründer eines
Teils dieser Nation, und als solche sollen sie gerühmt werden.
Diese Herausgabe besteht aus drei
Teilen: der 1. Teil, von Fugmann verfasst, bringt die
Geschichte dieser Einwanderungsgruppe vom 18. Jahrhundert an
bis zu ihrer Niederlassung in Brasilien; im 19. Jahrhundert
wurden die Immigranten, die wegen der russischen Revolution
auswanderten, nicht erwähnt. Der 2. Teil, von Brepohl verfasst, trägt die
Überschrift: "Der Alltag der Wolgadeutschen"; und der 3. Teil
enthält die Namen von Einwanderer-Pionieren, sowie den Tag
ihrer Ankunft in Brasilien. [120]
Das Buch beginnt mit einem Gedicht von
Reinhold Braun zur Ehrung des Heimatlandes, Deutschland;
bemerkenswert daran ist, dass diese Wolgadeutschen doch
eigentlich schon aus Russland kamen, das seit dem 18.
Jahrhundert von ihnen besiedelt wurde. Diese Siedlungen an der
Wolga waren - laut Fugmann - Opfer eines königlichen
Eidbruchs, indem die Zarin Katharina II. ihnen 1767 bestimmte
Privilegien zugesagt hatte, wie zum Beispiel interne
Rechtsprechung, autonome Verwaltung und Befreiung vom
Wehrdienst, was jedoch von den Nachfolgern der Zarin nicht
eingehalten wurde.
Diese politische Neuorientierung ist
zurückführen auf den panslawischen Nationalismus, durch den
die russische Obrigkeit die deutschen Immigranten als eine
Bedrohung des Landes ansah. Es wurden deshalb verschiedene
Massnahmen getroffen, um die erworbenen Rechte der Einwanderer
zu beschränken, bis sie von selbst aufhören würden zu
bestehen; 1874 wird die Freistellung vom Wehrdienst gesetzlich
aufgehoben, was die Wolgadeutschen zwingt, definitiv russische
Staatsbürger zu werden. Laut Fugmann gab es aber auch
religiöse Gründe, die sie veranlasste, den Militärdienst
abzulehnen. Viele von ihnen waren ja Mennoniten, deren
Religion es verbietet, zur Waffe zu greifen. Aber gleich, ob
ihre Art der Ablehnung juristisch oder religiös bedingt war,
vermischt Fugmann dies in seinen Erzählungen: die Ablehnung
richtete sich generell gegen einen "ausländischen” Gott. Für
die Gruppe als Ganzes, oder diejenigen, die anderen
Konfessionen angehörten, was das grosse Problem das Fehlen an
Grund und Boden in dieser Gegend, was ihren ethnischen
Zusammenhalt und ihre Unabhängigkeit als Landwirte bedrohte.
Es blieb ihnen nur übrig, in weniger fruchtbare Gebiete zu
ziehen, wie zum Beispiel nach Sibirien, oder in den Städten
Arbeit zu suchen. Wegen dieser Einschränkungen schien das
Auswandern aus Russland für Hunderte von Familien der einzige
Ausweg.
Fugmann schiebt die Wahl vieler
Deutscher, nach Brasilien auszuwandern, Dom Pedro II. zu.
Dieser versuchte, nach Ansicht des Autors, die Landwirtschat
in einem Land der Viehzüchter anzuregen und versprach, das
ursprüngliche Agrarsystem der Gemeinde zu respektieren,
nämlich das mir-System, nach dem der Besitz aller zehn Jahre
zwischen den volljährigen Männern neu verteilt wurde, wodurch
es keinen individuellen Landbesitz gab und nicht das Risiko
der festen Grundbesitzbildung. Der Autor hebt das Interesse
des Kaisers, Dom Pedro II., an den Siedlern hervor, so wie er
an anderen Stellen seines Buches öfters erwähnt, dass der
Kaiser Sohn einer deutschstämmigen Mutter sei. Nach Fugmanns
Ansicht sah es Dom Pedro als Notwendigkeit an, die
Weizenproduktion anzukurbeln. Da die Anbautechniken dieser
Getreideart zu jener Zeit noch sehr rückständig waren, fehlte
dasselbe im Lande.
Die Wolgadeutschen genossen Privilegien
während ihrer Ansiedlung und behielten das Kollektivsystem der
Landausbeutung (mir) bis zum Sturz der Monarchie bei. Den
Siedlern wurde das Weggehen durch die Intervention Bismarcks
zur slawischen Regierung wohl erleichtert, eine Annahme, der
Fugmann jedoch nicht zustimmt.
Die ersten Krisen im Siedlungsgebiet
entstanden hauptsächlich aus folgenden Gründen: der erste
wegen des wenig fruchtbaren Bodens von Paraná, im Vergleich
zum Wolgagebiet; der zweite wegen der Auswirkung der Änderung
der Landbesitz-Regelungen. Mit der schrittweisen Einführung
des Landgesetzes in Brasilien, ab 1854, werden auch die
Immigranten allmählich gezwungen, ihre Ländereien
rechtskräftig überschreiben zu lassen und die Bestimmungen des
individuellen Landbesitzes anzuerkennen, was zum Beispiel,
eine Landzerstückelung zur Folge haben würde und dadurch den
Erwerb neuer Ländereien verlangte. In Konsequenz dessen sahen
sich viele von ihnen gezwungen, weiterzuziehen, was die
soziale und kulturelle Gemeinschaft bedrohte. Zur Zeit der
Veröffentlichung dieses Werkes gaben die Jugendlichen bereits
ihre Traditionen auf, denn sie verliessen das Elternhaus, um
in der Stadt zu arbeiten. In dieser Hinsicht diente die
Erinnerungsschrift als eine Ermahnung gegen die Gefahr, die
Traditionen aufzugeben. Das Opfer, das ihre Väter gebracht
hatten, als sie das Wolgagebiet verliessen, sollte anerkannt
werden durch den eisernen Willen, die von jenen verehrten und
angebeteten Werte zu erhalten.
Während Fugmann sich mit der
Beschreibung der Geschichte der Wolgadeutschen Immigranten
beschäftigte, schrieb Brepohl
über ihre Gewohnheiten und Bräuche.
Verschiedene Aspekte der Kultur der
Wolgadeutschen werden hervorgehoben, unter anderen die
Gewohnheit, die Kirchenglocke nach dem Gottesdienst zu läuten
und nicht, wie in der Liturgie vorgeschrieben; es war das
Zeichen dafür, dass die zu Haus gebliebenen Frauen das
Mittagessen in absehbarer Zeit auf den Tisch bringen mussten;
die absolute Anerkennung der Alten - einer von der Wolga
stammenden Tradition seit der selbständigen Verwaltung, in der
die Wahl eines Altenrates festgelegt war, der die Gemeinde
leitete.
- Dann die Hochzeitsfeierlichkeiten, die drei
Tage dauerten und als eins der wichtigsten Ereignisse galt.
Dabei muss die Braut ein Opfer- Ritual vollziehen, indem das
Verlassen des elterlichen Hauses symbolisiert wird. Die Gäste
helfen am Anfang des gemeinsamen Lebensweges des jungen Paares
durch kleine Gaben. Für Brepohl
bedeutet diese Zeremonie den Hinweis auf das Erhalten der
ethnischen Identität. Diese Immigranten kümmern sich nicht um
die Politik, ihre Gesprächsthemen sind Religion, Schule und
Familie; sie lesen viel, jedoch nur religiöse Schriften, die
sie abonnieren, oder die Lokalnachrichten.[121]
Sie haben nur Verbindung zur Aussenwelt, wenn es
Gerichtsverfahren gibt eine Situation in der sie selbst -
obwohl sie gegen diese Prozesse Widerwillen haben - ihre
eigene Verteidigung durchführen.
Dieses ganz in sich geschlossene Leben,
sich immer wiederholend und dem Zyklus der Natur gehorchend -
nach Brepohl ganz im Sinne des
alten Bauerngeistes - konnte nur durch äussere Einflüsse
bedroht werden. Der Krise, in der Brasilien sich gerade
befand, so meint Brepohl, mussten
sie gegenübertreten aus der Notwendigkeit der Verteidigung
jener produktiven Einheit heraus, die die Grundlage ihrer
kulturellen Identität war.
Dies sind im Grossen und Ganzen die
bevorzugten Themen dieses Gedichtbandes. Nachdem Brepohl zwei Jahre im Lande war,
zeigte sich sein starker Beobachtungsdrang und die sehr genaue
Kenntnis der Gemeinde, der er diente.
Wir würden noch gern einen Aspekt dieses
Buches hervorheben, der auch in anderen Artikeln, die dieser
Einwanderergruppe gewidmet sind, auffällig ist; wir beziehen
uns auf den häufigen Gebrauch des Begriffs "Bauer” als einem
Synonym ihrer sozialen und kulturellen Identität, was fast so
unabänderlich ist wie ihr Deutschtum. In einem anderen Text
über diese Bauern-Organisationen (1923 L) schreibt Brepohl über das Bestehen der
Bauern-Bewegungen seit dem Altertum bis zur heutigen Zeit: er
bestätigt, dass die Form der Produktions-Genossenschaft, deren
bestes Beispiel seiner Meinung nach das mir-System ist, bereits bei den germanistischen
Barbaren bestand, das nur durch die Invasion Napoleons
erschüttert wurde. Und dieses System gelangte durch die ersten
Christen Roms (sic) zu den Germanen, als die Römer auf
germanischen Boden vordrangen. Später eignete sich auch
Russland dieses System an, als es seinen atheistischen
Sozialismus aufzubauen begann. Deshalb zeichneten sich wohl
die deutschen Bauernorganisationen durch den Gemeinschaftsgeist aus
und durch da Sich-nicht-Einmischen in politische
Angelegenheiten. Es handelt sich also um eine Form der
Organisation, die sich nicht jenen Regeln unterwirft, die mit
der Welt des Kapitalismus verknüpft sind, und die sowohl bei
den Wolgadeutschen fortdauern sollten wie auch in anderen landwirtschaftlichen
Genossenschaften des germanischen Europas.
Das Agrar-Kollektiv integriert folglich
das deutsche Ethos; und der Landmann stellt seine reinste und
ursprünglichste Identität dar. Aus diesem Grund unterscheidet
er sich von Kaufleuten und Bürgern, die nur auf gewinn bedacht
sind, und von Angestellten, die schon ihre eigentlichen
Wertbegriffe verloren haben (1923,1930,1932 c). Aus denselben
Gründen kann man die Immigranten auch nicht in die
brasilianische Kultur integrieren, in der noch nie eine
Bauern- Struktur existiert hat (1923 L). Daraus entspringt die
Notwendigkeit des Selbst-Schutzes, der gegenseitigen
Unterstützung und der Verteidigung im Namen der Festigung der
germanischen Gemeinschaft hierzulande.
Vom Volkstum zum
Deutschtum
Bis zu diesem Augenblick haben wir
gesehen, wie der Begriff "Volkstum" von Brepohl
ausgelegt wird und zwar in dem Sinn, ihn neu zu orientieren
vom weltlich-romantischen Universum, in dem er entstand, zum
religiösen Universum; für Brepohl
ist Volkstum die der Weltlichkeit abseitsstehende
Gemeinschaft, die ihre prinzipiellen Referenzen in der
Vergangenheit findet, aus der sie die nötigen Kräfte für das
Überleben entnimmt, trotz zahlreicher Widrigkeiten, denen sie
ausgesetzt war und ist: das Risiko der Verarmung, der
Versuchung der städtisch-industrialisierten Welt, dem Druck
der artfremdem Kultur. Diese Auslegung führt uns zu der
Überlegung, dass diese Gemeinschaft schon geschwächt ist,
weniger durch schwankende Übersetzung als vielmehr durch
permanente Bedrohung durch die Aussenwelt.
In diesem Abschnitt des Kapitels werden
wir versuchen zu zeigen, wie die Bedingungen der Minderheit,
wie Brepohl seine Dargestellten
interpretiert, in diesem Fall keine hauptsächlichen
Begrenzungen mehr sind, sondern zu einer Quelle werden, aus
der die Immigranten ihre Stärke ziehen.
Schon ab 1929, gerade 4 Jahre nach Brepohls Ankunft in Brasilien, beginnt
seine Anwesenheit an Einfluss zu gewinnen, was man aus seinen
eigenen Schriftstücken folgern kann.
Seine Achtung den Bauern gegenüber, zum
Beispiel, beschränkt sich nicht nur auf diejenigen seiner
Kongregation. Als Vertreter ihrer Interessen besucht und
beschreibt er ländliche Gegenden im Staat São Paulo in der
Absicht, festzustellen, ob diese für die Ansiedlung deutscher
Immigranten geeignet seien. Er verfasst eine Schrift, die
sowohl in Deutschland verteilt werden soll, um neue
Auswanderer anzuwerben, als auch im Süden Brasiliens, dessen
Siedler durch Landzerstückelung infolge von
Erbschafts-Aufteilung daran interessiert waren, neue
Ländereien zu erwerben (1929).
Ausser seinen sozialen Hilfeleistungen
für die Bauern wird Brepohl von
der deutschen Gemeinde in Ponta Grossa eingeladen, Vorträge zu
halten über George Knoll,
einem deutschen Poeten, der
in Brasilien gelebt hat. Den Inhalt dieser Vorträge
veröffentlichte Brepohl später in
der Tageszeitung von Westerburg, in Deutschland, worin er sich
den dortigen Lesern als Missions-Mitarbeiter vorstellte. Er
spricht auch im Sitz der Deutsche Föderation der
Kriegsteilnehmer in Ponta Grossa, zum Anlass einer Fahnenweihe
dieses Vereins (1923 f). Und er wagt sich ausserdem noch an
die Arbeit einer Chronik und veröffentlicht zwei Erzählung
über den Kaiser Dom Pedro II. und dessen Besuch bei den
deutschen Immigranten in Paraná. Hierin zeigt sich Brepohls ganze Begeisterung für den
Landwirt, besonders aber auch für die Monarchie einer Epoche,
in der die Einwanderer mit grosser Achtung angesehen wurden.
(1933 a und 1933 b)
Diese Einladungen und Angebote zu
Veröffentlichungen ereignen sich zu einer Zeit, in der nicht
nur Brepohl, sondern auch alle
anderen Pastoren ihren Einfluss auf die deutschen Siedler zu
verstärken suchen; Priens Meinung nach (1984) verbreitet sich
in den dreissiger Jahren der Religionsunterricht an den
Schulen mit Deutsch als Muttersprache stark, eine Eroberung
der Kirche, die die evangelische Konfession als eins der
wichtigsten Elemente verstand, um das Deutschtum im Ausland zu
erhalten und es als ein Untrennbares von der lutherischen
Konfession ansah.
Laut Wilhelm Fugmann
zum Beispiel,
Jedes Volk hat seine typischen
Eigenschaften. der beste Beweis dafür ist Luther, der dem
Christentum einen deutschen Geist aufprägte (...). Seine
Wahrheiten müssen allen unterbreitet werden, aber das kann nur
geschehen, wenn diese sich durchsetzen und ethnische Merkmale
annehmen und dadurch eine eigene ethnische Form erhalten,
verbreitet durch Menschen, die den evangelischen Geist Luthers
richtig auszulegen wissen und gleichzeitig ihre eigene
Volkstümlichkeit hochhalten in dem Sinn, wie eben Luther die
deutsche auffasste.
(FUGMANN. 1926. S. 59)
Diese Auffassung führte zum Ansporn des
religiösen Unterrichts von Kindheit an und wird auch stark in
Brepohls Gedankenwelt verankert
gewesen sein. Aus diesem Grund betreibt er die Einrichtung des
Cäcilien-Heims, einem Internat für deutschstämmige
Siedlerkinder aus Santa Catarina
und Paraná, deren Eltern kein
Geld für eine gute Schulausbildung ihrer Kinder aufbringen
konnten. Um diesem Mangel abzuhelfen förderte er eine
Verwaltungs-Einrichtung, die eine philanthropische
Spendenaktion einer deutschen Prinzessin erreicht, um den Bau
der gewünschten Schule beginnen zu können, was am Anfang der
dreissiger Jahre geschieht (1933 i). Noch erwähnenswerter war
sein in Curitiba abgehaltener Vortrag während des
"Treffens der deutschbrasilianischen Schulen", in dem er sich
die Lehrer aller deutschsprachigen Schulen im Süden Brasiliens
wandte und die hauptsächliche Aufgabe des Lehrers an denselben
hervorhob. Laut Brepohl,
Und doch muss man Lehrern und
Schulvereinen zurufen: Haltet aus, so schwer es auch Fallen
mag. Erhaltet eure Schulen und seid zu jedem persönlichen
Opfer bereit. Ihr habt heilige Pflichten euren Nachkommen
gegenüber. Bedenkt, was diese verlieren, wenn ihnen die Schule
vorenthalten, die Muttersprache verkümmert, das Volkstum''
vernachlässigt wird. (1933e. S. 4)
Diese Texte und Aktivitäten beweisen,
dass Brepohl nicht mehr nur
Pastor der Landgemeinden war, wo seine Pfarrkinder lebten,
sondern jemand, der als "gelehrter" verschiedener Gebiete
bekannt war, und von diesen ist uns - als das dauerhafteste,
jedenfalls bis 1933 - das der Landwirtschaft aufgefallen.
Darin beschränkte er sich nicht nur an soziale und geistige
Hilfe, sondern gab auch wirtschaftliche und technische
Orientierung: er informierte die Bauern über bestehende
rechtsgültige Massnahmen der Landwirte in Brasilien, erzielte
die Gründung landwirtschaftlicher Genossenschaften als eine
Waffe gegen die Wirtschaftskrise, die auch Brasilien (1930 und
1933 n) heimsuchte und verfasste eine Reihe von Schriften mit
Anleitungen über den Getreideanbau, die Bienenzucht,
Kleintierhaltung usw. (1934 e).
Die Menge dieser Texte für Landwirte war
nicht nur der Gegend gewidmet, in der Brepohl
tätig war, oder seinen formellen Bindungen zur Landesregierung
von Paraná; ein anderer Faktor, der es verdient, hervorgehoben
zu werden, war sein pastoraler Einsatz bezüglich der
Selbsthilfe und er selbst erklärte die Herkunft dieser Lehrer:
ihr Gründer war Wiehern, der ab 1849 in Deutschland das
Entstehen von Privatvereinen zur Selbsthilfe anregte, gleich
ob sie philanthropischer oder gemeinnütziger Art waren. Als
Urheber des Begriffs der Inneren Mission verstand er darunter,
dass der Glaube nur aus der Liebe geboren werden könne, und
die Liebe müsse sich unter den Altgläubigen immer wieder
intern erneuern, damit man sie dann von aussen her auch an
jene herantragen könne, die später dem Glauben beiträten. So
wurde den Armen auf einfache Art das Gefühl der Gemütsbewegung
erlassen; dasselbe Gefühl, das Gott allen Menschen gab.
Für Brepohl
war die beste Form, diesen Anordnungen der Inneren Mission für
die Neuzeit zu folgen, jene der Gemeinschaftlichkeit - und
nicht die der Betriebskapitalisten (1932 d). Aus dieser
Einstellung entsprang sein Einsatz, Gemeinschaftsgeist zu
bilden, der zu patriotischer, moralischer, religiöser und
ökonomischer Vervollkommnung des Volkstums führen wurde.
Somit werden die Vereine auch ein
bevorzugter Ort zur Anknüpfung von sozialen, unpolitischen
Verbindungen; hier bestärken sich Freundschaft, Kameradschaft
und Verbrüderung; hier verstärkt man sozialen Zusammenhalt an
einem Zufluchtsort vor Unvorhergesehenem aus der Aussenwelt.
Diese Mentalität des Vereinswesens ist
ein typisches Erbe der deutschen Kultur. Nach Nipperdey (1976,
S.174 usw.) breitet sich dieses seit dem 18. Jahrhundert stark
aus und ermöglicht seinen Mitgliedern eine intensiven Verkehr
miteinander; in den zahlreichen und vielseitigen Vereinen
haben die Menschen die Möglichkeit, sich subjektiv
mitzuteilen, im kleinen Kreis ihr eigenes "Teh" auszudrücken und somit ihre Veranlagungen
und
Talente, ihren
Charakter und die emotionellen Bedürfnisse anerkannt zu wissen
und somit - ihrer Ansicht nach - zum geistigen Fortschritt
beizutragen. In dieser Hinsicht zeigt sich das Vereinswesen
als ein notwendiges Korrektiv gegen die Gefahren des "modernen
Lebens", in dem der Mensch zu einer rein statistischen Zahl
der Masse wird.
Dies alles vor Augen, regte Brepohl eben nicht nur die ökonomische
Seite seiner Pfarrei oder Leserschaft an, sondern auch die
Gründung zahlreicher Vereine, die den Zusammenhalt der
Deutschen im Ausland, unter Berücksichtigung ihrer Fähigkeiten
und der persönlichen Neigungen, gewährleisteten.
Die Beliebtheit, die Brepohl in den für die
deutschbrasilianische Gesellschaft weniger wichtigen und
deshalb von den offiziellen Vertretern des "Alldeutscher
Verbandes" weniger oft besuchten Siedlungen erlangte, dürfte
von einigen Mitgliedern der örtlichen Ämter anerkannt worden
sein, denn deren Tätigkeiten verbaten andere Organisations- und Vereinsformen repräsentativen Charakters,
da in deren Programmen keinerlei politische Forderungen
enthalten waren. Jedoch Hessen diese informellen
Verbindungsmänner der sozialen Kontrolle - noch dazu als
"Randfiguren" - nicht die Interessen der gut situierten
Sozialschicht angreifen, gleich ob sie zur deutschen
Gemeinschaft gehörten oder nicht.
Seyferth (1974) zeigt, dass auf jeden
Fall in Santa Catarina und Paraná, die ökonomische Entwicklung
dieser gesellschaftlichen Untergruppe markante soziale
Unterschiede hervorrief: nach Meinung der Verfasserin dieser
Abhandlung werden von den 30er Jahren an die Erträge der
Kolonisten mit grossem Interesse daran zur Handelsware, so wie
auch landwirtschaftliche Geräte, strassenbautechnisches
Zubehör und Hausbaumaterial mit grosser Intensität in den
sogenannten vendas (Krämerläden) vertrieben werden. Diese
vendas funktionierten wie
Finanzierungsinstitute, indem sie verzinstes Geld zwischen den
Erntezeiten verliehen und die Ersten der Siedler unter
Hypothekarbelastung einlagerten. Diese Transaktion erlaubte
ihnen eine Sondereinnahme, die im Stadtgebiet zum Baum oder
Ausbau von Fabriken, Handelsniederlassungen und
Dienstleistungsbetrieben verwendet werden sollte. Durch die
Verarmung der Kolonisten, aufgrund von Verschuldung und
Landaufteilung wanderten diese in die Städte ab und verdingten
sich als schlecht bezahlte Fabrikarbeiter bei ihren
Landsleuten, den "ethnischen Genossen". Dieser Prozess wurde
indirekt von Brepohl in Frage
gestellt, der ihn vielmehr ansah als eine Vorstufe der
Proletarisierung der Emigranten (1932 c). Seine Ansicht lässt
eine bestimmte Opposition erkennen, und er selbst bezieht sich
darauf. In einigen seiner Texte erwähnt er, dass er wegen
seines Eingreifens in weltliche Dinge (Handelsgeschäfte) schon
viel Kritik erhalten habe, er, der sich einzig und allein mit
Angelegenheiten im Zusammenhang des Glaubens beschäftigen
sollte. Ausserdem war er ja ein Ausländer, der sich in Fragen
der nationalen Politik einmischte, aber es gibt noch eine
weitere Anklage, die in Brepohl
eine scheinbar grössere Empörung hervorrief, nämlich die, dass
er kein richtiger Pastor sei, da er ja in Deutschland keine
Universität besucht habe (1933 g). Brepohl
erwähnt den Namen des Autors dieser Denunziation in seiner
Entgegnung nicht, sondern nur den Titel des von der "Neuen
Deutschen Zeitung" veröffentlichen Artikels: "Pestilenz im
Dunkeln". Man weiss nicht, ob jene Kritik von einem weltlichen
Vertreter gemacht wurde, der unzufrieden mit Brepohls Hilfsaktionen für die Siedler
war, oder von einem Theologen, dem Brepohls
Führungseigenschaften missfielen; gleich, von welcher Seite es
kam, Brepohls Antwort war
unverkennbar: Er fühlte sich stark angegriffen und erklärte,
dass er effektiv "ein unabhängiger Pastor der Landeskirche"
sei und "kein Abgesandter des Kirchenrats von Berlin", und
dass er sich "der Synode von Santa Catarina und
Paraná aus eigener Überzeugung angeschlossen habe, wofür er
lediglich den Jahresbetrag im Wert von 1000 Dollar aus
Deutschland erhalte”. Er gibt zu, dass er keine Universität besucht habe,
weil sein Vater ein armer Bergarbeiter gewesen sei, aber dass
er dennoch mit reinem Gewissen sagen könne, seine Aufgabe,
Gott treu zu sei und dem Volks - und Deutsch-Brasilianertum[122]
zu dienen, mit absoluter Hingabe ausgeführt habe (1933 g).
Zu derselben Zeit unterstellt man Pastor
Brepohl auch, seinen eigenen
Berichten nach, dass er nicht nur bei weltlichen Geschäften
mitwirke, sondern sogar ein eigenes unterhalte, nämlich einen
Buchhandel. Als Antwort auf diese Kommentare verfasst er einen
extrem polemischen Artikel, der mehrmals und in verschiedenen
Tageszeitungen aufgelegt wird, in Auszügen oder vollständig.
Hierin beschränkt er sich nicht nur auf seine persönliche
Verteidigung, sondern erstreckt die auf ihn bezogenen Angriffe
auf alle deutscher Herkunft und denunziert schliesslich seine
wahren Gegner.
In diesem Artikel richtet er sich gegen
eine andere ethnische Gruppe, nämlich die Juden. Mein
Kampf in der deutschbrasilianischen Presse gegen jüdischen
Missbrauch des Auslandsdeutschen Idealismus (1932)
schneidet die Judenfrage
an und die daraus
hervorgehenden Konsequenzen für die deutsche Gemeinschaft in
Brasilien. Brepohl beschreibt
detailliert seine Strategien gegen die von ihnen aufgestellten
Fallen, mit denen sie die Deutschbrasilianer schädigen wollen.
Aber worin bestehen diese Fallen? Der Autor klärt uns auf über
ein Programm eines Leseclubs, der angeblich für die
Verbreitung der deutschen Kultur in Südamerika in den Jahren
1929 und 1930 gegründet wurde. In Wirklichkeit handelt es sich
nach Meinung des Autors jedoch nicht um einen Klub, sondern um
einen von dem polnischen Juden Ivan Rothgiesser
aus Berlin gegründeten Betrieb. Brepohls
Meinung nach wurde das Deutschtum als "milchspendende Kuh"
benutzt für die Finanzinteressen dieses Betriebs; bzw. konnte
der Firmenbesitzer seine Geschäfte nur tätigen, weil während
der Weimarer Republik viele Juristen jüdischer Herkunft waren
und die Deutsche Buchgemeinschaft (DBG) eben aus diesem Grund
siegreich aus diversen, gegen sie geführten Prozesse,
hervorging.
Sie erhielten Schenkungen, um Bücher
aufzulegen, die im Ausland verkauft werden sollten; aber sie
behielten sie sich für ihren eigenen finanziellen Gewinn vor.
Brepohl beschuldigt die Teilhaber
der DBG, sich dem Welt-Judentum angeschlossen zu haben in
einer ganz klaren Haltung zum jüdischen Verschwörungsmythos,
propagiert durch die "Protokolle der Gelehrten Zions".
Die ökonomische Entwicklung dieses
Betriebs schädigte durch ihre charakteristische Beherrschung
der Marktlage andere deutsche Buchhändler. Wenn die DBG sich
aus Propagandazwecken als nichtgewinnbringenden Betrieb
erklärte, so war sie es - juristisch gesehen - nicht, denn
ihre 8000 Teilhaber hatten kein Stimmrecht bei
Beschlussfassungen. Und, schlimmer noch, die führten eine
Propaganda durch, die deutsche Autoren angriff oder gar kriminellerweise Textfälschungen
vornahm, wie zum Beispiel bei Gustav Freitags "Soll und
Haben".24
In Brasilien hatten sie - die DBG - auch
ihre Vertrauensmänner. Der wichtigste von ihnen war Alfred Hodtke, Mitglied des Deutschen
Jugend-Bundes, der für Zeitschriften mit kommunistischer
Tendenz (ihre Namen wurden nicht genannt) Artikel schrieb. Er
muss Kritiken verfasst haben gegen die Denunziationen Brepohls. Darin stellt er beobachtend
fest, dass das Christentum Brepohls
es erlaubt, Juden anzugreifen, sofern es sich um die Ausübung
der Toleranz handelt, verkündet durch die Protestanten. Er
argumentiert ausserdem, dass die wichtigere Aufgabe die
Verbreitung der deutschen Literatur ganz allgemein sei, und
nicht die Überprüfung der ethnischen Herkunft ihrer
Schriftsteller. Ausserdem hänge vom Erfolg desselben der
Unterhalt von vielen hundert Deutschen ab. Nach Hodtke hat die DBG ihre Mitglieder nie
benachteiligt, sondern ihnen im Gegenteil immer Verbilligungen
bei Bucheinkäufen gewährt.
Bezüglich dieses Artikels greift Brepohl zurück auf die bürgerliche
Mentalität, die typisch für Juden und deren Anhänger sei, denn
durch die von der DBG angebotenen Vorteile zeige sich deutlich
die Herkunft ihrer Besitzer. Brepohl
erinnert an einen deutschen Vers, in dem es heisst:
Luther, Gotsched. Goethe, Bismarck fragten
nicht nach fremden Rat 11931. S. 18)
Die Anschuldigung, keine christliche
Einstellung zur Diskriminierung von Juden zu haben, erwidert
er wie folgt: [123]
Wir deutschen können den Juden und
anderen unter uns lebenden Fremdvölkern ruhig das Ihre lassen,
wenn diese bürgerliche Gesinnung uns bleibt. Ich bin kein
Antisemit. Ich lasse dem Juden was des Juden ist. (idem, S.
17)
Ausserdem:
Es handelt sich um viel Höheres als um
den religiösen Gegensatz zwischen Christentum und Judentum, um
ganz etwas anderes als um ein beweisen des Christentums durch
Schimpfen auf die Juden. Es handelt sich um Deutsche Art und
Deutsches Wesen! Die Frage ist keine religiöse, sondern eine
des Volkstums, eine Rassenfrage. (idem. S.- 21-22)
Gegen diese und andere gegen Brepohl gerichtete Beschuldigungen
zitiert er noch die Stellungnahme des Herausgebers der "Neuen
Deutschen Zeitung" zu seinen, Brepohls,
Gunsten. Dieser bestätigt die Legitimation des Anti-Semitismus
und alarmiert die gesetzlichen Autoritäten, in diesem Falle
das Deutsche Konsulat, zulässige Vorkehrungen zu treffen gegen
diese Aktivitäten. Es gibt verschiedene Auslegungen anderer
Journalisten, die versuchten, Artikel gegen die Handlungen der
DBG zu veröffentlichen; diese wurde jedoch durch die
Zeitschrift "Jugend" zensuriert, die androhte, jegliche
Veröffentlichung zu boykottieren, die jenes Unternehmen
kritisieren würde. Diese Vorschrift muss - nach Ansicht des
Herausgebers dieser Schrift - auf den Einfluss der Ideen der
"Roten Rose" zurückzufahren sein.
Schliesslich ruft Brepohl
zur Verachtung der DBG auf und ersucht seine Landsleute im
Süden Brasiliens, keine Bücher der DBG zu kaufen, denn
andererseits würden sie dazu beitragen, dass 500 000 Juden die
60 Millionen Deutschen in aller Welt weiterhin ausbeuten
würden.
Zusammenfassend sind dies die
Kümmernisse, mit denen sich der Text befasst: eine Vielzahl
von Denunziationen und eine Mahnrede gegen eine ethnische
Gruppe, die praktisch im Innern der Südstaaten Brasiliens
nicht existierte. Warum also so viel Aufsehen wegen eines
kleinen Betriebes? Brepohls
Referenzen stammen eindeutig aus Berlin, und nicht aus Curitiba oder direkt aus Rio de Janeiro. Mit Sicherheit
hielt Brepohl es für wichtig,
dieselben den Deutschbrasilianern zu übermitteln, besonders
deshalb, weil Ivan Rothgiesser,
wie auch Rosa Luxemburg seiner Ansicht nach zu einer
Weltverschwörung gehörten, die die deutschbrasilianische
Gemeinde stark in Mitleidenschaft ziehen könnte, indem sie ihr
ihre internationale Strategie aufzwingen würde. Und einesteils
war dies schon geschehen, nicht nur durch den unehrlichen
Verkauft der Bücher, sondern auch durch den Ausbeutungsgeist
des Kapitalismus, der bereits viele, darunter auch einige
deutscher Herkunft, angesteckt hatte.
Aber es ist nicht auszuschliessen, dass
Brepohl auch andere
Gesprächspartner ausser den Deutschbrasilianern darauf
aufmerksam machen wollte. Das musste notwendigerweise von
Berlin ausgehen, wo Anti-Semiten wie er gleicherweise die
wahren Absichten einiger Buchhändler, die ihren Vertrieb im
Ausland hatte, erkannten. Und der Titel des Artikels ist sehr
suggestiv: "Mein Kampf"..., und könnte etwas über die
Identifikation des Autors mit den nationalsozialistischen
Ideen aussagen. Letzen Endes war 1927 in Deutschland Adolf
Hitlers Werk Mein
Kampf, mit seinem
radikalen Anti-Semitismus, veröffentlicht worden und war
möglicherweise schon in Brepohls
Hände gelangt der ja ein eifriger Leser von allen Texten
seiner Heimat war und in deren Tagesblättern er einige Male
seine eigenen Ideen und Meinungen veröffentlichen konnte.
Wenn das die Geopolitik Brepohls war, wird er sich absolut
folgerichtig beunruhigt haben durch die Tatsache, dass der
kapitalistische Geist, der sich bereits in Gewinngier der
Industrien in Santa Catarina
und Paraná abzeichnete; sowie
durch die kommunistische Gefahr, die sich in den Orden des
Deutschen Jugendvereins von Porto Alegre und
die Anhänger der "Roten Rose" eingeschlichen hatte; und diese
kapitalistischen und kommunistischen Ideen verschworen sich
gegen sein Vaterland, und die Deutschstämmigen mussten seiner
Meinung nach also zur Verteidigung bereit sein. Auch wenn im
Süden Brasiliens nicht viele Juden ansässig waren, so genügte
ihr Auftreten in Deutschland selbst doch schon, damit die
Immigranten sich in den Kampf um das Deutschtum einliessen.
Wie der Alldeutsche Verband schon kundgetan hatte, so handelte
es sich eben nicht nur um eine Völkergruppe unter diversen
anderen, sondern um eine vorrangige Rasse.
Die Abschaffung der Grenzen
In einem Tageblatt von
1933[124]
gibt Brepohl bekannt:
Der Liberalismus, die Idee der
französischen Revolution von 1789, die auch Deutschland
erobert hatte, und in ihm 1918 restlos zur Macht gelangt war,
ist tot. An Stelle des dem Liberalismus eigentümlichen
individualistischen Denkens tritt körperschaftliches der
Gemeinschaft, Volk, auffasst, diese jedoch soziale Pflichten
auferlegt. (...)
Die Sozialdemokraten (...) fühlten sich
nicht zum Totengräber des Kapitalismus berufen, sondern
wollten Arzt an seinem Krankenbett sein. (...) Die
Sozialdemokratie ist auch tot.
Hatten unsere Alt vorderen ihre Mark
Genossenschaften, so schuf die nationale Revolution die
Volksgemeinschaft. (...)
Die nationale Revolution (...) grifft
über das Politische hinaus, erfasste - das geistige und
seelische Leben unsere Volksgenossen im Reiche von Grund aus
und ging daran, es völlig neu zu gestalten. (...)
Die nationale Volksgemeinschaft ist
vertiefte Kameradschaft - Gemeinschaft am wohl und wehe des
Volks ganzen * Blutsgemeinschaft. (...)
Sicher ist, dass das Judentum im Reiche
einen weit über seine zahlenmässige Stärke hinaus reichenden
Einfluss besass (...) es stellt ein Hundertstel der
Bevölkerung dar, als so hat es Anspruch auf ein Hundertstel
aller Stellen. (S. 5-8)
Hierdurch weist der Verfasser seine
Leser auf den Sieg der Nationalsozialisten hin. Der
Liberalismus, Marxismus, das Judentum und die Politik, also
die "Aussenwelt", ist verschwunden. All das, was das
Deutschtum bedrohte, verlor seine Relevanz, denn die
Revolution von 33, im Gegensatz zu der von 1918, ist eine
echte. Es handelt sich dabei nur um eine Veränderung der
Staatsform, sondern
Sie begnügt sich nicht mit dem an sich
bedeutungslosen Wechsel einer Staatsform; der Bundesstaat
wurde zum Einheitsstaat. (...) Laut Goebbels, "Diese
Revolution nicht nur nationale sein soll, sie ist eine
nationalsozialistische Revolution - sie ist von uns gemacht
worden.
Für Brepohl
muss derjenige - und das gilt insbesondere für die
Deutsch-Brasilianer der sich zum Nationalsozialismus bekennt,
gewillt sein, seinen Reichtum und Besitz zu teilen. Nur die
Armen interessieren die Revolution!
Dies ist ein Jahr, in dem sich Brepohl intensiv der Redaktionsarbeit
widmet. Er verlegt einige Berichte über Zigeuner - eins seiner
Hauptinteressen [125]
neu, einiges über die Wolgadeutschen, und sogar über ein für
ihn neues Thema, die brasilianische Geschichte, in der er in
der Hauptsache Mauricio Nassau - in Wirklichkeit ein Deutscher
und kein Holländer, Dom Pedro II. - Sohn einer Österreicherin
- und noch über die deutschen Wissenschafter, die zusammen mit
Cabral nach Brasilien kamen, berichtet. Er bringt auch
Reden und Gedichte deutscher Dichter und Schriftsteller
heraus, informiert genau über den wirtschaftlichen Aufstieg
Deutschlands, und berichtet über seine Besuche in
verschiedenen Jugendlagern und Heimen, über Turniere und
Sportveranstaltungen, die Organisation von Frauenvereinen und
über deutschbrasilianische Klub-Treffen. Eigenartigerweise
stehen die Texte der pietistischen Lehre jedoch immer erst an
zweiter Stelle und tauchen dann überhaupt erst wieder am Ende
des Jahrzehnts auf. Und es ist klar, dass in diesen Broschüren
die Ereignisse im Zusammenhang mit Hitlers Aufstieg und dem
Nationalsozialismus am intensivsten beleuchtet werden.
In einem anderen Artikel (1933 f)
erklärt Brepohl, warum die
Deutsch-Brasilianer die eben erwähnten Ereignisse mit Recht
feierlich begehen müssen: für den Autor ist der Sieg des
"Erben von Bismarck" auch etwas, was das deutsche Volk im
Ausland Angeht. Denn ausser, dass Hitler für einen sehr
entscheidenden Schritt in der deutschen Geschichte
verantwortlich war, war er ja - ausserhalb des Reiches geboren
- selbst wie ein "Auslandsdeutscher", der um die Anerkennung
seiner deutschen Staatsangehörigkeit kämpfen musste. Nach
Hitlers Worten, die Brepohl im
Folgenden wiedergibt, heisst es,
Jeder Deutschblütige,
unabhängig davon wo er geboren wurde, ist unanfechtbar als
Reichsdeutscher anzusehen (1933 f, S. 5)
Das bedeutet, dass der Führer anerkennt,
dass die Deutschen aus dem Ausland ihrer Heimat (Deutschland)
gegenüber die gleichen Rechte haben; daher sein Versprechen
der Erweiterung des Lebensraumes. Obwohl er nicht erwähnt, wie
er dieses Projekt durch - führen will, geht daraus doch klar
hervor, dass die hauptsächlichen Nutzniesser davon die
Auslandsdeutschen sei würden.
Im weiteren Verlauf dieser Schrift
zitiert er seiner eigenen Meinung nach, wichtigere Abschnitte
aus der Rede der Machtergreifung des neuen Reichskanzlers:
- Den grosszügigen Ausbau der
Altersversicherung durch Verstaatlichung des Leibrentenwesens.
Jedem bedürftigen Deutschen Volksgenossen wird von einem
bestimmten Lebensalter an oder bei vorzeitigem Eintritt
dauernder Erwerbsfähigkeit eine auskömmliche Rente
sichergestellt;
- Die Beteiligung aller an
schöpferischen und Werteschaffenden Unternehmungen
beschäftigten je nach Leistung und Alter an den Erträgnissen
des Werkes unter gleichzeitiger mit Verantwortlichkeit für die
Erfüllung der volkswirtschaftlichen Aufgaben des Werkes;
- Erziehung aller auf nicht Ehrlicher
Arbeit beruhenden Kriegs- und Revolutionsgewinne, sowie von
Hamster - und Wuchergut und deren Verwendung für den Ausbau
der sozialen Fürsorge;
- Erziehung der Jugend zu körperlich
gesunden und geistig freien Menschen nach den grossen
Überlieferungen des deutschen Geisteslebens;
- Volle Religions- und
Gewissensfreiheit;
- Besonderen Schutz der christlichen
Glaubens Bekenntnisse;
- Unterdrückung
und Fernhaltung von Glaubenslehren, die dem Deutschen Sittlichkeitsgefühl zuwiderlaufen und
deren Inhalt staats- und volkszerstörenden Charakter trägt;
- Freiheit der Lehre auf den deutschen
Hochschulen. Heranbildung einer Führerschicht von
charaktervollen - Männern. (1933f, S. 11-12)
Die von Hitler hervorgehobenen Punkte
zeigen nichts Aufsehenerregendes: das
Grund-Ausbildungsprogramm, oder die Altersversorgung, zum
Beispiel, prägten sich wie abgedroschene Slogans verschiedener Parteien und anderer
europäischer Programme schon seit längerer Zeit ein.
Insbesondere in Deutschland gab es diese Parolen ja seit dem
19. Jahrhundert, als Bismarck unter dem Druck der
Sozialreformen eine Reihe von Wohltätigkeitsaktionen zugunsten
der Arbeiterklasse einführte, um negative Propagandaeffekte
seiner Widersacher zu reduzieren.
Der Konflikt oder die Abschaffung
illegal erworbenen Besitzes lässt in erster Betrachtung eine
Massnahme des Staates vermuten, ist jedoch spezifisch eine der
Polizei, die schon seit ihrer Entstehung die Kontrolle des
oben erwähnten übernahm, was relativ unabhängig von einem
Parteiprogramm war. Bezüglich des Verbots einer
"gegensätzlichen Lehre zur deutschen Moral " und der "Abwehr
negativer Beeinflussung" konnte das scheinbar noch eine
Neuerung in der Demokratie und dem Liberalismus der Weimarer
Republik sein, denn es waren Massnahmen, die ja eine Aufgabe
der Regierung in diversen offiziellen Instanzen darstellten;
wir erinnern daran, dass selbst Brepohl
durch das preussische Erziehungsministerium im Jahr, 1910 dazu
ernannt worden war, Filme und pornographische Literatur zu
zensieren. Gerade der Anti-Semitismus hatte sich schon in den
vergangenen Jahrzehnten in die soziale europäische Vorstellung
eingeschlichen - und in dieser Hinsicht wurden die Massnahmen
der effektiv neuerungswütigen Regierung Hitlers gegen diese
ethnische Gruppe Brepohl erst
später klar.
Diese Wiederholung, die dem Autor aber
wie eine Neuigkeit erscheint, darf nicht als ein Zeichen der
Schwäche der totalitären Bewegung angesehen werden, sondern
ist im Gegenteil eine ihrer Stärken: Letzen Endes waren diese
Reden und Parolen nicht nur sehr allgemein verständlich, sie
konnten auch von irgendjemand vorgetragen werden. In dieser
Zeit findet man eine Vielzahl an Schriften, die auf die
notwendige Hilfe für Arme, Kinder und Arbeitslose hinweisen
und damit an die christliche Moral pochen. Sie dienten
diversen Politikern als Rhetorik und sind bis zu einem
bestimmten Punkt unabhängig von deren parteilicher
Zugehörigkeit.
Adorno bestätigt, dass die Absicht
dieses Mechanismus mit all seiner Eigentümlichkeit weniger die
sei, dass der Führer der Volksmasse der faschistischen
Regierung die Figur des "Supermanns"
darstelle, sondern eher eine
kollektive Projektion des impotenten "Ichs" jedes Einzelnen.
So ist die Popularität grösser, je ähnlicher ein Volksführer
dem einfachen Mann ist. In Anbetracht der von Hitler
ausgeübten Funktionen im Spiel der Verführung des Regimes,
erinnert er an Charlie Chaplin in dem Film "Der grosse
Diktator", in der Ähnlichkeit zwischen dem Führer und dem
Frisör des Ghettos (1985, S. 220/21).
Und eben Brepohl
scheint Vorbild anzustreben. Wenn bislang die Schriftstücke
sich durch die Verschiedenheit ihrer Themen, Erwähnungen der
gelehrten Autoren und einer überzeugenden Rhetorik bzgl. der
bekanntgegebenen Siege Hitlers charakterisierten, so werden
dazu immer wieder dieselben Worte benutzt und zwei oder drei
gleiche Argumente, die zur Lösung der verschiedenartigsten
Probleme dienen, ob sie nun politischer oder persönlicher Art
seien. Zusammenfassend bestätigt er, dass der
Nationalsozialismus das Deutschtum verstärke, das Deutschtum
sei die Nation, die Nation eine einzige grosse Familie, der
Führer der Vater dieser Familie, oder, genauer ausgedrückt,
der älteste Bruder aller Deutschen (1933, S. 10 – 11).
Was sich jedoch auf die religiösen
Aspekte bzgl. bezieht dem deutlichen Rassismus der neuen Lehre
gegenüber, so nimmt seine Ausdrucksweise einen eigenen
Charakter an, denn er beschränkt sich nicht nur auf die
Wiederholung der Worte des Führers, sondern verstärkt diese
indirekt auch noch. Für ihn erhebt sich die germanische Rasse
durch den Aufstieg und die Erfolge Hitlers zur Kategorie der
Auserwählten, mit einem Auftrag, der sich nicht nur auf die
eigene Sippe beschränkt, sondern sich auf alle Völker
ausdehnen müsse.
Und mit dieser Anschauung steht Brepohl nicht alleine da. Man muss
daran erinnern, dass die Rein-Erhaltung der Rasse als ein
Göttliches Gebot eine "Wahrheit" war, die schon seit einiger
Zeit von vielen deutschbrasilianischen Pastoren akzeptiert
wurde. Wenn anfangs das Deutschtum ein Gefühl ausdrückte, dass
mit dem Luthertum wetteiferte, um die Erhaltung der Konfession
zu garantieren, so war es jetzt umgekehrt, nämlich zur
Vergötterung der deutschen Nation.
Wir möchten in diesem Zusammenhang auf
die Worte Hermann, Dohms hinweisen, dem Präsidenten der Synode
von Rio Grande, die er eben zu dieser Zeit aussprach:
Der Sieg Adolf Hitlers hat zur klaren
Erkenntnis gebracht, dass die Staatszugehörigkeit nicht die
Volkszugehörigkeit bestimmt, dass "der Staat wohl die
Voraussetzung ist zur Bildung einer höheren menschlichen
Kultur, aber nicht die Ursache derselben. Diese liegt viel
mehr ausschliesslich im Vorhandensein einer zur Kultur
befähigten Rasse” (...) erst die Umwälzung in Deutschland
rüttelte uns auf und gab uns unser ganzes Volksbewusstsein
wieder, nämlich: dass in der Zugehörigkeit zu dem ruhmreichen
deutschen Volk auch in aller Zukunft unsere Kraft für die
Erfüllung der unserem Volke von Gott mitgegebenen
Kulturaufgaben wurzeln wird. (1934. S.91-92)
Weniger elegant ausgedrückt könnte
dieselbe Überlegung mit Hitlers Worten übersetzt
werden, in einem Text, den Brepohl
als lobenswert befand, als er versuchte, seiner Leserschaft zu
erklären, warum die Juden als Anti-Rasse zu verstehen seien:
Jedes Tier verbindet sich immer nur mit
einem Artgenossen. Die Biene bleibt im Bienenstock, der
Buchfink beim Buchfinken, der Storch usw. Dieser Instinkt ist
in der ganzen Natur zu finden.... und hat zur Konsequenz, dass
eine mächtige Barriere nicht nur zwischen den einzelnen Rassen
und Arten, sondern auch ganz allgemein zur Aussenwelt
aufzubauen ist. wie auch die natürlichen Veranlagungen zu
vereinheitlichen sind. (Hitler, [1927], 1983, S. 185-86)
Oder auch:
Der Germane des amerikanischen
Kontinents kämpfte sich durch bis zur Beherrschung desselben,
um sich rein und unvermischt zu erhalten und das kam nur
fortdauern solange er nicht der Sünde der Blutsvermischung
verfällt (Idem. S. 186)^7
Die Ähnlichkeit dieser Reden mit denen Brepohls bestärken uns in unserer
Hypothese, dass er von einem Tag zum anderen die Grenzen
zwischen Deutschland und Brasilien aufhob. Dieser imaginäre
Raum des Deutschtums, das die territorialen Grenzen
überschreitet, ist unserer Meinung nach eine Folge seiner
eigenen Erfahrungen: Brepohl
befand sich zur Zeit des Kriegsausbruchs in Deutschland, war
Zeuge der psychologischen Wirkung des Versailler Vertrags auf
die Mittelschicht, fühlte sich gleichermassen gedemütigt durch
die wirtschaftliche Situation der Arbeitslosen und Emigranten;
später in Brasilien unterstützte er eine Gemeinde, die aus der
gleichen Sozialschicht stammte, Menschen die "nicht in ihrer
Heimat bleiben konnten, solange so viel fremdes Blut die
gleichen bürgerlichen Rechte genoss" (1933, S. 4) - und er
selbst konnte ja nicht aufsteigen zu weltlichen oder
geistlichen Ämtern durch Machenschaften parteipolitischer
Art. Nach seiner persönlichen Anschauung des historischen
Prozesses übte Brasilien lediglich die Rolle des Wohnsitzes
aus, und er hoffte, nur eines provisorischen.
Zusätzlich lässt sich eine
Identifizierung des Erzählers mit dem Wiedergegebenen
erkennen: In einer seiner Erzählungen, wie in der Auswahl der
Programmpunkte der NSDAP, wählt Brepohl
Episoden aus dem Leben des Führers die scheinbar eine
Projektion seines eigenen Lebens sind.
Obwohl der Autor diesen Abschnitt nicht
ausdrücklich erwähnt, so scheint das Kapitel "Volk und Rasse"
aus dem Buch Mein Kampf doch eins der
beliebtesten von Brepohl zu sein,
denn er versteht darunter, dass diese Thesen sich
protestantischen Diskurs seiner Zeit inspirierten. (Siehe: Brepohl, 1931, 19321, 1933 f, 1933 h.
und Fugmann, 1926)
In der Biografie, die er über Hitler
schreibt (1933 f), stellt er ihn, wie schon erwähnt, als
Auslandsdeutschen vor, jemand der, obwohl "Deutscher”, doch am
Rande der wichtigsten Ereignisse seines Vaterlandes lebt. Der
Führer stammte aus einer armen Familie, seine Grosseltern
waren einfache Bauern, der Vater Arbeiter, seine Mutter eine
schlichte, liebevolle Frau. Der Vater, der durch eigene
Energie einen etwas besser bezahlten Posten als Zollbeamter
errungen hatte, starb früh; drei Jahre danach auch seine Frau.
Das einzige Erbe, das die bescheidenen Eltern (sic) dem Sohn
hinterliessen, war die Liebe zum Vaterland und das Interesse
an deutscher Literatur.
Hitler wurde auch wegen seiner
freiwilligen Kriegsteilnahme gelobt; aber er konnte trotz
seines dort bewiesenen Mutes nicht avancieren. So wurde auch
sein Talent des Autodidakts nicht
anerkannt, denn zu der Zeit waren nur die Formen der
massgebenden Kenntnisse als Kriterien des sozialen Aufstiegs
gefragt. Aber, wenn ein gut ausgebildeter Lehrer von Hitler
durch dessen Redekunst übertroffen wurde, lässt sich fast
voraussehen, was dem folgen würde. Nach den Worten des Autors:
Möchte die Intelligenz turmhoch über den
Beamten oder Offizier stehen, sie war wertlos, wenn nicht
amtlich abgestempelte Schulzeugnisse vorgelegt werden konnten.
Solch ein Mann galt höchstens als belesen, nicht als gebildet.
Heute ist dieser "Halbgebildete Gefreiter" deutscher
Reichskanzler. (1933f. S. 8)
Das Erbe, das die Eltern Hitler - nach
Auslegung des Autors - hinterliessen, nämlich die Liebe zum
Vaterland und das Interesse an Literatur, machte uns
aufmerksam; die Heimat war, seit Brepohls
Kindheit, immer beschrieben als etwas, das man uneingeschränkt
und opferbereit liebte, jedoch auch zärtlich und manchmal
leidenschaftlich, einem Gefühl, das er in seinem Familienleben
nicht kennengelernt hatte. Aber dies war keine
ausschliessliche und einschränkende Erfahrung für den Menschen
Wilhelm Brepohl; sie war eher
das, was Wilhelm Reich versteht als das psychologische
Fundament des nationalen Narzissmus, typisch für den Bürger
des Proletariats, der sich selbst im Chef wiederfinden möchte
und sich stets als Verteidiger des Volkes versucht. (1974, S.
61 u. w.)
Ausser der gleichen sozialen Herkunft
Hitlers und Brepohls empfand sich
auch letzterer als Autodidakt, der den Akademikern der
Landeskirche gegenübertreten musste, wie auch Politikern. Aber
wenn er jetzt als Repräsentant der deutschen politischen
Bewegung in Brasilien anerkannt werden könnte, so hätte er
endlich die Chance, seinen privaten Lebensraum zu erweitern.
Und obwohl der Pastor Brepohl
nicht als Soldat im Krieg war, so hatte er doch als
Mitarbeiter des Roten Kreuzes die Leiden seiner Mitbürger
hinter der Front erlebt. [126]
Aber kommen wir auf den religiösen
Aspekt zurück; wir können folgendes feststellen: Beim
Durchblick der herausgegebenen Veröffentlichungen während der
Aufstiegszeit Hitlers fanden wir nicht ein Schriftstück in
Verbindung mit Überlegung zur pietistischen Lehre, bis dahin
doch Brepohls wichtigste
Thematik. Aber dieses Fehlen ist nur scheinbar, oder - falls
es tatsächlich bestand -, ist erklärbar, denn die von Brepohl verteidigten Glaubenssätze
wurden in ihrer Funktion durch andere Dinge ersetzt, die die
gleiche Wirkung zu haben schienen; und Brepohl
selbst erläutert seine neue Soteriologie.
Das
ganze Deutschtum soll es sein, (1933), so predigt das vereinte deutsche Volk,
eine Einheit, die bisher nur in Träumen erscheinen konnte,
oder in der Erinnerung der Vorfahren, genauer gesagt jener
Vorfahren, die im Jahr 9 n. Chr. die Römer im Teutoburger Wald
besiegt hatten. Eine Gemeinschaft, die in kleinen oder grossen
Vereinen zusammentrifft, jedoch auch individuell, "denn Leib
und Seele sind jetzt durch denselben Wunsch verbunden”.
Im folgenden Abschnitt nimmt Brepohl eines seiner Lieblingsthemen
erneut auf: Das Verderbliche des Kapitalismus, was er
interpretiert als ein Symptom der Macht des Gottes Mammon über
die Erde. Dieser herrschte durch die Männer des
internationalen Handels, durch korrupte Regierende und
Unruhestifter, gegen ihn entsandte der alte Gott, "der keinen
Deutschen bei seinen grossen Aufgaben verlassen würde”,
Hitler, einen Mann echten deutschen Blutes, den von Goethe
erträumten wirklichen Faust, einen Soldaten, der freiwillig
sein Blut im Krieg fürs Vaterland vergoss, Opfer bringen zur
Ehre seines Volkes und dadurch zum langerwarteten Helden
werdend.
Später bringt Brepohl
einen anderen Kommentar; angeregt durch die alten Schriften
erklärt er, dass seit undenklichen Zeiten die Zahl "sieben"
eine heilige Zahl ist, und dass es genau sieben Personen
waren, die die deutsche Freiheitsbewegung [127]
gründeten. Und es war dank der Beharrlichkeit der sieben
Männer, dass sich jene Ideale bis zum 12. November 1933
multiplizierten, dem Tag der Volksabstimmung, die dem neuen
Kanzler die uneingeschränkte Macht übergab: 40.588.800
Personen sagten "ja" zu Hitler, daraus entstand die Einheit,
eine, die ihre Wirkung bereits tat: "Jetzt erkennen selbst die
Franzosen an, dass Deutschland nicht wie ein Handelsobjekt
behandelt werden kann" (S.5). Und er fügt noch hinzu, dass
"niemand mehr daran zweifelt, dass Hitler das Chaos unter
Kontrolle bringen wird. Jetzt ist es an der Zeit zu arbeiten,
arbeiten mit aller erdenklichen Energie, denn das vereinte
Proletariat wird ganz sicher die Macht ausüben" (S. 8*9)
Dies sind einige Überzeugungen, die
einen Pietismus darlegen, der seine Naivität verloren hat. Die
Einheit beschränkt sich nicht auf einen existenziellen
Zustand, der die Freude an der Verbrüderung mit sich bringt,
sondern übt eine objektive Funktion aus - die der
Krafterzeugung, und eben daraus entsteht die Macht. Von da an
wäre die innere Freiheit nicht mehr genug, und man würde nicht
nur den Gehorsam der derzeitlichen
Macht gegenüber erwarten, sondern eine hingebungsvolle und
freiwillige Unterwerfung, eben weil keine zeitbegrenzte Macht
der Welt einer ihr transzendent erscheinenden Autorität
Widerstand leistet. Indem Brepohl
diese Weltanschauung adoptiert, löst er sich der Pietist von
Luther und zeigt eine andere Stellung: den Wunsch nach einem
profanen Kairos, und das Rachegefühl gegen denjenigen, der
seine Denkweise nicht akzeptiert.
Numerologie, Blutsopfer, ein Erretter,
der aus der eigenen Sippe hervortritt, das sind Teile der
jüdischen Mystik, die das Kommen eines anderen Retters
einleiten, welcher die Geschichte zerstören wird und der,
nachdem tausendjährigen Glauben, von nun an über die Welt
herrschen würde;
Deutschland auf. dein
Retter naht. Der Liebe Knecht, der Armut Fels Er führt das
einstige Proletariat
Als erste Brüder der
Welt (...)
Deutschen Volk, in
Hitler naht Der Einheit Kraft; er 1st der Held Der führt zum
Sieg das Proletariat Das deutsche, zur Rettung der Welt.
(1933. S. 10-11)
Allerdings, damit die Theonomie Brepohls auch für den
Deutschbrasilianer gültig würde, wäre es nötig, dass dieses
Volk einen Führer gewählt hätte, um ein Staat zu gründen.
Oder, anderer Weise, könnte der Heilige Herr ein Heer senden,
um eine Regierung aufzuerlegen. Aber Gott blieb schweigend.
Die Ankunft in
Brasilien
Am 9. Januar schrieb Brepohl einen Mitarbeiter des
Propaganda-Amtes einen Brief mit der Bitte um Material zur
Verbreitung deutscher Literatur in Südamerika. Er stellt sich
selbst vor als ein Mann, der bereits seit den zwanziger Jahren
als Nationalsozialist bekannt sei. Als Beweis der
Aufrichtigkeit seiner Worte fügt er dem Brief einen in
Brasilien veröffentlichen Artikel bei, Nationalsozialistische
Revolution
und Volksgemeinschaft. Kurz danach fordert er in Deutschland 50
Exemplare Mein
Kampf an,
ausserdem Bücher der Grimm'schen Märchen sowie welche, die
Revolutions-Darstellungen enthielten, aber auch Zeitschriften
und Kalender zur Unterhaltung der weiblichen Leserschaft.
Als Antwort erhält er ein von Rosenberg
unterzeichnetes Schreiben, indem er ihm für die Verbreitung
des Nazismus im Ausland dankt. Von da an unterhält er
regulären Briefwechsel mit den Regime- Mitarbeitern und
beginnt, in dem von ihm herausgegebenen Tageblatt
"Deutsches Volksblatt für Paraná und Santa Catarina" die Materialen zu veröffentlichen, die er von der
Auslandsorganisation erhält; ausserdem die Reden von Goebbels,
Rosenberg, Hitler und Cossel
(letzterer war der Führer der NSDAP in Brasilien).
Von 1935 bis 1941 werden jedoch die
Veröffentlichungen von Brepohl
immer seltener; die Zwangsmassnahmen des Neuen Staates, die
diese Aktivitäten einschränkten, zogen natürlich auch Brepohls Herausgaben in
Mitleidenschaft. Aus diesen Jahren wissen wir über Brepohl nicht allzu viel, nur, dass
selbst Mitarbeiter des Deutschen Konsulats seine Artikel mit
einiger Reserve beurteilten, denn sie meinten, dass diese die
guten diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Ländern
beeinträchtigen könnten.
Im Jahre 1943, als Brasilien die
diplomatischen Beziehungen zu Deutschland bereits abgebrochen
hatte, schickte Brepohls ältester
Sohn über das internationale Rote Kreuz einige Nahrungsmittel
an seine Schwester, die in Deutschland verheiratet und
ansässig war. Dieser Lebensmittelüberweisung legte er eine
Nachricht bei, dass seine Eltern voll Unruhe auf ein
Lebenszeichen von ihr warteten, da ihr Ehemann ja zur
deutschen Wehrmacht eingezogen sei. Durch diese Nachricht fand
die politische Polizei die Familie Brepohl
und internierte sie am 8.Juni 1943, in der
landwirtschaftlichen Straf-Kolonie von Porto Alegre. Von den vier Familienmitgliedern blieb jedoch nur
der Pastor für längere Zeit inhaftiert; als er später wieder
freikam, wurde er trotzdem bis Ende 1945 überwacht.
Die Gründe, die zur Gefangennahme
führten, sind in der Zeitschrift Vida
Policial von
Porto Alegre veröffentlicht, einer Zeitschrift, die
während der ganzen Kriegszeit eine Kolumne enthielt, betitelt:
"Dem Nazismus müssen die Flügel geschnitten werden". Darin
wurde, etwas sensationslüstern, über "den Kampf der
brasilianischen Regierung gegen den quinta colunismo" berichtet, es enthielt illustriertes
Material mit Fotografien, Karikaturen, Namen und Adressen
"notorischer Nazis" usw. Eins der beliebtesten Angriffsziele,
waren die protestantischen Pastoren; diese Untergruppe wurde
nicht nur wegen ihrer Sympathie zur politischen Bewegung
angegriffen,[128]
sondern besonders weil sie ein extrem wirksames
Instrument der Gegenpropaganda war; wie konnte man auf ein
Volk reagieren, in dem selbst Gläubige, die doch zu
Brüderlichkeit und Nächstenliebe erzogen worden waren, den
Rassismus, den Krieg und die Gewalt akzeptierten?
Der Artikel über Brepohl
ist ein Beispiel dafür. Darin werden unter dem Titel "Der
protestantische Jubilar-Bischof Friedrich Wilhelm Brepohl - ein brillanter Geist,
begraben in der undurchsichtigen Finsternis des Nazismus" die
Gründe beschrieben, aus denen er verhaftet wurde.
Am Anfang wird er Leserschaft das Privatleben Brepohls vorgestellt, wahrscheinlich
anhand seiner Tagebuch-Aufzeichnungen, jedoch interpretiert
nach dem Geschmack des Journalisten. Es werden Episoden aus
seiner Kindheit erzählt, zum Beispiel die Auswirkung des
Alkoholismus seines Vaters auf die Kinder, der frühe Tod der
Mutter, angeblich wegen der Entbehrungen, die der Vater ihr
auferlegte, das Zusammenleben mit den Grosseltern, die Lähmung
seines rechten Armes und Beines, sein Fanatismus für Religion
und die Deutschtum-Ideologie, seine Heirat mit der Tochter
des, Arbeitgebers.[129]
Bezüglich dieses letzten Kommentars ist zu erwägen, ob diese
Wahl wohl psychologischen Problemen entsprang, ("welche nur
durch Freud oder Lombroso erklärt werden können"), denn Brepohls Familie litt an chronischem
Minderwertigkeitskomplex, einer natürlichen Atmosphäre, in der
der Virus des Marxismus sich ansiedeln konnte (S, 81).
Wir finden dort auch bestätigt, dass Brepohl 1924 nach Brasilien kam,
eigentlich nur, um seine etwas irre Vorstellung von
Deutschtum-Ideologie zu verbreiten, das für geistig
unausgeglichene Menschen die falschen Wege ging; in dieser
Situation begann Brepohl seinen
Schriftverkehr mit den Nazis und bot sich spontan zur
Verbreitung der Lehre in Brasilien an. Wir können nachlesen,
dass er in den dreissiger Jahren als offiziell geladener Gast
des III. Reiches empfangen und zum Vertreter der NSDAP in
Brasilien wurde. Trotz dieser wichtigen politischen Stellung
als Intellektueller des Nationalsozialismus wurde ihm
erlassen, offiziell der Partei beizutreten, um bei den
Autoritäten der brasilianischen Südstaaten keinen Verdacht
aufkommen zu lassen. Er integrierte eine Gruppe in seinen
Aufgabenbereich, die, wäre nicht der starke Druck der
brasilianischen Polizei gewesen, sicher ganz Brasilien für
Hitler gewonnen hätte.
Am Ende gibt diese Zeitschrift den
Inhalt diverser Briefe Brepohls
wieder, deren Glaubwürdigkeit uns nicht ganz klar ist; wir
geben sie hier aber derart wieder:
Von Brepohl
an Adolf Hitler:
Exzellenz! Durch eine Gruppe
Klatschsüchtiger verbreitete sich hier unter meinen
Landsleuten die Nachricht, dass Sie wie der
Nationalsozialismus im Allgemeinen, von "Sozial" nur eben den
Anschein habe. (...) Diese Nachricht brachte Unruhe unter die
Deutschstämmigen. Die endlosen besorgten Fragen wurden von mir
in meiner Zeitung beantwortet: (...) Meine Zeitung stand von
Anfang ihres Bestehens an, obwohl sie kein Parteiorgan ist, in
fester Überzeugung immer zu Ihren Diensten (...) (Vida
Policial, Juli
1943)
Von der Reichskanzlei an F.W. Brepohl:
Der Herr Führer lässt Ihnen für Ihr
Schreiben von 27. Juli (...) seinen besten Dank übermitteln.
Er ist sehr zufrieden, feststellen zu können, dass Sie
unermüdlich in Ihren Wochenschriften die Wahrheiten über die
Weltanschauung des Nationalsozialismus bringen. Der Führer
drückt ausserdem seinen Dank darüber aus. dass Sie eine
grössere Anzahl des Werkes Mein Kampf gekauft haben, um die
in Brasilien ansässigen deutschen Arbeitskräfte mit den Ideen
des Nationalsozialismus vertraut zu machen, (idem, S. 1261.
Der Journalist beendet seinen Bericht
mit der Bestätigung, dass der Pastor Brepohl
nicht mehr aus der Haft entlassen würde, da er schon zu alt
sein, sich zu erholen. Letzten Endes könne der Neue Staat
nicht zulassen, dass kranke oder fremdartige Zellen sich in
die Nation einnisteten.
Als Brepohl
doch wieder auf freien Fuss
gesetzt wurde, schrieb er
nichts mehr für die Öffentlichkeit; er notierte Tag für Tag in
seinem Kalender seine Andachtsübungen, die Geburten seiner
Enkel,
Geburtstage seiner Freunde und Verwandten und den
Todestag von bekannten Personen.
ABECK, Helmut. Colaboragäo germanica
no Parana nos Ultimos cinqüenta
anos. (1929-1979). Entre Rios, 1980. 150 p.
ADORNO, Theodor & HORKHEIMER, Max. Dialetica do
esclarecimento.
Rio de Janeiro: Zahar, 1985. 254 p.
ADORNO, Theodor et al.. The
authoritarian personality. New
York: John Wiley & Sons,
1964 2 v.
ADORNO, Theodor. Adorno;
sociologia. São Paulo: Ätica,
1986. 207 p. AIQOBERRY, Pierre. La
question nazie; les interpretations du
national- socialisme; 1922-45. Paris: Seuil,
1979. 316 p.
AMADO, Janaina.
Conßito
social no Brasil:
a revolta dos Mucker. São Paulo; Sünbolo,
1978. 303 p.
ANDERSEN, Benedict. Nagäo e
consciencia nacional. São Paulo: Ätica,
1989. 191 p.
ANDRADE, Mario. Amar,
verbo intransitivo. 10. ed.,
Belo Horizonte: Itatiaia, 1982,
155 p.
ARANHA. Canaä. São Paulo: Ouro,
1954. 282 p.
ARENDT, Hannah. O sistema totalitärio. Lisboa: Dom
Quixote, 1978.
622 p.
____ . Entre
opassado e ofuturo. 2. ed.,
São Paulo: Perspectiva, 1972.
____ . A condigäo Humana. Rio de Janeiro: Forense
Universitearia,
1983. 338 p.
BADE, Klaus. Vom Auswanderungsland zum
Einwanderungsland.
Berlim: Colloquium Verlag, 1983. 133 S.
BANTON, Michael. A ideia de raga. Lisboa: Setenta,
1987. 199 p. BARRETO, Tobias. Estudos allemäes. Rio de Janeiro: Laemmert,
1892. 708 p.
BARRETO, Tobias. Estudos de
ßlosofla. Rio de Janeiro, Instituto
Nacional do Livro,
1966. 4 v.
BAYRISCHE Landeszentralstelle für
politische Bildungsarbeit. Der
Nationalsozialismus; Machtergreifung und Machtsicherung. A-72. München, 1982. 352 S.
____ . Der Nationalsozialismus;
Friedenspropaganda und
Kriegsvorbereitung. A-73. München, 1989. 352 S.
BENJAMIN, Walter. Documentos de
cultura, documentos
de barbärie, São Paulo: Cultrix;
EDUSP, 1986. 201 p.
____ . Obras escolhidas. São Paulo, Brasiliense,
1985. 253 p.
BOLLEME, Genevieve. O povo por
escrito. São Paulo: Martins Fontes, 1988. 243 p.
BONHOEFFER, Dietrich. Reslstencia e
submisSão. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1968. 208
p.
BOSI, Alfredo. Histöria concisa da literatura
brasileira. 2.ed. São Paulo: Cultrix,
s/d. 571 p.
BRACHER, Karl Dietrich. La dictadura
alemana; genesis, estructura y consecuenctas del nacional-socialismo. Madri:
Alianza, 1973 2 v. BRESCIANI, Maria Stella. Liberalismo; ideologia
e controle social: um estudo sobre
São Paulo de 1850 a 1910. São Paulo. 1975. Tese. (Doutorado).
Universidade de São Paulo. 413
p.
BRUNN, Gerhard. Deutschland und
Brasilien; 1889-1914. Köln: Böhlau, 1971. 316 S.
CANDIDO, Antonio. O metodo critico
de Sylvio Romero. São
Paulo: EDUSP, 1988. 144p.
CARNEIRO FILHO, Josö.
Karl
von Koseritz. Porto Alegre: Cademos do Rio Grande, 1959. 55p.
COHN, Norman. Protocolos dos säbios
de Siäo; mlto
ou realidade? São Paulo: Simbolo,
128 p.
DAVATZ, Thomas. Memörias de
um colono no Brasil. São Paulo: Livraria
Martins, 1941. 223 p.
DECCA, Edgar S. de. 1930;
o silencio dos vencidos. São Paulo: Brasiliense,
1981.209 p.
DREHER, Martin. Igreja e
germanidade. Caxias do Sul: Sinodal,
1984. 287 p.
DUMEZIL, Georges. Les Dleux des germatns. Paris: Presses Universitaires de France, 1959. 128 p.
DUMONT, Louis. O indlvidualismo. . Rio
de Janeiro: Rocco, 1985.
278 P-
ELIADE, Mircea. Mitos,
sonhos e misterios. Lisboa: Setenta,
1989. 195 P-
___ . O mito do etemo
retomo. Lisboa, Setenta,
1969. 140 p.
ENCONTRO de Histöria da Igreja. 1980: São Leopoldo.
Anais. São, Leopoldo, 1978. 127 p.
FAYE, Jean Pierre. Langages
totalitäres.
Paris: Hermann, 1973. 769 P-
FEBVRE, Lucien. Martinho
Lutero; umdestino. Lisboa: Bertrand, 1976.
270 p.
FEBVRE, Lucien & MARTIN, Henri Jean. The
coming of
the book;
the impact
of printing,
1450-1800. New Left Books, 1986.
FELICE, Renzo. Explicar o
fascismo. Lisboa: Setenta;
São Paulo: Martins Fontes, 1976.
313 p.
FEST, Joachim. Hitler. Rio
de Janeiro: Nova Fronteira, 1976. 1028 p.
FOUCAULT, Michel. Microfisica do
poder. 2. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1981. 295 p.
FOUQUET, Carlos. O imigrante alemäo. São Paulo:
Institute Hans Staden, São
Leopoldo, Federagäo dos Centros
Culturais 25 de Julho, 1974. 259 p.
FREYRE, G. Casa
grande & senzala. Rio de Janeiro: Jos6 Olympo,
1975. 573 p.
FUCHS, Hans Udo. A assoctagäo das igrejas de Crtstianismo Decidido.
Curitiba: Luz e Vida, 1982. 23 p.
GAY. Peter. A cultura em
Weimar. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978. 143 p.
____ . Freud
para historiadores. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989. 225
P-
GERTZ, Ren6. O fascismo
no sul do Brasil; germanismo, nazismo,
integralismo. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1987. 204 p.
___ . Operigo alemäo. Porto
Alegre: UFRGS. 1991. 87 p.
GHESE, Hans. Die
deutsche
presse in
Brasilien
von 1852
bis
zur Gegenwart. Münster in Westphalen: Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung,
1931. 175 s.
GINZBURG, Carlo. O queijo e os vermes. São Paulo: Companhia das Letras,
1987. 281 p.
GINZBURG, Carlo. Spurensicherungen. München-. Deutscher
Taschenbuch Verlag, 1988. 260 S.
____ • Mitos, emblemas,
slnals; morfologta
e hiostöria. São Paulo,
Companhia das Letras,
1989. 309 p.
GIRARDET, Raoul. Mttos e
mltologias politicos. São
Paulo: Companhia das Letras, 1988. 212 p.
HAARBECK, Hermann et al. Lasse dein Brot über das Wasser Jahren.
Offenbach: Gnadeauer Verlag, 1957. 127 S.
HABERMAS, Jürgen. Habermas;
sociologia. São Paulo: Ätica,
1980.
216 p.
____ . Mudanga estrutural
na esfera publica. Rio de Janeiro: Tempo
Brasileiro, 1984. 343
p.
____ . Teoria de laacciön
comunicattva. Madrid: Taurus, 1987. 2 v.
HERING, M. Luiza R. A tndustrialtzagäo no Vale do Itajai; contributgäo ao estudo
do modelo catarinense
de desenvolvimento. São Paulo,
1985. Tese. (Doutorado).
TJniversidade de São Paulo.
HILTON, Stanley. A guerra secreta
de Hitler no Brasil. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1983. 461 p.
HITLER, Adolf. Minha luta. São Paulo, Moraes:
1983. 426 p. HOBSBAWM, Eric. Mundos do trabalho. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987, 447
p.
____ . A era dos
imperlos; 1875-1914. Rio de Janeiro: Paz e Terra,
1988.546 p.
____ . Nagöes e
nacionalismo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990. 230
p.
HOLLENWEGER, Walter. Elpentecostalismo. Buenos Aires: La Aurora, 1976. 530 p.
HOERDER, Dirk. Why did you come?
The proletarian mass migration.
Bremmen: Universität
Bremmen, 1986. 123 S.
HUNSCHE, Carlos. O bienio de 1824-25
da imigragäo
e colonizagäo no Rio Grande do Sul. 2. ed.
Porto Alegre, 1975. 785 p.
JACOBSEN, Hans-Adolf. Nationalsozialistische
Aussenpolitik;
1933- 1938.
Frankfurt: Alfred Metzner, 1968. 841 S.
KNIESTEDT, F. Memdrias
de um imlgrante anarquista (tradugäo e organizacpäo de Rend Gertz). Porto Alegre: Escola Superior de Teologia e Espirltualidade Fransiscana, 1989. 167 p.
KOCKA, Jürgen. Geschichte
und Aufklärung.
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 1989. 198 S.
KOHN, Hans. Die idee des Nationalismus. Heildelberg, 1950. 318 S. KRUCK, Alfred. Geschichte des Alldeutschen Verbandes;
1890-1939.
Wiesebaden: Franz
Steiner, 1954. 224 S.
KUPITSCH, Karl. Karl Barth ln
Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Hamburg: Rowohlt, 1971. 155 S.
LANDMANN, Robert. Ascona-Monte
Verità. Wien:
Ullstein, 1979. 253
S.
LEBON, Gustave. Pstcologia de las masas. Madrid: Morata, 1920. LEFORT, Claude.
A invengäo democrätica;
os limites
do totalitarismo.
2. ed., São Paulo: Brasiliense,
1987. 2487 p.
LENHARO, Alcir.
Sacralizagäo da
politica. Campinas:
Papirus, 1986.
216 p.
LEXICON zur Parteien Geschichte. Köhln:
Pahl Rugenstein Verlag, 1983.2
Bände
LOVE, Joseph L. O regionalismo gaücho. São Paulo: Perspectiva,
1971.
282 p.
LUEBKE, Frederick C. Germans in Brazil;
a comparative history of
cultural conßict during world war I. Louisiana: Louisiana State University
Press, 1987. 248 p.
LUKÄKS, Georg. El
assalto a la
razon. Barcelona: Grijalbo,
1976. 705 P-
LUIZIETTO, Flavio Venäncio. Os
constituintes emface da
imigragäo. São Paulo,
1975. Dissertagäo. (Mestrado). Universidade
de São Paulo. 184 p.
MANN, Golo. Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts.
Frankfurt: Fischer, 1989. 1064 S.
MARCONDES FILHO, Ciro. Imprensa e
capitalismo. São Paulo: Kairös,
1984. 211 p.
MARSCHALK, Peter. Deutsche
Überseewanderung im 19. Jahrhundert. Stuttgart: Ernst Lettverlag,
1973.
MARSON, Adalberto. A ideologia nacionalista
em Alberto Torres. São
Paulo: Duas Cidades,
1979. 210 p.
MARTINS, Romärlo.
O Parand antigo
e moderno. Coritiba:
Typografia da Livraria Economica,
1900. 67 p.
MARTINS, Wilson. Um
Brasil diferente. 2. ed. São
Paulo: T. A. Queiroz, 1989.470 p.
MIX, York. Die deutschen
Musen-Almanache des 18. Jahrhunderts. München: C.H. Beck, 1987. 281 S.
MOMMSEN, Hans. Arbeiterbewegung und Nationale Frage. Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht, 1979. 429 S.
MONDIN, Batista. As
teologias do
nosso tempo. São
Paulo: Paulinas,7 1978. 226 p.
MOOG, Vianna.
Um
rio imita
o Reno. 3. ed. Porto Alegre: Globo,
1940. 269 p.
MOREIRA, Silvia Levi. A liga nacionalista
de São Paulo. São
Paulo, 1982. Dissertagäo. (Mestrado). Universidade
de São Paulo. 172 p. MUELLER,
Lauro Telmo. Colönia alemä: 160 anos
de Histöria. Porto Alegre: Escola
Superior de Tecnologia Lourengo Brindes,
1984. 127
p.
NADALIN, Sergio Odilon. Clube Concordia. Curitiba, 1972. 32 p. (mimeo)
____ . Une paroisse d'oriogine germanique
au Parana. Paris, 1977.
These. (Doctorat de IHöme.
Cycle), Universite de Paris.
NEVES, B. & GERTZ, Rene. A nova historiografia alemä. Porto Alegre:
UFRGS; Instituto Goethe, 1987. 137 p.
NIPPERDEY, Thomas. Gesellschaft,
Kultur;
Teorie. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht,
1976. 466 S.
____ . Nachdenken über die Deutschen
Geschichte. München: C.H.
Beck, 1986. 234 S.
____ . Religion
im Umbruch.
München: C.H. Beck, 1988 (a), 165 S.
NOVAK, Kurt. Evangelische Kirche und Weimerer
Republik; zum politische Weg des deutschen Protestantismus
zwischen 1918 und 1932. Göttingen: Vandenhoeck &
Ruprecht, 1981. 258 p. OBERACKER Jr.,’ Carlos H. A contribuigäo
teuta ä Jormagäo
da nagäo brasileira. Rio de Janeiro: Presenga,
1968. 579 p.
OFFE, Claus. Problemas estruturais do
estado capitalista. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984.
386 p.
____ . Capitalismo desorganizado. São Paulo: Brasiliense,
1989. 317 p.
OLIVEIRA, Lucia Lippi.
A questäo nacional
na primeira repüblica. São Paulo: Brasiliense,
1989. 207 p.
PAIVA, C6sar. Die deutschsprachigen Schulen in Rio
Grande do Sul und die Nationalisierungspolitik . Hamburg, 1984. Dissertation.
(Doktor). Universität Hamburg. 269 S.
PELASSY, Dominique. Le
signe nazi. Paris: Fayard,
1982. 340 p. PETERS, Karl.
Gesammelte
Schriften. München
u. Berlin: C.H. Beck, 1943.
493 S.
POLIAKOV, Leön. O mito ariano. São
Paulo: Perspectiva,
USP, 1974.
323 p.
PRIEN, Hans J. Evangelische Kirschwerdung
in Brasilien. Gütersloh:
Güterslöher Verlaghaus,
Gerd Mohn, 1989. 640 S.
PROKOP, Dieter. Prokop;
sociologia. São Paulo: Ätica,
1986. 208 p. RAGO, Luzia Margareth. Do
cabare ao lar;
a utopia da
cidade disciplinar. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985. 209
p.
REICH, Wilhelm. Psicologia de
massa do
Jascismo. Porto: Escorpiäo,
1974.194 p.
RICHTER, Klaus. A sociedade
colonizadora hanseätica
de 1897 e a colonizagäo do
interior de Joinville e Blumenau. Florianöpolis:
USCC; Blumenau; FURB, 1986, 88 p.
RIEDEL, Dirce
Cortes. Narrativa:
histöria eßcgäo. Rio de Janeiro: Imago, 1988. 324 p.
ROCHE, Jean. A colonizagäo alemä
e o Rio Grande do
Sul. Porto Alegre: Globo,
1969. 806 p.
RODRIGUES, Josö Honörio. Teoria da
histöria do
Brasil;
tntrodugäo metodolögica. 3. ed.,
São Paulo: Nacional, 1969. 493 p.
ROMERO, Sylvio. Discursos. Porto: Chardon,
1904. 316 p.
___ . O allemanismo
no sul
do Brasil. Rio de Janeiro: Jornal
do
Commercio, 1906. 67 p.
SAUBERZWEIG, Hans von. Er
der Meister Wir die Brüder. 2. Auf.
Denkendorf: Gnadeauer Verlag, 1959. 502 S.
SCHORSKE, Carl. Vienaßn de slecle;
politica e cultura. São Paulo:
Companhia das Letras,
1988. 373 p.
SEITENFUS, G. O Brasil de Getülio
Vargas e a Jormagäo dos blocos;
1930-42. São Paulo: Nacional,
1985. 488 p.
SEYFERTH, Giralda.
A colonizagäo alemä
no
Vale do Itajai-Mtrim. Porto Alegre: Movimento,
1974.102 p.
____ . Nacionalismo e identldade
ötnica. Florianöpolis:
Fundagäo
Catarinense de Cultura, 1982. 223 p.
SIMPÖSIO de Histöria da imigragäo
e colonizagäo alemä no Rio Grande do Sul.
2.:1976: São Leopoldo: Anais. São Leopoldo, 1976. 182 p.
SIMPÖSIO de Histöria
da imigragäo e colonizagäo alemä
no Rio
Grande do Sul. 4.: São Leopoldo: Anais. São Leopoldo,
1980. 133 P-
SNYDER, Louis. Macro-nationalism; a history
oj the pan-movements.
Westport, Connecticut: Grewnwood
Press, 1984. 308 p.
STROBEL, Gustav Hermann. Relatos de
um pioneiro da
lmlgragao/ alemä. Curitiba:
Estante Paranlsta,
1987. 142 p.
STYRON, William. As
conflssöes de
Nat
Turner. Rio de Janeiro: Rocco, 1985.
THIMME, A. Flucht
in
den
Mythos. Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht, 1969. 195 S.
THOMPSON, Edward P. Miseria de
la
teoria. Barcelona: Critica, 1981. 301 p.
VERISSIMO, Erico.
Um lugar ao sol.
In: Obras Completas (vol 1).
Rio de Janeiro: Jose Aguilar, 1966. p. 579-876.
____ . Saga. In: Obras completas (vol II). Rio de Janeiro: Jos6 Aguilar,
1966(a). p. 13-262.
____ . O tempo e o vento. In: Obras completas. (vol III-V)
Rio de Janeiro:
Jos6 Aguilar, 1966(b)
VEYNE, Paul. Como
se escreve a histöria. Lisboa:
Setenta, 1983. 350 P-
VIANNA, Oliveira. Populagöes meridionals no Brasil. Rio
de Janeiro:
• Jose Olympo,
1952.2 v.
____ . Ensaios ineditos. Campinas: EDUNICAMP, 1991. 388 p.
VITA, Luis Washington. Antologia do
pensamento social e politico no
Brasil. São Paulo:
Grijalbo, 1968. 484 p.
VOIGT, Rüdiger. Politik
der Symbole, Symbole der Poltttk. Opladen: Leske & Budrich, 1989. 291
S.
WILLEMS, Emilio. A aculturagäo dos alemäes no Brasil. 2. ed. São
Paulo: Nacional; Brasilia, Institute Nacional do Livro, 1976. 319 p.
AMADO, Janaina.
Contribuigäo ao
estudo da imigragäo
alemä no Rio Grande do Sul. CIENCIA
E CULTURA. São
Paulo, v.29 n.7, p.735- 70. Jul. 1977.
BALHANA, Altiva
P. & NADALIN, Sergio. A imigragäo
e o processo de urbanizagäo de Curitiba, ln: ANAIS
DO
XVII
SIMPÖSIO DE PROFESSORES UNIVERSITÄRIOS DE HISTÖRIA. Belo Horizonte: Associagäo
Nacional de Professores
Universitärios de Histöria, 1973. p. 527-36.
BARIE, Ottavio. Les nationalismes totalitaires. In: L'EUROPE
DU XIX.
ET
DUXX.SIECLE.
Paris: Fischbacher, s/d. p. 155-227.
BASZCO, Bronislau.
Imaginagäo social. In: ENCICLOPEDIA:
ANTROPOS-HOMEM. Lisboa: Einaudi;
Imprensa Nacional
Casa da Moeda, 1985. p. 296-332
BIDEAU, Alain & NADALIN, Sergio Odilon. Etude
de la feconditö d'une communaute övangelique
lutherienne ä Curitiba (Bresil) de 1886 ä
1939. POPULATION, Paris, v.6, p.1035-64. 1988.
BLANCPAIN, Jean Pierre.
Des vis6s pangermanistes au noyautage hitiarien.
REVUE
HISTORIQUE, Paris,
v. 570, p. 433-82., juin 1990.
BREPOHL DE MAGALHÄES, M. D. Velhos e novos
nacionalismos: Heimat, Vaterland,
Gastland. HISTÖRIA:
QUESTÖES E DEBATES,
Curiba, v.10, n. 19-20, p. 77-112, jun-dez. 1989.
BRESCIANI, Maria Stella. S6culo XIX: a elaboragäo de um mito
literärio. HISTÖRIA:
QUESTÖES E DEBATES, Curitiba, v.7, n.13, p. 209-244, dez.
1986.
___ . O cidadäo da repüblica:
liberalismo versus positivismo. Brasil:
1870-1900. In: REMSTADA
USP, 1992 (no prelo).
___ . O Charme da
ciencia e a sedugäo
da objetivifdade. Oliveira
Vianna, cientista
social. In: CONGRESSO
DAS AMERICAS: RAIZES
E
TRAJETÖRIAS. São
Paulo, 1992 (a). (mimeo)
BRETTEL, Caroline. Travel Literature, etnography and etnohistory.
ETNOHISTORY, Durham,
v. 33 n. 2, p.127-38. 1986.
DECCA, Edgar S. de. A ciäncia da produ^äo:
fäbrica despolitizada.
REVISTA
BRASILEIRA
DE HISTÖRIA, São
Paulo, v.3, n.6, p. 47-79, set. 1983.
GERTZ, Renä.
Os operärios alemäes no Rio Grande do Sul (1920-, 1937) ou
Friedrich Kniestedl tambäm foi
um imigrante alemäo. REVISTA
BRASILEIRA de HISTÖRIA, São Paulo, v. 6, n.ll,
p.75- 84, set.
1985.
___ . Um jomal anarquista
em Porto Alegre; der
Freie Arbeiter. Porto
Alegre, VERITAS, v.
35, n. 140, p. 606-617. dez 1990.
GIL, Jose.
Poder. In: ENC1CLOPEDIA:
ESTADO-GUERRA.
Lisboa, Einaudi: Imprensa Nacional
Casa da Moeda, 1989. p. 58-103.
___ . Nagäo. in: ENCICLOPEDIA:
ESTADO-GUERRA.
Lisboa, Einaudi:
Imprensa Nacional
Casa da Moeda, 1989. p. 276-305.
HABERMAS, Jürgen. Do jornalismo literärio
aos meios
de comunicagäo de massa. In: MARCONDES FILHO, Ciro. IMPRENSA
E CAPITALISMO. São
Paulo, Kairös, 1984 (b). p.
139-158.
HALL, Michael. Trabalhadores imigrantes.
In: TRABALHADORES
Campinas, Fundo de Assistencia
ä Cultura, 1989. p. 1-15. HAREVEN, Tamara. Tempo da famllia e tempo histörico. HISTÖRIA:
QUESTÖES
E DEBATES. Curitiba, v.5, n.8, p. 3-26, Jul. 1984. HOBSBAWM, Eric. The revival
of narrative: some comments. PAST
AND PRESENT,
Oxford, n. 86, p. 3-8. 1980.
___ . Sobre o concetto de
raga. Palestra proferida na Universidade
Estadual de
Campinas. Campinas, 06
jun.1988 (a) (mimeo)
___ . Sobre o
concetto de
cldadania. Palestra proferida na Universidade
Estadual de
Campinas. Campinas, 06 jun.
1988 (b). (mimeo) HOERDER, Dirk. Arbeitswanderung und Arbeits-bewusstsein im atlantischer Wirtschaftsraum;
Forschungsansätze und Hypothesen. ARCHIV
FÜR SOZIALGESCHICHTE, Bonn, v.28, n. 391-425, 1988.
HÜTTENBERGER, Peter von.
Nationalsozialistische Polikratie.
Göttingen, GESCHICHTE
UND GESELLSCHAFTt. n. 2, p. 417-442, 1976.
IANNI, Otavio.
Escravidäo e histöria.
DEBATE
&
CRITICA, São
Paulo, n. 6, p. 131-144, 1975.
KOCKA, Jürgen. Zurück zur Erzählung?
Göttingen. GESCHICHTE
UND GESELLSCHAFT,
v. 10 n. 84. p. 395-408, 1984.
KOTHE, Mercedes Gassen. Os alemäes no Brasil: preserva?äo da lingua, dos
usos e costumes. MIGRAC10NES. Münster, v. 2, n.l,
p. 2-17. feb.1991.
KUDER. Manfred. Die
Deutschbrasilianische Literatur und das Bodenständigkeitgefühl
der deutschen Volksgruppe in Brasilien. IBEROAMERIKANISCHES
ARCHIV, Berlin, n.
10, p. 395-494, Jan. 1937.
LAURA, Keith &
GANDOLFO, Romulo. Carlo Ginzburg:
an interview.
RADICAL
HISTORY, n. 35, p. 89-111, 1984.
LEGOFF, Jacques. Calendärio.
ln: ENCICLOPEDIA:
MEMORIA-
HISTÖRIA. Lisboa,
EinaudiJmprensa Nacional Casa da Moeda,
1984. p. 260-291.
. Escatologia.
in: ENCICLOPEDIA:
MEMÖRIA-HIST'ORIA.
Lisboa, Einaudi: Imprensa Nacional
Casa da Moeda, 1984. p. 425-457.
MAACK, Reinhard. The germans of South Brazil. THE
QUARTELY JOURNAL OF
THE INTER-AMERICAN RELATIONS, n. 1, p.
8-28, 1939.
MAI, Gunther.
Warum steht der Deutscher
Arbeiter zu Hitler? GESCHICHTE
UND GESELLSCHAFT,
Göttingen, n. 12, p. 212-33, 1986.
MEDICK, Hans. Missionare in Ruderboot?
Erkenntnisweisen als Herausforderung an die Sozialgeschichte.
GESCHICHTE
UND GESELLSCHAFT,
Göttingen, n.10, p. 303-309, 1984.
MEIER, Christian. Sobre
o conceito de identidade nacional.
HISTÖRIA:
QUESTÖES E DEBATES. Curitiba, v.lO, n. 18-19, p. 329-347. jun-
dez 1989.
NIPPERDEY, Thomas. Religion und
Gesellschaft. München, HISTORISCHE
ZEITSCHRIFT, n.
246, p. 529-792. 1988(b)
PAES, JosC
Paulo. As idCias fllosöflcas em
Canaä. REVISTA
DA USP. São
Paulo, n. 3, p.169-175,1989.
POLLACK, Michael. Memöria, esquecimento, silgncio.
ESTUDOS
HISTÖRICOS. Rio de
Janeiro, v. 2 , n.3, p. 3-15, 1989.
RAISON, Jean Pierre. Migragäo. In: ENCICLOPEDIA:
REGIÄO. Lisboa, Einaudi: Imprensa
Nacional Casa da Moeda, 1986. p.488-517.
ROTERMUND, Guilherme. O pastor Wilhelm Rotermund. In: Anals do
Encontro de
Historia'da Igreja. 1978. p. 27-45.
SEYFERTH, Giralda.
A antropologla e a teoria do branqueamento
da raga no
Brasil; a tese de Joäo Batista de Lacerda. REVISTA
DO MUSEU
PAULISTA , São
Paulo, v. 30 n. 5, p.
81-98,1985.
___ . Imigragäo e colonizagäo alemä no Brasil: uma
reviSão d$
bibllografia. BOLETIM INFORMATIVO E BIBLIOGRÄFICO DE CIENCIAS SOCIAIS, Rio de Janeiro, n.25, p. 3-55. 1988.
___ . A liga pangermänica e o
perigo alemnao.no brasil; anälise de
dois discursos
etnicos irredutiveis.
HISTÖRIA:
QUESTÖES E
DEBATES. Curitiba,
v. 10, n.18-19, p.l 13-155. jun-dez, 1989.
STOLCKE, Verena &
HALL, Michael. A introdugao do trabalho livre
nas fazendas
de cafe em São Paulo.
REVISTA
BRASILEIRA DE
HISTÖRIA. São Paulo, v. 3 n. 6, p.80-120. set. 1983.
STONE, Lawrence. The revival of
the narrative; reflection on a new
old history.
PAST
AND PRESENT ,
Oxford, n. 85, p. 3-24, 1979.
TENFELDE, Klaus. Schwirigkeiten mit dem Alltag. GESCHICHTE
UND GESELLSCHAFT.
Göttingen, n. 10 p. 376-394. 1984.
___ .Wirtschaft und Bevölkerung. Innsbruck, 1988. (mimeo)
WEHLER, H. Ulrich. Bismarck’s imperialism
1862-1890. PAST
AND PRESENT,
Oxford, n. 48, p.119-155. aug.
1970.
WEIMER, Günter. As proflssöes dos imigrantes alemäes do seculo XIX. in: ANAIS
DO II SIMPÖSIO
DE HISTÖRIA DA IMIGRAQÄO E COLONIZAQÄO ALEMÄ NO RIO GRANDE
DO SUL. São
Leopoldo, set.
1976, p. 307-319.
___ . A imigragäo alemä
vista por algumas teorias racistas
brasileiras.
IV SIMPÖSIO DE HISTÖRIA DA IMIGRAQÄO E
COLONIZAQÄO ALEMÄ NO RIO GRANDE DO SUL. São Leopoldo, set. 1980, p. 69- 83.
APlateia. São Paulo, 1917.
/
AULICH, Werner. Parana
und die Deutschen.
Curitiba: 1953. 216 p. BOTACINI, R. Nazistas na
America. São Paulo: Athos, 1964. 93 p.
BRANDENBURGER, Clemens von. Dr. Wilhelm Rottermund.
Kalender
Jür die Deutschen inBrasilien, Porto Alegre:1923. S.17-35 BREPOHL,
Friedrich Wilhelm.
Die Wahrheit über Jesus von Nazareth. Wiesebaden: Gerdes & Model, 1911.
Auf
das Sie alle Eins seien. Wiesebaden: Das Havelland, 1913. Persönlichkeit,
Heldensinn
und Gebetsleben.
Stuttgart: Lämmle & Müllerschön, 1916. 27 S.
Briefe
unserer gefangenen.
Bad Nassau, Lahn: 1916 (a). 55 S.
Wie
gewinnt man das Volk für gute Literatur? Neuhof: Zentralstelle zur Verbreitung
guter deutschen Literatur, 1917. 25 S. Bauerkolonten in
Südrussland. Bad
Nassau: Zentralstelle zur Verbreitung guter deutschen
Literatur, 1917 (a). 43 S.
Opfer
des Bolchevismus. Neuhof: Zentralstelle zur Verbreitung
guter deutschen Literatur, 1921. 12 S.
Der
Drahtzawn. Neuhof: Zentralstelle zur Verbreitung
guter deutschen Literatur, 1921 (a). 14 S.
Heimatpflege
und
Religion. Neuhof:
Zentralstelle zur Verbreitung guter deutschen Literatur,
1922.24 S.
Wirtschaftliche
Selbsthilfe
und den Weg dazu.
Neuhof: Zentralstelle zur Verbreitung guter deutschen
Literatur, 1923.
Den
Armen wird das Evangelium verkündert. Neuhof: Zentralstelle zur Verbreitung
guter deutschen Literatur, 1923 (a).
Deutsche
Kulturpflege im In- und Auslande in den letzten 15 Jahren. Post Neuhof: Zentralstelle zur
Verbreitung guter deutschen Literatur, 1925. 43 S.
Die Nach Nationalitäten trennte Kolonisation des
Dr. Labieno da Costa Machado im Urwaldgeblel ln der Alto-sorocabana
- Zone im brasilianischen Staat São Paulo. São Paulo: Empreza
de Terras e Colonisagäo,
1929. 30 s.
BREPOHL, Friedrich Wilhelm.
Prof. Dr. Heinrich Sohnren, der Vater der deutschen Heimatpßege; ein Festgruss. 1929(a)
Die Selbsthilfe des kolonisierenden
Bauerntums in Brasilien. Brusque: Mercürio, 1930.
So
seißeissig und ln Busse. Ponta Grossa: Verlag d. Deutschen,
Vereinigung für Evangelisation und Volksmission, 1930 (a). 16
S. Mein
Kampf in der deutschbrasilianlschen
Presse gegen jüdischen Misbrauch
des Auslanddeutschen Idealismus im Jahre 1931. Ponta Grossa: Verlag der Deutschen
Vereinigung für Evangelisation und Volksmission, 1931. 38 S.
Georg Knoll; ein Nassaullches Dichterleben in Jemen
Brasilien. Westerburg: Kaesberger,
1932 (a). 24 S.
Flüchtlinge
in Brasilien.
Ponta Grossa: Hilfskomitee z. Ansiedlung russlanddeutscher
Flüchtilinge in Brasilien, 1932
(b). 20 S. Genossenschaft
oder
Handelsgesellschaft? Ponta Grossa: Flugblätter
deutsch-brasilianischen Genossenschaftswesen, 1932 (c).4S.
Christentum
und wirtschaftliche Selbsthilfe. Ponta Grossa: Verlag der Deutschen Vereinigung
für Evangelisation und Volksmission, 1932 (d)
(Hrsg). Die
Deutschen Invaliden Versicherung. Ponta Grossa: Verlag der Deutschen
Vereinigung für Evangelisation und Volksmission, 1932 (e)
Treue,
Tapferskett, Kameradschaft. Ponta Grossa: Verlag der Deutschen
Vereinigung für Evangelisation und Volksmission, 1932 (f). 4S.
Bei
den brasilianischer Zigeunern. Ponta Grossa: neue Heimat, 1932 (g). S. 82-91
Die
Deutschen in Übersee. Ponta Grossa, Raschei, Raicosk & Cia,
1932 (h).
Missbrauch klingender Bezeichnungen. Santa.Cruz,
1932 (i). S. 10- 12.
Das
ganze Deutschtum soll es sein. Ponta Grossa: Verlag der Deutschen Vereinigung
für Evangelisation und
Volksmlssion in Brasilien, 1933. 30 S.
BREPOHL, Friedrich
Wilhelm.
Kaiser Dom Pedro II im Verkehr mit Einwanderen;
eine wahre Begebenheit aus der Zeit der Wolga Deutschen
Einwanderung. Ponta Grossa: Raschei,
Raicosk & Cia, 1933 (a)
Dom Pedro II und sein deutscher Page. Ponta
Grossa: Raschei,, Raicosk & Cia,
1933 (b)
Die Einwanderung der Wolgadeutscher Katholiken in
Brasilien. Ponta Grossa: Raschei,
Raicosk & Cia, 1933 (c) 29 S.
Die
Deutsche Lehrer und seine Aufgaben als Volkstum und Heimatpßeger. Ponta Grossa: Verlag der Deutschen
Vereinigung für Evangelisation und Volksmission in Brasilien,
1933 (d). Heimatpßege
und Lehrschaft. Curitiba:
Volkstum und Heimatpflege,
1933 (e). 25 S.
Reichskanzler Adolf Hitler und das
Ausland-Deutschtum. Ponta Grossa: Raschei,
Raicosk & Cia, 1933 (f) 22 S.
Scheinen
oder Wirken? Ponta
Grossa: Verlag der Deutschen Vereinigung für Evangelisation
und Volksmission in Brasilien, 1933 (g). 8 S.
(Hrsg). Glaube
und Volksgemeinschaft. Ponta Grossa, Verlag der Deutschen Vereinigung
für Evangelisation und Volksmission in Brasilien, 1933(h). 7 S.
CeciUen-Heim
für deutschsprechende Schüler und Schülerin aus Parana und Santa Catarina. Ponta
Grossa: Verlag der Deutschen Vereinigung für Evangelisation
und Volksmission in Brasilien, 1933(1).
Pfingstgnade:
Schriftgemässe
Zeugnisse. Ponta
Grossa: Verlag der Deutschen Vereinigung für Evangelisation
und Volksmission in Brasilien, 1933 Q). 31 S.
Landwirtschaftliche Organisation; ihre Gegner und
ihr drohende Gefahren. Brusque: Mercürio, 1933 (1)
(Hrsg).Wir
rufen dich. Ponta
Grossa: Verlag der Deutschen Vereinigung für Evangelisation
und Volksmission in Brasilien, 1933 (m).
Richtlinien zur Anwendung des
brasilianischen Gesetzes zum Schutze der Landwirtschaft. Ponta Grossa: Bund Deutschsprechender
Landwirte in Brasilien, 1933 (n).
BREPOHL, Friedrich
Wilhelm.
Nationalsozialistische
Revolution
und
Volksgemeinschaft.
Ponta Grossa, Vereinigung zur Evangelisation und Volksmission, 1933 (o). 16 S.
(Hrsg). Bismarck
und
wir. Ponta Grossa: Vereinigung zur, Evangelisation und Volksmission, 1934. 32 s.
(Hrsg).
Kulturanweisung
für
Brau- und Malzgerste. Ponta Grossa: Bund deutschsprechender Landwirte
ln Brasilien. 1934 (a). 8 S. (Hrsg). Die
Bienenweide ln Paranä. Ponta Grossa: Bund deutschsprechender Landwirte
in Brasilien, s/d. 6 S.
Der deutsche Anteil an Cabrals Entdeckung
Brasiliens nach dem neusten Urkundenfund in Lissabon. Leipzig: Post Neu-Würtemberg, 1937. 4 S.
Mauricio von Nassau. Kalender
für die Deutschen in Brasilien. Porto Alegre,
1937 (a). S.22-25.
Jugentag in
neu-Würtemberg. Neu-Würtemberg,
Leipzig: Kittier i. Kamm, 1937(b)
Was ist Volkstum? Was ist Volksgemeinschaft? Neue
Deutsche Zeitung,
Porto Alegre, 1938.
Der König der Zigeuner. Kalender
für die Deutschen in Brasilien, Porto Alegre, S.
47-57. 1938 (a)
Dom Pedros Hühner. Kalender
der Serra Post. Ijuhy, 1939. S. 77- 86.
Wahrheit in Liebe. Volk
und Heimat, São
Paulo, Deutsche Morgen, 1941. S. 13.
CONFISSÃO
de Augsburgo. ConfisSão
de fö apresentada
ao Invictissimo
Imperador Carlos V, Cösar Augusto, na Dieta de Augsburgo,
no ano de 1530. São Leopoldo, Sinodal,
1980.123 p. CENTENARIO
da Colonlsagäo allemä. Rio Negro,
Mafra - 1829-1929. Obra
commemorativa ao Is Centenärlo da Colonnisagäo allemä. Curitiba, Oliveiro, 1929. 112 p.
DARCANCHY, P. O pangermanismo no sul
do
Brasil. Rio de Janeiro, s/e, 1915.
DEUTSCHE
Zeitung. Porto Alegre, 1901, 1906, 1914.
DEUTSCHE
Post. Porto Alegre, 1886, 19154.
DER
Kompass. Curitiba, 1913-1915
DIARJOdaTarde. Curitiba, 1914, 1916, 1917, 1941, 1942,
1943. DOHMS, Hermann. Das neue Deutschland
und wir. Deutsche
Ev. Blätter
für Brasilien, Porto Alegre,Heft 6, Juni, 1933. s.91-99.
____ . Zum 25. July,
in: Kalender für
die Deutschen ln
Brasilien. Porto
Alegre, 1932.
s. 18-21.
____ . Sind völkische
Minderheiten in Südamerika möglich? Kalender,
für
die Deutschen in Brasilien, Porto Alegre,
1922. s.32-4 FUGMANN,
Wilhelm. Glaube und Volkstum. Ev.
Luth. Gemeindeblatt, 20, S. 58-60, 1926.
____ . Das
Deutsche Jahrhundertbuch. Curityba: Oliveiro, 1929. 324 s.
FUGMANN, Wilhelm & BREPOHL,
Friedrich Wilhelm. Die Wolgadeutschen im brasilianischen Staate Parana. Festschrift zum
Fünfzig-Jahr-Jubiläum ihrer Einwanderung. Stuttgart: 1927. 152 S. HANDWERKER-Unterstützung-Verein; Gedenk und Festschrift zum 50. Järigen Stfung
am 19. Juli 1934.
KAHLE, Maria. Siedler
in Itajahy. Reutlingen: 1934. 168 S.
KALENDER
für die Deutschen in Brasilien. Druck und Verlag Rotermund, Porto Alegre: 1906-1941.
KOSERITZ’ deutscher Volkskalender für die Provinz
Rio Grande do Sul. Porto Alegre: 1874-1877, 1906-1908, 1924,1926, 1936.
KOSERITZ, Karl von. Imagens do
Brasil. Belo Horizonte, Itatiaia:
São Paulo. EDUSP.1980. 305 p.
KOSERITZ, Karl von. Resumo da economta
nacional aplicado
äs clrcunstäncias atuais do pais. Porto Alegre: Typografla do Commercio. 1870.
KRAWIELITZKI, Martin. Im
Sonnenland Brasilien. Marburg: Spener,
1938. 96 S.
LAHRER hinkenden Boten für den Bürger und
Landmann. Lahr in Breisgau: Moritz Schauenburg,
1936.
MARTINS, Märio. Hitler
guerreia o Brasil hä dez anos. Curitiba:
Separata do jomal
O Dia, s/d. 204 p.
O COMBATE. São Paulo. 1917.
O COMMERCIO do
Parana. Curitiba, 1917.
OBERACKER, Karl Heinrich. Die völkische Lage des Deutschtums in
Rio Grande do Sul. Jena: 1936. 203 S.
OS
ALLEMÄES nos
estados do
Parana e
de Santa Catarina. Curitiba: Boletim Comemorativo do iQ Centenärio
de sua entrada no sul
do Brasil; 1829-1929. 180 p,
PY, Aur^lio da
Silva. A quinta coluna no Brasil. Porto Alegre: Globo,
s/d, 407 p.
RATTON. Antonio Carlos M. O punhal nazista
no coragäo do
Brasil
Editora do
autor. 1943. 168 p.
SOMMER, F. Beiträge zur Siedlungs-sippen und
Familien Geschichte der Deutschen in Brasilien. Volk
und Heimat,
Deutsche Morgen Verlags, São Paulo, 1936. S. 41-83.
V7DA Policial Semanärio da Policia Estadual do Rio Grande
do Sul. 1942-1943.
VOLK
und Heimat. São
Paulo, Deutsche Morgen, 1932-35.
ANUARIO
da Organizagäo para o Exterior do
NSDAP. -1938, 1939, 1941. Arquivo de Histöria
Contemporänea, Munique.
BOLETIM Informativo
Auslanddeutschen Wochenspiegel da Organizagäo
para o Exterior do NSDAP. -1932-1942. Arquivo
de Histöria Contemporänea, Munique.
BREPOHL, Teöfilo.
Entrevista concedida
a Mariontide Dias Brepohl de Magalhäes, Ponta Grossa, 1989.
CORRESPONDENC1A Secreta
da Organizagäo para o Exterior do NSDAP. - 1934-1939. Arquivo
de Histöria Contemporänea, Munique.
CORRESPONDENCES da Liga Pangermänica
para a America do Sul - Segäo Hamburgo.
Hamburgo, Arquivo
Püblico de Hamburgo.
KÖTTER, Maria. Entrevista concedida
a Marionilde Dias Brepohl de Magalhäes, Curitiba, 1989
KÖTTER, Friedrich. Entrevista concedida
a Marionilde Dias Brepohl de Magalhäes,
Curitiba, 1989.
LISTA de passageiros
dos navios contratados
pela Sociedade
Colonizadora de Hamburgo para
transportar imigrantes
ä Colönta dona
Francisca. 1852-1862. Joinville, Arquivo Histörico
de Joinville.
RELATÖRIO da Liga pela
Germanidade no Exterior - Se?äo Hamburgo.
- 1925-1929. Arquivo Histörico
de Hamburgo.
Tagung - Memörias
de Friedrich Wilhelm Brepohl; da
infäncia aos
14 anos; por
Friedrich Wilhelm Brepohl. Ponta
Grossa, cole9äo particular.
[1] Die Anzahl der Menschen, die aus
Deutschland weggegangen sind, stimmt nicht mit der
verschiedenen Empfangsländer überein, da die Eintragungen
unvollständig sind, in den Vereinigten Staaten, z. B., ist
lang den Jahrzehnten von 1870 bis 1900 die Zahl der
registrierten Einwanderer höher als die der Auswanderer. Das
kommt daher, dass in den Vereinigten Staaten die Immigranten
nach ihrer Sprache und nicht nach ihrer Nationalidentität
eingetragen wurden, was eine Schätzung ergab, die Deutsche.
Schweizer. Österreicher und andere nicht unterschied. Ausser
dieser Verzerrung muss man hier noch hervorheben, dass eine
kleine Anzahl von Menschen nach Asien und Südafrika
ausgewandert ist und in die in diesen Statistiken deshalb
nicht erwähnt wurde.
[2] Ausser im Süden Brasiliens gab es
noch in anderen Regionen kleine, einzelne Ansiedlungen wie
z. B. Santa Izabel und Santa Leopoldina in Espírito Santo,
die jeweilig 1847 und 1857 gegründet wurden; Nova Friburgo
(1819) und Petrópolis (1845) in Rio de Janeiro; Teófilo
Otoni (1847) und Juiz de Fora (1852) in Minas Gerais und São Jorge dos Ilh6us (1818) in Bahia. Von
diesen Siedlungen sind die in Espírito Santo die einzigen,
die bis heute das Deutschtum erhalten haben.
[3] Thomas Davatz war ein Schweizer
Immigrant, der 1857 einen Aufstand anführte gegen die
Behandlung, die die Immigranten von ihren Arbeitgebern auf
der Farm von Ibicaba in der Provinz von São Paulo erhielten.
Man muss in Betracht ziehen, dass die paulistaner
Provinzregierung das Kommen der europäischen Immigranten
stimulierte, um die Arbeitskräfte auf den
Kaffeepflanzungen zu vermehren, was nicht im Süden Brasiliens der Fall
war. Dieser Unterschied brachte es dazu, dass 1896 das
Dekret von Heydt in den drei südlichen Staaten Brasiliens
als nichtig erklärt wurde. (DAVATZ, 1941 11858] und KOTHE,
1991, s. 4 u. w.)
[4] "Einwandererlieder,
von Elsenthal, apud FOUQUET, 1974, S. 68. In freier
Übersetzung: "Hier können wir nicht bleiben/ hier können wir
nicht leben/ Denn die Hussiers und die Steuereintreiber/
Nehmen uns den grössten Teil.
[5] idem,
S. 68. In freier Übersetzung: "Wir werden jetzt aufbrechen/
Nach dem schönen Land Amerika/ Jeder packe sein Bündel/ Nur
die Schulden lassen wir hier",
[6] Aus die
Wolgadeutschen, apud DREHER, 1984, S. 35. In freier
Übersetzung: Auf Wiedersehen, undankbare Heimat/ Wir gehen
nach Brasilien/ Wir brechen mit Frau und Kinder auf/ Wir
wandern in das versprochene Land aus/ Dort gibt es Gold wie
Sand/ Bald bald werden wir in Brasilien sein.
[7] Wir
beziehen uns hier auf Autoren wie Fouquet (1974). Carlos
Hunsche (1975). und Oberacker Jr. (1968). die die Memoiren
dieser Immigranten als Mitglieder der deutschen Nation, die
sie immer waren, wieder aufzeichnen.
[8] apud
FOUQUET, 1974, S. 85. In freier Übersetzung: Bleiben, gehen,
gehen, bleiben/ Bleibt sich für einen tüchtige Man gleich/
Wo wir etwas nützliches herstellen/ Ist für uns der beste
Platz.
[9] Arquivo
Histórico de Joinville. Passagierliste der angeheuerten
Schiffe durch die Hanseatische Kolonisationsgesellschaft von
Hamburg zur Beförderung der Immigranten zur Siedlung "Dona
Francisca". Herausgegriffene Jahre für die Erklärung: 1852,
1853, 1854, 1860, 1861, 1862.
[10] Ausser
auf Autoren, die aus diesen Schichten stammten, und die sich
der Kolonisierung und ihrem wirtschaftlichen und kulturellen
Erfolg widmeten, beziehen wir uns auch auf Autoren der
akademischen Historiographie, wie Roche (1969). BALHANA,
(1963) und MARTINS. (1951). Von den Autoren, die diese
Schichten aus denselben Gründen die die anderen dazu
brachten sie zu loben, verurteilten, d. h., weil sie
Deutsche waren, sind Folgende zu erwähnen: ROMERO. 1906, DARCANCHY, 1914. VIANNA. 1991(1931)
[11] Hierbei sind nicht die ethnisch
gemischten Siedlungen aufgeführt, wie z.B. die von
Italienern und Deutschen, was erst das Resultat einer
späteren Politik war. in der man die Konzentrierung einer
einzigen ethnischen Gruppe in einer bestimmten Gegend
vermelden wollte.
[12] Dies ist nicht der offizielle Name
dieser Siedlung, sondern der ihr von den Einwanderern
gegeben.
[14] Handwerker-Unterstützungsverein, S.
6.
[15] Betreffs der Anerkennung dieser
Evolution sind wir nicht gleicher Meinung mit Balhana (1973)
und Hering (1985), die diesen Prozess als ein exklusives
Ergebnis des Fleisses und Neuerungs-Geistes der Einwanderer
ansahen. An erster Stelle muss man die wirtschaftliche
Entwicklung des Landes als Ganzes berücksichtigen, die die
Städtegründung und das Wachstum in den Südstaaten
ermöglichte. Zweitens war nicht nur und nicht im Besonderen
der Einwanderer derjenige, der den Wohlstand auf diesem
Gebiet hervorbrachte. Der entscheidende Faktor für das
Auftauchen von Industrie-Unternehmern war - nach der Logik
des kapitalistischen Systems - die Kapazität, in kurzer Zeit
Kapital aufstocken zu können, die erforderlichen
Arbeitskräfte bereitzustellen und Absatzmärkte für ihre
Erzeugnisse zu garantieren. Gegen die üblichen
Interpretationen, siehe: SEYFERTH, 1974. und GERTZ, 1990, s.
606-617.
[16] In allen uns zur Verfügung stehenden
Dokumenten, konnten wir lediglich 2 Vereine finden, die sich
in ihrer Anschauung von dieser Tendenz unterschieden und sie
lediglich als halsstarrige Opposition ansahen. Es handelt
sich dabei um den "Allgemeinen Arbeiterverein", 1892 nach
dem Vorbild ähnlicher Vereine in Deutschland gegründet, mit
sozial-demokratischer Tendenz, und erst während des 2.
Weltkrieges aufgelöst; und den "Sozialistischen
Arbeiterverein", anarchistisch orientiert, 1920 gegründet,
und verantwortlich für die Herausgabe der Zeitung "Der freie
Arbeiter”, die bis 1930 überlebte, ebenfalls in deutscher
Sprache gedruckt. Diesbezüglich nachzuschlagen bei GERTZ.
1985. S. 75-84 und 1990, S.606-617. sowie KNIESTEDT, 1989.
[17]4 Vereine, die für Verbreitung von sogenannten
Flugblättern auf dem oben erwähnten Kongress, 1910. sorgten.
Staatsarchiv Hamburg. 1910.
[18] Graga Aranha
(1868-1931) wurde in São Luis do Maranhão
geboren und hat in Recife Rechtswissenschaft studiert hat,
wo er Tobias Barreto kenngelernte, einer der Vorläufer
Hackeis in Brasilien. Laut João Paulo Paes (1989. p.
169-75), wurde Aranha auch von Schopenhauer, Hartmann und
Nietzche beeinflusst.
[19]
In freier Übersetzung: In Brasilien, sei ruhig, wird
sich die Kultur regelmässig ausbilden, auf diesem
mestitzischen Hintergrund, weil der göttliche Geist ihr
schon eingegeben ist. Nichts kann ihren Aufflug verwirren
(...) In Zukunft, wird die Zeit des Mulatten überwunden.
[20] In
freier Übersetzung: Eine junge Mulattin sass auf der
Tür-leiste: ihr Körper und die Gedanken symbolisierten die
Faulheit. Die Haare waren zerzaust, das Hemd schmutzig und
fiel über die welken Brüsten (...)
[21] In freier
Übersetzung: Man konnte es bemerken, sie hatten einen
gemeinsamen Gedanken, den praktischen Verpflichtungen
nachzukommen, den Willen vorwärts zu laufen, wie ein
einziger harmonischer Körper.
[22]Graga Aranha hat im Jahre 1915 in der
"Liga da Defesa Nacional" eingegliedert, einer von dem
Panamerikanismus beeinflusster Verband, der als Ziel hatte,
das patriotische Gefühl der Brasilianer verbreiten. Sie hat
sich mit dem Anti-Germanisten identifiziert, und besonders
Aranha hat sich gegen die "Germanisierung" im Süd- Brasilien
gekämpft.
^ In freier Übersetzung: Das Schicksal muss
akzeptiert werden: der Stärkste zieht den Schwächsten an:
der Herr schleppt den Sklaven, der Mann . die Frau. Alles
ist Beherrschung und Unterordnung.
[23]
In freier Übersetzung: Als die Menschheit aus dem
primitiven Leben in Richtung der Stadt gegangen ist, hat sie
von dem Sklaventum zu der Freiheit ihren Weg gemacht. Alle
menschlichen Ziele sollen die Stärkung der Solidarität, die
Einheit, und die Verminderung der Gründe des Streitens sein.
[24] in freier
Übersetzung: Der Zweck eines Lebens ist nicht die niedrige
Verbindung untereinander; was man sucht. Ist die Kunst, die Träume, (...) zu schaffen,
um wie ein Chef zu führen, wie ein Pfarrer die Herde führt.
Wofür die Solidarität und die Liebe? Wenn man sein Leben in
der Gleichheit erlebt, dann verdirbt man ein Trockenfleisch.
[25] In freier
Übersetzung: Es ist wirklich schön dieses Schauspiel, eine
freie und einzelne Beschäftigung im strengen Kontakt der
Menschheit mit der Natur; aber was wir jetzt sehen, ist der
Anfang einer Zivilisation, wo der Mann noch nicht die Natur
gewonnen hat. deshalb benimmt er sich als ihr Knecht.
1' Dank der Anforderungen des Kaisers
Dom Pedro II, wurde im Jahre 1838, das
Historisch-Geographische Brasilianische Institut gegründet Instituto
Hlstórico e Geogrqfico Brasileiro), eine Stiftung, die die Aufgabe
hatte, die Verwirklichungen der Forschungen, hauptsächlich
der Kolonialzeit zu vollziehen. In diesen Studien, wurde
oftmals der portugiesische Kolonisator als Vorkämpfer
emporgehoben. (RODRIGUES.
1969, s. 33)
[27] Mario
de Andrade (1893-1945) wurde in São Paulo
geboren. Er war Musiker, Schriftsteller und
Kultur-Abteilungs-Minister aus São Paulo tätig. Er wurde
auch einer der wichtigsten Vertreter der modemisten Bewegung
in Brasilien, die Semana de Arte
Moderna sich
nennt. In der Literatur wurde er von den deutschen
Expressionisten beeiQusst. (BOSI, s. 390...)
[28] In
freier Übersetzung: Sie war kein Fräulein mehr. Weil das
Fräulein, die dieses Idyll anfing, durfte nicht leiden. Und
das Fräulein dieser Minute ist eine hinfällige Frau, ein
leidendes Fräulein. Und weil sie leidet, ist sie mehr als
ein Fräulein, ist sie keine deutsche mehr; sie ist ein
kleines menschliches Wesen geworden.
[29] in
freier Übersetzung: Ihre Augen schlossen sich langsam, sie
erblindete ganz. Aus der Tiefe ihres Seins, erscheinen
verwirrte Wünsche und Verlangen. Leichtsinnig fühlte sie
geniale Sensationen. Und der Orgasmus! Sie hatte jetzt einen
pflanzlichen Geist. Und so verloren, so schwungvoll, die
Nase vergrösserte sich, die Lippen zerrissen, (...) sie
wurde hässlich.
[30] Intellektuelle
Gruppe,
die in Recife in kaiserliche Zeit studierte, wo zuerst mal
die Entwicklungstheorie und die aus Europa wissenschaftliche
Gedanken verbreitet wurde.
[31] Gilberto
Freyre (1900- 1987) ist bekannt für seine These, die von der
Existenz der Rassen Demokratie in Brasilien handelte. Nach
Freyres Meinung, gibt es in Brasilien, im Gegenteil zu den
Vereinigten Staaten, kein rassistisches Vorurteil gegen den
Neger, wegen des Mischungsprozesses und auch wegen der
Mentalität des Portugiesen. Seine Prinzipien wurden schon
von vielen Verfassern in Abrede gestellt, wie zum Beispiel.
Otavio lanni und Fernando Henrique Cardoso (in:
IANNI, 1975 u. w.). Es ist zu bemerken dass sei es in
Romeros wie in Freyres Gedanken, trotz ihrer positiven
Stellung gegen die rassische Verschmelzung, nach ihrer
Meinung, sollte das weissen Volk die Kultur und die Politik
beherrschen. Ausserdem sollte der Portugiese sich über die
anderen durchsetzen, in seinen berühmtesten Werken. Casa Grande &
Senzala (1975
11933)) behauptet Freyre dass die nord-europäischen Völker
sich nicht in tropische Länder gewöhnen: wegen ihres
Bio-typus, wenn sie nach Brasilien auswandern sollten,
würden sie für Krankheiten und zu jeglichem Gebrechen
empfänglich sein. Aus diesem Grunde, war er gegen die
Deutscheinwanderung nach Brasilien. Nach unserer Meinung,
lässt er in seine Ansicht in derselben rassistischen Theorie
erscheinen, die er zum Widerspruch stehend vorhatte. Über
Freyres rassistische implizit Tendenz, siehe: WEIMER. 1980.
[32] Laut
Giralda Seyferth, (1989, S. 113-55) trotz seiner Bewunderung
an Gobineau, gegensetzte Romero
seine Ideen über die
brasilianische Gesellschaft. Nach der Meinung des
französischen Denkers, war die brasilianische Gesellschaft
unfähig einer Aufhebung ihres Archaismus, dank der Existenz
der unterlegenen Rassen, wie die Indianer und Neger.
[33] A imigração e o futuro do povo brasileiro, 1886. (Die Einwanderung und die
Zukunft des brasilianischen Volkes)
[34] Er
spricht hier von den deutschbrasilianischen Zeitungen, die
die hohe Steuer kritisierten, welche sich auf die
Mittelklasse konzentrierte.
[35] die
sogenannte Vargas-Ära.
[36] Der
Roman erzählt die Bahn einer zur kleinen Bourgeoisie
gehörende Familie, die aus ihrer erdichteten Stadt
Jacarecanga genannt auswandert, um in die Hauptstadt von Rio
Grande do Sul zu bewohnen. Der Chef der Familie
starb und deswegen mussten die Kinder Arbeit suchen. Dazu
bitten sie um Hilfe bei anderen besser wohlhabenden
Verwandten, die in Porto Alegre
lebten. Die Bestrebungen um
ein besseres "status
quo" zu gewährleisten
ist das zentrale Thema des Romans, der zusammen mit "Clarissa" und "Caminhos Cruzados” eine
Trilogie umfasst.
[37] In
freier Übersetzung: (...) aus Marmor, aus Gips, aus Eis
gemacht ist, aus irgendwas anderes als aus dem Stoff von dem
Vasco gemacht ist.)
[38] in
freier Übersetzung: Zerstreut nahm er ein Magazin zur Hand
(...) es waren Prospekte aus der Berliner Olympiade. Er
blätterte das Magazin durch: Bilder aus Köln, aus Frankfurt,
aus den rheinischen Städten (...) Alles gehörte zu dieser
Welt; ihre schlanke Gestalt und ihre blonden Haare wurden
ein Teil dieser kalten Landschaft, von diesem Land wo es im
Winter schneit. Vasco fühlte sich ein Ausländer (...)
[39] Traditionelle
Bezeichnung für Leute, die in Rio Grande do Sul geboren ist.
[40] Francisco
Jose de Oliveira Vianna (1883-1951) wurde
Sozial-Wissenschaftler, Rechtswissenschaftler und
Rechtsberater des "Estado Novo”. Er wurde bekannt für sein
Studium über die brasilianischen sozialen Probleme, und als
Autor der ersten Gesetze, die das staatliche
Sozialhilfe-Systems regelte. Sein berühmtestes Buch nennt
sich Instituiçóes Politicas Brasileiras (Brasilianische
politische Institutionen), erscheint in 1934.
2® Diese Interpretation kann richtig sein, wenn
man nicht die deutsche Wieder - Einwanderung von
Süd-Brasilien nach São Paulo und Rio de Janeiro
berücksichtigt. Die Anzahl dieses Ausflusses ist jedoch kaum
zu ermessen, weil es keine Quelle dafür gibt. Es ist
allerdings zu bemerken dass viele Handwerker und
Fach-Arbeiter wegen ihrer ländlichen Betätigung enttäuscht,
ausgewandert sind, um in der Industrie oder als selbständige
Handwerker tätig zu sein.
[42]
; Congresso
Diocesano de São Paulo; actas e documentos.
São Paulo, Typografia Saleslana, 1901. p. 136
[43] Anais do l Congresso Catholico Dtocesa.no de Pernambuco.
Recife,
empreza d'A Provincia, 1902. p. 99-100
[44] Die
AIB (Ação Integralista Brasileira) wurde ein Extrem Rechts
Partei, die zu den
italienischen Integralisten und den
katholischen Konservativen erleuchtete. Mit einem
ultra-nationalistischen Charakter, übte sie ihren Einfluss
besonders unter die südbrasilianische Bevölkerung aus. und
spielte eine wichtige Rolle während der Vargas Regierung.
[45] Diese
politische Tendenz, laut Marson. wurde besonders von
Adalberto Torres verteidigt, ein Denker, der keinen
Kompromiss mit den rassistischen Theorien hatte. Allerdings,
in der 30. Jahrzehnte und besonders während der
Institutionalisierung des Estado Novo, sei es die Prämisse laut Alberto Torres wirtschaftlichen verteidigten Nationalismus,
sei es Jeder, der im Integralisten Prinzip eingereiht wurde,
Zugunsten einer selben offiziellen Politik abgestimmt.
[46] Expeditionsmitglieder
in dem kolonialen Zeitalter, in São Paulo organisiert, um in
dem Inland Gold und Silber zu suchen.
[47] Vianna
behauptet dass er ein Bewunderer der Anglo-Sachsen und der
germanischen Kultur ist, deren legendäre Traditionen ihre
politischen Institutionen bestimmen, sowie ihr Schicksal in
Hinsicht anderer Länder (VIANNA, 1991 (1931), s. 271, und
VIANNA, 1974).
Es ist zu erinnern dass die
Nationalisierungspolitik, die auf die deutschsprachigen
Schulen in Brasilien konzentrierte, und die die
deutschbrasilianische Vereinigungswesen verbot, in der
Verfassung von 1934 behördlich geregelt wurde, dank dem
juristischen Beirat Oliveira
Viannas.
[49] In freier Übersetzung: Ich kann mich
nicht schwarz oder rot fühlen/ Zwar passen diese Farben gut
in meiner Harlekin-Phantasie ,/ Aber ich fühle mich weder
Neger noch Rot/ Ich fühle mich Weiss, der
die Mildtätigkeit und die Zuflucht erleuchtet:/Ich fühle
mich Weiss, das. der Aufruhr die Faulheit, den
Krieg, die Dummheit reinigt/ Ich fühle mich bloss Weiss jetzt, ohne zu atmen, in dieser freien Luft
Amerikas/Ich fühle mich Weiss,
nur Weiss, in
meinem aus verschiedenen Rassen gesprenkelten Geist
[50] Barbar, Deutsche, unzärtlich
unbrüderliche Deutsche.
[51] Ottokar Dörffel (1818-1906) wurde
Rechtswissenschaftler und Bürgermeister der Stadt Glachau.
in Deutschland. Dank der politischen Verfolgungen der
Märztage, wanderte er nach Brasilien in 1854 aus.
[52] Sellin war ein Leader der Kolonie
"Dona Francisca", heutzutage Joinville genannt. Als
Journalist, kritisierte er die brasilianische Politik,
welche, seiner Meinung nach, die Immigranten als neue
Sklaven behandelte.
[53] Ato Constitucional de 1834. Art. 95,
II e III e Art. 136.
[54]Die drei Artikel welche denselben
Titel haben, wurden in seinem Kalender veröffentlicht,
beziehungsweise, in den Jahren 1874. 1875, 1876.
[55] Traditionell
riogrander Tee-Matte.
[56] Diese und
andere Erläuterungen wurden in dem Buch Bilder aus Brasilien in 1890,
vereinigt.
[57] Dieselben
Ideen wurden, in einem anderen Artikel, mit grösserem
Ausführlichkeit, behandelt, herausgegeben im Kalender (Der
Mucker Prozess. KVK, 1879. S. 133-41)
[58] Die Erweckung zum autoritären
Charakter des brasilianischen Staates, spürbar in den Texten
welche kurz vor dem Ausbruch des Krieges standen, verdankt
man nicht, laut unserer Kenntnis, einer radikalen Änderung
der Beziehungen zwischen den offiziellen Mächten und den
Schichten, wenigstens bis zum Jahre 1917. Die Beschwerde
liegt darin, dass sie sich immer ungünstig der Immigranten
zeigen, zum anderen, die weiteren untergebenen Schichten des
Landes, besonders was, den Südstaaten angeht, ist diese
Epoche, in welche diese Segmente einen gewissen sozialen und
politischen Aufstieg spüren; wenn sich die Kritiken der
Elite zunehmen und die lokalen Klagen sich vermehren, so
kann das ein Effekt der eignen Entwicklung der "Mass-media1’, von welchen die Deutsche Presse ein
Vorbild ist. In dieser Hinsicht können wir nicht mit
Seyferth einstimmen. (1982). der schon ab den ersten
Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts, die Wiedergaben der
Anti-germanistischen Betrachtungen zu hoch einschätzt und
auch ihre Fähigkeit um in der Institutionellen Politik
einzugreifen.
[59] Unter anderen, nachsehen, Das Ende der Monroe
Lehre und Die Deutschen und die Ausländer, in: PETERS. 1930 [
1915-1917],
[60] Dieses
Prinzip, welches nur für Europa gültig sein sollte, würde
auch von dem Alldeutscher Verband, an die Deutschen in allen
Weltteilen wohnend, ausgeübt.
[61] Verein
für das Deutschtum im Ausland - Ortsgruppe Hamburg, Bericht
von 1927. Staatsarchiv Hamburg
[62] Die
Ergebenheit der Immigranten zum Kaiser Dom Pedro II. Der
gute, wird durch zahlreiche Schriften der deutschen Presse
bestätigt. Er wurde ideologisch als der Verteidiger dieses
Volkes angesehen, einesteils weil er die Politik der
Immigration Brasiliens angefangen hat. andererseits weil er
österreichischer Abstammung war - wodurch er einen besseren
Begriff deren Kultur haben konnte. (BREPOHL, 1933a und 1933b
[63] Was
die Anforderung des Einbürgerungsrechtes der Masse betrifft,
muss man hervorheben dass diese Massregel nur für die
Deutschen die in den grösseren Städten lebten, wichtig war.
Laut der Gesetzgebung, würde allen Ausländer, automatisch,
das Eingebürgerungsrecht gewährt, wenn sie in sechs Monaten,
die Anforderung gestellt hätten: weil aber die
Verbindungsmöglichkeiten prekär waren, hauptsächlich in
kleinen Städten des Hinterlandes und in den
Landwirtschaftsgebieten, die Möglichkeit sich als
Brasilianer zu verwandeln wurde
gar nicht bekannt. Dieser neue Stand wurde sehr
wichtig zur Zeit der Wahlen, wo die Politiker anfingen sie
im ihre Wahlredoute einverleiben.
[65]
PEREIRA BARRETO.
1901, O século XX
sob o ponto de vista brasileiro, apud VITA. 1968, p. 236.
Der Verlust der Ländereien entsprach nicht nur
der Schulden welche die Immigranten nicht begleichen
konnten, aus verschiedenen Gründen. Ausser der Propaganda
die sie nach Brasilien anzog. mit der ihnen angebotenen
Leichtigkeit, die in der Praxis sich nicht verwirklichten,
nach den Landgesetzten von 1850. viele der Landgüter welche
die Bauern erkauften, sollten dem Staat zurückfalten, weil
die Rechtmässigkeit des Besitztums streitig gemacht wurde.
[67] Dieses Gesetz, von den Politikern,
wie zum Beispiel, Hasse, von dem Alldeutscher Verband,
vorgebracht, erlaubte es das im Ausland Wohnende oder selbst
Immigranten, ihr deutsches Bürgerrecht behielten, und ihnen
noch, eine zweite gleichlaufende Bürgerschaft zusicherte.
Für Mercedes Kothe (1991. S. 18). dies Massnahme, die bis
1913 gültig war, und dann zur Zeit des Nazismus wiederkam,
erlaubte es, im Falle eines kriegerischen Konfliktes, dass
die deutschen Soldaten unter den tausenden Deutschen die im
Ausland lebten, rekrutiert werden konnten.
[68] Eric Hobsbawm (1988, S. 218 u. w.)
als er das nationalistische Gefühl der Immigranten
betrachtete, erhebt um Ihre Effekte in der Praxis, oder, um
ein Netz des Solidarverhältnis zwischen Landsmänner welche
nicht nur dieselbe Tradition in einem fremden Lande teilten,
aber hauptsächlich dieselben Notwendigkeiten.
[69] Die Juden und die der Linken wurden
von diesen Gruppen gehasst. laut Adorno, weil sie das Bild
des Bankiers und des Intellektuellen darstellten: "Geld und
Geist. Träger des Umlaufes, sind der verleugnete Traum
derer, welche die Oberherrschaft verstümmelte und von der
sie sich, zu ihrer eigenen Fortdauer, bedient (1985. S. 161)
[70] Die neue Funktion des Lesens und auch
die gegenwärtige Erzeugung der Druckschriften erwirbt Sinnes
Ausschluss, Jaut Arendt (1983) und Habermas (1974) mit der
Erhebung der Sozialfrage in der Öffentlichkeit. Zur besseren
Erläuterung dieser neuen "Persönlichkeit" der modernen
politischen Geschichte, helfen uns die Betrachtungen von
Dieter Prokop; seines Erachtens, die öffentliche Meinung
bildet sich, von Debatte und dem Umlauf der Informationen
des "informalen Marktes" der Gutachtung der Ereignisse,
welche von Parteien und Vereinigungen, die mehr oder weniger
sich laut ihrer finanziellen und unternehmenden Kompetenz
organisieren. Diese Feststellungen werden in den Wahlen der
verschiedenen Instanzen deutlich. Gelegenheit in welcher der
beweisgründliche Rückhalt schon nicht mehr eine
hervorgehende Rolle ausübt, sondern aber die mit starker
emotioneller Rede, welche
^ Laut der Statistik des Deutschen
Auslands-Instituts (DAI), steigerte sich die Zahl des KDB
von 10.000, im 1914 auf 30.000, in 1926. Ghese (1929)
behauptet dass die Abdruckszahl der verschiedenen Zeitungen
in deutscher Sprache in 1910, 17.000 sich auf 55.000 in 1928
vergrössert. Dasselbe kann auch von den Vereinen behauptet
werden; nur in Rio Grande do Sui sind
es 352 dieser Gattung, in Santa Catarina, steigt
die Zahl von 25 auf 85 (GERTZ, 1987, s. 71). In Curitiba gab es, in 1926, mindestens 25 Vereine, ausser
der Gründung von 4 neuen Zeitungen, welche aber, aus
verschiedenen Gründen, kurzer Dauer waren.
[72] Wir beziehen uns auf die staatlichen
Gesetze welche sich auf die ersten Einwendungen zu der
Nationalisierung des Lehrers. Es sind folgende: das Gesetz
1283, von 1919, welches die Lehrer aufforderte sich eines
Examens der portugiesischen Sprache zu unterstellen, auch
wenn sie nur an Privatschulen tätig waren; das Gesetz 1380,
von 1921, welches die Erlaubnis zur Erhaltung der
deutschbrasilianischen Schulen einschränkte, diese durften
nur dort bestehen, wo im Umkreis von 2 km. sich keine
staatliche Schule befand: das Gesetz 1656, von 1929, welche
die Bedingung zur Eröffnung neuer Schulen stellte, dass der
Unterricht der Geographie und Geschichte Brasiliens, wie
auch den Gebrauch der portugiesischen Sprache berücksichtigt
werden sollte.
Die ersten beiden Gesetze wurden,
unter dem Impact des ersten Weltkrieges, verkündet und das
letzte, wegen der Nationalisierungspolitik des Unterrichtes,
die sich im ganzen Land zeigte, aber nicht einen sofortigen
Anklang fand von Seiten der auserlesenen Gesellschaft von
Rio Grande do Sul und Paraná.
[73] Aussendeutscher
Wochenspiegel der AO. Archiv des Instituts für Zeitgeschichte,
München.
[74] Geschichte und
Ziel der Auslandsorganisation, in: Jahrbuch der AO der NSDAP. 1939.
Archiv des Instituts für Zeitgeschichte, München.
[75] Diese Rechte waren oftmals nicht
ausgenützt, denn eine verwickelte Bürokratie verhinderte es;
sie hatten aber ihre Wirksamkeit, zu mindestens nur in der
Propaganda; einige Deutsche, die im Ausland lebten und mit
diesen Gruppen verpflichtet waren, wurden nach 1933
aufgefordert nach Deutschland zurückzukehren, um an dem
wirtschaftlichen Wunder, dass dort entstand teilzunehmen.
Verschiedene fuhren zurück um das neue Deutschland
kennenzulernen oder um in den deutschen Schulen zu studieren
oder an den Kursen, welche die Partei zur Verfügung stellte,
zu studieren. Und noch Andere, schrieben sich, freiwillig im
Militärdienst ein. (Kötter/Interview/Curitiba, 1987)
[76] Zehn Gebote der Auslandsdeutschen,
in: Jahrbuch der AO der NSDAP. 1939.
Archiv des Instituts für Zeitgeschichte, München.
[77] BOHLE, E. Deutschlandsweltgattung. Jahrbuch der AO der NSDAP. 1939.
Archiv ...}
19 Der angebliche Ungehorsam zu den Grundregeln
der AO kann man erklären, weil die Verbündung andere
Interessegruppen, einschloss, ausser der Nazis, nahm sie
auch der Abtrünnigen Deutschen der AIB Ação Integralista
Brasileira). auf
und ausserdem noch andere, welche wenn auch Pangermanisten
waren, zu nicht einer dieser Organisationen gehörten.
[79] Von 1928 bis
1942, als die brasilianische Regierung eine Reihe von
hemmenden Massnahmen gegen diese Bewegung unternahm.
[80] Hier
beziehen wir uns auf Druckschriften der Journalisten und
brasilianischer Schriftsteller, welche sich der, von der
politischen Polizei, während des zweiten Weltkrieges, in
beschlaggenommenen Dokumenten, bedienten. Nationalisten die
sich der Dokumente, der "deutschen Gefahr" begeisterten,
deshalb sind ihre Behauptungen parteiisch, weil sie nicht
immer die deutsche Sprache beherrschten und nicht den
Unterschied der einfachen germanischen Vereine und der der
Nazis bemerkten. Siehe u.a. PY, o/D, RATTON. 1943 und
MARTINS, o/D.
Laut Brühl, die bevorzugten Länder waren die
Tschechoslowakei, Skandinavien, Polen, Canada, die Vereinigten Staaten, Brasilien, Argentinien
und Paraguay. (Besinnung, in: Volk und Heimat, J935, S. 38-40)
1* Ich beziehe mich hier auf den
Aussendeutschen Wochenspiegel, mit verringertem Umlauf, und
auf die Vertrauens-Korrespondenz für das Presseabteil der
AO.
[84] AO der NSDAP, Bericht Nr. 253/56.
18-12-1935. Archiv...
Diese Dokumente, bis wo es uns möglich
war, nachzuforschen, dienten als Unterstützung zu den
Forschungen des DAI, dessen Texte nicht nur in den Kolonien
gelesen wurden, aber auch in Deutschland.
[86] in: Jahrbuch der AO der NSDAP. 1941,
S. 28-32. Archiv...
[88] Die Aufgabe der AO: Neue Wege. idem.
S. 42-47
[89] Wissenschaftler
im Auslande, in: Aussendeutscher Wochenspiegel. 1940,
S. 263-75.
[90] Hütenberger.
von den Überlegungen des Martin Broszats. ausgehend, benützt
das Urteil ’'Politkratie" um die unzähligen Streite um
Vorrechte im Innern des Systems zu charakterisieren, welche
in den verschiedenartigen Ansuchen der Macht ausgeführt
wurden, nicht ausschliesslich in der institutionellen Macht
(1976. S. 421 usw.)
[91]
Der Text der zu dieser Analyse begutachtet wurden
sind Die
völkische Lage des Deutschtums in Rio Grande do Sul. 1936 und Fünfzig Jahre brasilianische Republik
und wir. 1939.
[92]
£)je Kommentare über die Ideen dieses
Verfassers sind ab des Textes Beiträge zu den Siedlungs-Sippen und
Familiengeschichte der Deutschen in Brasilien, 1936. gemacht worden.
[93] Sommer
berichtet dass dieser Fall nicht sehr bekannt ist, weil die
dorthin ausgewanderten Deutschen ihre Namen der
portugiesischen Sprache anpassten, wie zum Beispiel: Ort
wurde Horta, aus Waid wurde Silveira, aus Erdreich wurde
Terra. Noch ein anderes Problem, laut seiner Meinung,
bezieht sich auf den Mangel der Dokumente, dieses erklärt
sich, wenn man das Zeitalter in dem die Auswanderung sich
begab, bedenkt.
[94] Laut
Banton. (1987, S. 56 usw.) Gobineau las mit aller Vorsicht
die Werke der deutschen Anthropologen über die Rassenlehre
und Klemm scheint einer seiner hauptsächlichen Anreger
gewesen zu sein. Nach der Meinung dieses Verfassers ,
schätzte man die überlegenen Rassen genetisch aktiv, während
der Anderen, passiv sind. Wenn auch ein Mischungsprozesses
vorkäme, würden die Charaktere der Ersten sich der Zweiten
übersetzen. Wenn es uns auch nicht möglich 1st zu behaupten,
dass Oberacker wirklich diese Werke gelesen hat, aber die
Ähnlichkeit seiner Ideen geben uns einen interessanten
Umlauf, welcher als Werkzeug dienen würde - die Bewahrung
der ethnischen Identität zu verteidigen, diese als ein
Mitte] um einen noch wirksameren Beitrag dieses Segmentes
zur Entwicklung Brasiliens.
[95] Wenn
es sich auch, um einen anscheinend unwichtigen Unterschied
handelt, zeigt sie sich als ein schwerwiegendes Element um
ein besseres Verständnis des Lesens der Nazis in Hinsicht
auf den arianischen Mythos, welches nicht genau
übereinstimmt mit dem Lesen der Germanisten. In dieser
Richtung, erkennen wir, wie Poliakov, (1974),
dass der arianische Mythos ein Phänomen von langer Dauer (longue durée) und
der, in der kulturellen deutschen Geschichte zugegen ist,
seit der modernen Epoche. Wir stimmen nicht mit dem
Verfasser überein, als er eine fortsetzende Richtung
zwischen den ersten Beschreibungen in Hinsicht auf dieser
Identität und den Nationalsozialismus, festlegt. Wir
verstehen dass jede mythische Ausarbeitung eine
polissemische Natur besitzt, unabhängig einer Kultur, wenn
man sie auch gebraucht als ein Kode zur Verständigung.
Ausserdem werden die Ausarbeiter einer bestimmten
mythologischen Sprache, schwerlich Kontrolle über ihre
Effekte bei dem Empfänger haben, seien es ihre Zeitgenossen,
seien es die, welche sich in der Geschichte, nachfolgen.
[96] Voigt
entfernt sich der Begriffe Klemms, weil er nicht den
biologisch bestimmten Charakter der Obersten Rassen
zustimmt. Seiner Meinung nach, ist es das Gegenteil; "das
schlechte Blut verdirbt das gute", was durch sexuelle
Kontakte hervorgerufen wird (POLIAKOV, 1974.
S. 272)
3° Der KDB, zum Beispiel, behauptete, in einem
seiner Berichte dieser Konjunktur, die Generation "sei das
Grab des Deutschtums in Brasilien", denn sie sorgte sich
nicht um die Erziehung der Kinder, noch beobachtete sie
ihrer Werte in Hinsicht auf dem deutschen Idealismus (KDB.
1937, S. 31-36)
[98] Das
Kaufhaus 1st gleichzeitig eine Bar und somit ein Treffpunkt
für informale Gespräche.
[99] Diese
journalistische List kann mit der Spalte des Lesers, oder
Briefe des Lesers welche in den gegenwärtigen Zeitungen
erschien, vergleichen werden: die Briefe werden von dem
Herausgeber beantwortet, wo er seine eigenen Meinungen
preisgibt. Es handelt sich um eine journalistische Technik,
die in verschiedenen anderen Kalender auch vorkommt, wie zum
Beispiel: "Der Lahrer hinkenden Boten für den Bürger und
Landmann" und auch im "Koseritz Volkskalender". in den
ersten Jahren seiner Herausgabe. Es könnte auch eine
Erbschaft der ersten europäischen Kalender sein. denn, laut
MDC (1987) die Kalender brachte auch immer eine freie Spalte
in dem der Leser über die gebrachten Artikel urteilen
konnten; der Herausgeber, als er seine Texte, Gedichte oder
Erzählungen aussuchte um sie in Buchform zu bringen,
begutachtete die Urteile der Leser, aber schliesslich, war
er es selber der sich als "Richter der Kunst”, sah und
suchte nach seinem Kriterium die Besten unter verschiedenen
Schriftstellern aus. Diese Funktion kann möglich die ganze
Geschichte dieser literarischen Gattung durchlaufen sein bis
zum 20. Jahrhundert, als die politischen Themen, die dann in
diesen Druckschriften erscheinen, gleichartig beurteilt
werden, von denen die für ihre Herausgabe verantwortlich
sind.
[100] Die
Abneigung gegen den Rhythmus der industriellen Arbeit ist
eine Charakteristik der deutschen romantischen Mentalität.
Unter den Deutschbrasilianer bemerkt man eine ähnliche
Stellungnahme, wie in der schon sogenannten Erzählung Die beide Nachbarn von
Rotermund, in dem der Stadtmensch seine teuersten Werte zu
Gunsten der Gewohnheiten des modernen Lebens verliert, und
in den Kritiken Brepohls in seinen Büchlein, unter den Titel
Wie gewinnt man die Leute für gute deutsche
Literatur?, (1917) in dem er bemerkt,
dass die Welt der mechanischen Arbeit die Mensch erniedrigt
in dem er Ihn, in einem gleichen Stand mit den Tieren
stellt, Sklaven ihrer Instinkte und nicht mehr von seinen
hohen Idealen, gelenkt.
[101] Die
Kritiken welche Pater Nicolaus machte, gehören in anderen
Ausführungen; als Vertreter der offiziellen Haltung der
Katholischen Kirche, ist zugänglicher in Hinsicht der
Assimilation, als. zum Beispiel, der Pfarrer, wegen des
universellen Charakters jener religiösen Konfession.
[102] In den
Zeitungen jener Zeit, zeigt man eine Foto des damaligen
Gouverneurs von Rio Grande do Sul, Cordeiro
de Farias, als Leiter eines Aufmarsches gegen die
Anwesenheit der Deutschen in Brasilien, eine Bewegung die
laut Nachrichten, er selber organisierte.
J In freier Übersetzung: "Angesichts
der Tatsache, dass sich Christen mit dem schrecklichen
Verbrechen von Auschwitz und Buchenwald die Hände befleckt
haben, lässt ihren Gott, nach Vollendung ihres Werkes,
unmöglich werden.
[104]Diese Gemeinden wurden in zwei Synoden
geteilt: die "Evangelische Synode von Santa Catarina und Paraná" und die "Evangelisch-Lutherisch Synode von Santa Catarina, Paraná und andere Staaten Brasiliens": diese
letzte umfasst auch die Gemeinden vom Staat Espírito Santo,
[105] Karl Barth (1886-1968) war Dozent in
der Universität Bonn, als er dank seiner politischen und
theologischen Haltung, müsste in 1935 in der Schweiz, sein
Heimatland, wiederkommen, wo er seinen Nachfolger weiter
beeinflusste (KUPITSCH, 1971).
[106] Brief von Karl Barth an Pfarrer
Giessel, 1933, apud PRIEN, 1989, S. 414-415.
[107]
Wir zitieren als Kontrapunkt solcher Stellung, die
ekklesiastische Politik der Missouri Synode, aus
verschiedenen Pfarren im Süden Brasiliens bestanden, welche
von lutherischen Pastoren aus den U.S.A. gegründet wurden.
Die Missouri Synode hatte nie ein Kompromiss mit der
Volkstumsideologie und hatte auch nicht in der Deutsche
Lutherische Kirche in Brasilien (DLKB) gegliedert.
[108] Über die
konfessionelle Verschiedenheit der ersten Pastoren, sieht
man: DREHER, 1984: FUGMANN & BREPOHL. 1927: PRIEN. 1989;
AN AIS do II Simpósio da imigração e Colonização
Alemã, 1980: ENCONTRO de História da Igreja, 1978: HAARBECK
et all, 1957.
[109]
Die Gnadeauer Mission wurde einer aus pietistischen
Prägung para-ekklesiastische Verband, der viele Gemeinden in
der deutschsprachigen Länder Europas während der
Jahrhundertwende beeinflusste.
Die Gnadeauer Mission verteidigte eine
Erweckungs-Bewegung, die Einzelbekehrung, vollkommende
Frömmigkeit, eine intensivere Beschäftigung mit dem Wort
Gottes und die Verbreitung des Evangeliums. Well sie die
Kraft des Heiligen Geistes scharf betonnte, wurde ihre Lehre
gegen den Artikel 5 der Augsburger Bekenntnis beurteilt.
Nach der Lehre der Gnadeauer Mission, sollte auch die
Kindertaufe nicht als eine Garantie der Gnade Gottes
berücksichtigt werden, was für die Kuppel der Kirche einen
Widerspruch gegen den Artikel 9 der Augsburger-Bekenntnis
war.
[110] Diese
Schriften, im Gegenteil zu den anderen mit selben Tendenzen,
wurde nicht von den offiziellen Obrigkeiten in Brasilien
vernichtet, dank der Zensur während der "Estado-Novo-Ära".
Es ist hervorzuheben dass selbst die Lutherische Kirche in
Brasilien alle Quelle auf Verdacht zerstörte, um ihre
Identifizierung mit dem Nazismus aus der Geschichte zu
besänftigen. Was an der Werke Wilhelm Brepohls betrifft,
wurde solche Schriften bewahrt, weil der Verfasser sie nach
den deutschen Bibliotheken und Archive geschickt hatte.
[111]
BREPOHL/Tagung/ 1941-43.
Die Manuskripte der Memoiren des F.W.
Brepohl wurden von der politischen Polizei in Porto Alegre beschlagnahmt und zum Teil vernichtet, so dass
nur einige Seiten, die seinen Kindheits- und
Jugenderinnerrungen gewidmet waren, übrigblieben und von seinem Sohn
Teófilo Brepohl aufbewahrt wurden.
[112] BREPOHL. F.W.
/Memoiren...
[113] LANDMANN, 1979
und Kötter, Maria / Interview/ 1988.
[114]
Die hier gemachten Kommentare sind hauptsächlich in
zwei Broschüren eingetragen: Wie gewinnt man das Volk für gute Literatur? 1917. und Deutsche Kulturpflege im In- und
Auslande in den letzten 15 Jahren. 1925.
[115] Kötter.
Maria/Interview/1989 u. Brepohl, Teófilo/Interview/ 1989
,6 In Folge der zahlreichen
Verschiedenartigkeiten und der kulturellen Unterschiede – je
nachdem wo die pietistischen Bewegungen aufkamen - können
wir es nicht unterlassen hervorzuheben, dass diese Tendenz
nicht absolut und auch nicht in allen Fällen gültig war.
Viele dieser Segmente entschieden sich für ein Vorgehen, das
sich eben doch an die Regierungen wandte, und das soziale
Reformen im Erziehungs- Gesundheitswesen u.a. forderte. Ihre
Lehre, gebunden an eine politische Kultur, die grossen Wert
auf Einfachheit legte, jedoch Armut verurteilte, trug dazu
bei. dass ihre Mitglieder sich in den verschiedensten
Situationen zugunsten von Tätigkeiten und Vorträgen, die den
Dogmen der politischen Ökonomie widrig waren, orientierten.
Dieses hatte zur Folge, dass sich verschiedene Organisationen bildeten, die die soziale Fürsorge
zum Ziel hatten.
[117] Dieser Erzählungsstil kann nicht nur
in den ersten Schriften Brepohls beobachtet werden, sondern
auch in all seinen Predigten. Er beschreibt konkrete
Tatsachen, wie das Zusammentreffen mit anderen Personen oder
Eindrücke über ein bestimmtes Ereignis ("ich habe es
miterlebt...” "ich bin dabei gewesen...''). Indem der
Erzähler so handelt, befestigt er seine Autorität, da er
sich nicht nur auf Informationen und Theorien festlegt,
sondern wie ein effektiver Schauspieler, der in die
Geschichte eingreift.
[119] Die für diese
Analyse ausgewählten Texte: BREPOHL, 1917a, 1921, 1923a,
1932b, 1933a, 1939 und FUGMANN & BREPOHL, 1927
[120] Wilhelm
Fugmann war ebenfalls protestantischer Pfarrer, Autor
verschiedener Artikel und zweier Bücher über die deutsche
Immigration. Er war auch Pastor in Ponta Grossa und - genau
wie Brepohl - ein Wissensdurstiger der deutschen Ethnologie
und Kultur. Siehe z. B.: FUGMANN, 1926 und 1929.
[121]
Der Verfasser weist auf die folgenden
Veröffentlichungen hin die diese Gemeinde für sich erworben
hat: "Der Kompass", "O Estado de São
Paulo",
"Deutsche Tageszeitung für Südbrasilien", "Stadt Gottes",'
"Ev. Lut. Gemeindeblatt", "Christenbote’', "Glocken der
Heimat", "Nachrichten von Lapa". "Wolgadeutschen
Monatshefte", "Der Volksbote". "Die neue Heimat", "Deutsches
Leben in Russland.
[122] Wir
können nicht entscheiden, ob diese beiden Bezeichnungen hier
als Synonym zu verstehen sind, oder ob Brepohl sich auf sein
Volk als seine Gläubigen einerseits und auf die Nationalität
eben dieses Volkes andererseits bezieht. Gleich, welcher
Art, es ist das einzige Mal, dass Brepohl das
Deutsch-Brasilianertum erwähnt. In späteren Texten lässt er
von diesen Bezeichnungen, deren Ausdruck eine doppelte
Staatsangehörigkeit vermuten lässt und benutz stattdessen -
wie auch der Alldeutscher Verband - die Begriffe
"Deutschtum" und "Auslandsdeutschtum".
[123] Brepohl
enthüllt, dass dieses Buch nicht nach dem
Original-Manuskript herausgegeben wurde, sondern verzerrt
zugunsten der jüdischen Ideen.
[124]
Nationalsozialistische Revolution und
Volksgemeinschaft. 1933(o)
[125]
Die ersten Veröffentlichungen Brepohls über die
Zigeuner, die aufgelegt wurden, als er in Ungarn lebte,
konnten wir nicht auffinden. Aber das Gedruckte der
dreissiger Jahre zeigt uns, dass eine seiner Interessen für
diese ethnische Gruppe der Tatsache entsprang, dass diese
ein endogames Verhalten zeigt - für Brepohl ein Wertsymbol
für ihre strikte Rassenerhaltung, (siehe: Brepohl, 1932 g,
1938 a)
[126] In dieser
Mission, musste Brepohl sehr oft in von Deutschland besetzte
Gebiete reisen: er unterhielt Briefwechsel mit
Kriegsgefangenen, schon wegen seiner Aufgabe, deutsche
Literatur zu verbreiten.
[127] Es ist
der Ausdruck, auf den sich die Geschichte der Gründung der
NSDAP bezieht, so wie er im Buch Mein Kampf schon benutzt wird.
Die Gründung, die keine Partei sondern eine Bewegung ist,
begann mit 7 Personen. Vom Volkstum durchdrungene Arbeiter
schufen die Keimzelle, aus der - unter der Leitung des
Führers - jene machtvolle Bewegung entstand, die dem
deutschen Volk die wahre Freiheit bringen würde (1933, S. 4)
[128] Nach
mündlichen Informationen von Martin Dreher waren die
protestantischen Pastoren jedoch nicht die am meisten
betroffenen, obwohl viele von ihnen, die dem
Nationalsozialismus beigetreten waren und unter denen sich
die Führung der NSDAP in Brasilien befand, deutsche
Staatsbürger waren. Aber da sie gute Beziehungen zu den
wichtigsten deutschen diplomatischen Vertretern und z.T.
auch zu brasilianischen Autoritäten hatten, gelang es ihnen,
das Ausreisevisum zu bekommen, oder aber die Garantie ihrer
Freiheit hierzulande. Wir forschten, ohne grossen Erfolg,
nach den Gründen, die Brepohl dieser Privilegien nicht
teilhaftig werden liessen. Durch eine indirekte Information
konnten wir feststellen, dass ab 1934 das Kanzleramt des
III. Reiches den Verdacht hatte, dass Brepohl seine
Veröffentlichungen nicht exklusiv der Verbreitung der
nationalsozialistischen Idee widme, oder, zu anderer Zeit,
diese übertrieben kompromittierend seien. (Memorandum der
Reichskanzlei an das deutsche Konsulat in Curitiba am 7. Nov. 1934. Nationalarchiv Koblenz (diese
Informationen erhielt ich dank der Gefälligkeit von Prof.
Dr. Ren6 Gertz)).
[129] Wir verfügen
nicht über alle Manuskripte Brepohls bzgl. seiner
Autobiographie, aber durch andere Quellen erfuhren wir, dass
nicht bestätigt werden kann, dass Julia die Tochter des
Bergwerkbesitzer gewesen sei. sondern die eines ungarischen
Grundbesitzers.