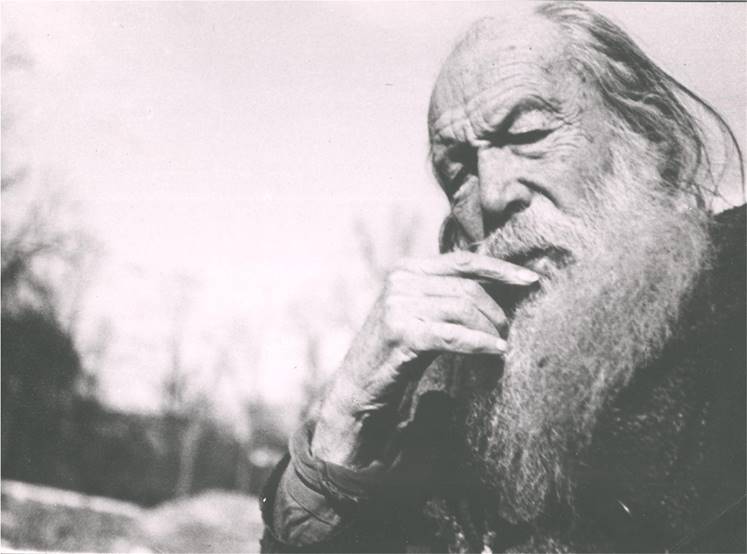
Ein moderner
Diogenes
Von Martin Müllerott
Müllerott, Bibliothekar an der
Bayerischen Staatsbibliothek- München, hat sich in den
Fünfzigerjahren des vorigen Jahrhunderts öfters mit Gräser
unterhalten. Ihm ist es zu verdanken, dass der Nachlass des
Dichters – und damit sein Lebenswerk – vor der Vernichtung im Müll
gerettet wurde. Sein Aufsatz war die erste Würdigung Gräsers, die
nach dessen Tod erschien. Der Aufsatz enthält einige
Unrichtigkeiten, weil dem Verfasser nur wenige Informationen zur
Verfügung standen. Sie wurden hier weggelassen oder in eckigen
Klammern berichtigt.
Er nannte sich einen Bildner und seine selbstgeschneiderte
Tracht, nun freilich alt und abgetragen, an die eines Franken aus der
Zeit Karls des Großen erinnernd, gab einen ersten Begriff von dem, um
was es ihm ging. Wer ihn sah, rätselte ein wenig an ihm herum oder photographierte ihn doch wenigstens; ab und zu
erschienen ein paar feuilletonistische Artikel über ihn, die es mit
der Wahrheit nicht allzu genau nahmen. Denn noch immer war die hohe,
sich nicht ganz gerade haltende Gestalt Gräsers, die schon Karl Arnold
1908 einmal für die „Jugend“ festgehalten hatte, eindrucksvoll genug,
um einen pikanten Reiz in einer Illustrierten abzugeben. Und ebensowenig
durfte der weiße Vollbart des Greises, den man in einem Café oder in
der Bayerischen Staatsbibliothek an seinen Gedichten herumbasteln sah,
in einem Bildband von Schwabing fehlen, jenes Schwabings, das froh
war, auch einen „Clochard“ sein eigen zu nennen. Nun, in der
toleranten Luft Münchens hat er in der Tat wiederholt gelebt und die
letzte gute Mandel Jahre bis zu seinem Tod im Oktober 1958 verbracht.
…
Halb belustigt, halb befremdet, nahm man Notiz davon, daß der Naturmensch die Rolltreppe nicht
verschmähte, um zum Hauptbahnhof zu gelangen, von dessen Kommen und
Gehen er rätselhaft angezogen schien. Tauchte er dann an der Tür des
Wartesaales auf, um einen Blick auf die Gäste zu werfen, dann wurde er
an diesem hektischsten Ort der Stadt zu einem unvergänglichen
Archetypus, dann war er ein moderner Diogenes, der einen Menschen zu
suchen kam: und so war es in der Tat.
Es war nicht schwer, mit ihm ins Gespräch zu kommen, eher
wartete er darauf, und wenn er einen mit ehrlicher Freude begrüßte
oder sich mit „Lebwohl" verabschiedete, so war man nicht nur von der
wohltönenden Stimme, sondern auch von der einen oder anderen
Formulierung überrascht. Sätze wie „Ich
lausche so ein wenig in die Dinge herein" oder „Ich
grabe nach Wurzeln, nach Wortwurzeln" mag man in hundert Jahren
gut und gern für apokryphe Heideggerworte
halten. Gar manchen Studenten hat er mit seinen Sprachgrübeleien – das
Wort „Narr“ hielt er z. B. für ein nicht weiter ableitbares Urwort –
sichtlich beeindruckt; hoffentlich übersahen solche Jünglinge den
inneren Frieden nicht, der sichtlich aus ihm leuchtete. Und wenn man
herumhörte, konnte man von manchem Schriftsteller oder Professor
erfahren, daß sie ihn kürzere oder
längere Zeit beherbergt hatten – aus Dachkammern wurde man ihn
angeblich nicht so leicht wieder los – und jeder bedauerte eigentlich,
daß er sich das Leben durch seinen Aufzug
so schwer gemacht habe. Aber: „Durch,
das
ist der Hecke Zweck“, wie er sich einmal in dem Stammbuch einer
Münchner Künstlergesellschaft verewigt hat, war seine Devise; Gusto
Gras, wie er sich zeitweilig nannte, wollte vor allen Dingen „ein Individuum, kein Plural sein“. Wenn man ihn nach seinem Leben
fragte, wich er aus. „An meinem
Leben ist nichts wichtig; der alte Icke, das Ichmichlein ist schon
lange gestorben.“
Immer aber gab er gern zu, daß
er aus Siebenbürgen stamme und auch einiges unter dem Namen Arthur
Siebenbürger veröffentlicht habe. Daß
er mit Michael
Georg Conrad, vor allem aber mit Johannes
Schlaf befreundet gewesen sei, das konnte man aber bei näherer
Bekanntschaft schon erfahren, und Johannes Schlaf, der seit der
Jahrhundertwende zurückgezogen und versponnen bei seiner Schwester in
Weimar lebte, ist von Gräser, dem Georg Klinghammer seines Romans
„Aufstieg“, sichtlich beeindruckt. „Der ist weiter als wir“, heißt es,
und mit einigen Artikeln „Ein neuer Dichter“ rührte Schlaf für Gräser,
in dem er einen Nachfolger Thoreaus’, einen Geistesverwandten W.
Whitmans sah, die Werbetrommel, die er eigentlich schon selber ganz
gut hätte brauchen können.
Darauf wird in Max
Geißlers „Führer“ [durch die deutsche Literatur des 20.
Jahrhunderts] Bezug genommen, und Gräser bestätigte die dort
angeführten Tatsachen, war aber mit dem Werturteil nicht zufrieden.
Auf die Ähnlichkeit einer Abbildung in Betttex
„Spiegelungen“ angesprochen, erzählte er einiges von seinem Bruder Carl Gräser und der
Naturmenschensiedlung auf dem Monte Verità bei Ascona – das müßte
auch noch mal richtig dargestellt werden – aber daß
er einer Gelehrtenfamilie entstammte, daß
insbesondere sein Großvater Andreas
Gräser als Superintendent gewirkt und ein kraftvoller Vertreter
des Deutschtums in Ungarn gewesen war, sein Vater als Bezirksrichter
geamtet, sein Bruder Ernst sich als Kunstmaler in Stuttgart einen Namen gemacht hatte –
das alles kam erst nach seinem Tode ans Licht.
Es war ein denkwürdiges Armenbegräbnis, mit dem sich der
Pfarrer, ein entfernter Landsmann des Verblichenen, viel Mühe gegeben
hatte, vom biblischen Leitspruch angefangen: „Das Leben des Menschen
ist wie ein Gras“ bis zu der hier besonders naheliegenden
Feststellung, daß man ins letzte
Geheimnis eines Menschen nicht hineinblicken könne.
So war es nun in der Tat, und so hatte es wohl auch früh
begonnen. Schon als kleiner Knabe soll er seine Mutter gefragt haben,
warum machen sich die Männer Frauengesichter, indem sie sich rasieren?
Im Februar 1879 geboren, hatte Gusto Gräser das Gymnasium in Kronstadt
[richtig: Hermannstadt] besucht, dann in Wien die Kunstschlosserei
erlernt, wie es dann aber weiterging, nachdem er bei einem kunstge-werblichen
Wettbewerb
[der Weltausstellung von Budapest 1896] einen Preis gewann und bald
darauf dem kleinlichen Meister, für den er nicht mehr länger das
Frühstück holen wollte, durchgegangen war, das läßt
sich in der perspektivischen Verschiebung von beinahe 70 Jahren nur
noch ungefähr ausmachen. Seine künstlerische Ausbildung kann nicht
sehr lang gedauert haben, denn Gräsers Steinzeichnungen haftet, was
allerdings zum Teil auch ihren Reiz ausmacht, etwas Ungelenkes an; der
Predigerton fehlt selten, etwa wenn das aufbrechende Volk, von einem
rüstigen Großvater angeführt, der das strahlende Enkelkind auf den
Schultern trägt, den im Hintergrund rauchenden Fabriken den Rücken
kehrt und den Spaten schultert, um das Land zu bebauen…

Eine ähnliche Vision vor Augen zog in der Fin de siècle-Stimmung
eine
Schar von Kulturmüden, unter ihnen der belgische Millionärssohn Ödenkoven,
der ehemalige k.u.k. Oberleutnant Carl Gräser und sein Bruder Gustav, die aus Wien stammende Pianistin
Hofmann und ihre Schwester
über die Alpen, um eine Siedlung neuen Menschentums zu gründen. Es
waren die Gebrüder Gräser, die den Platz für das zukünftige
anarchistische Gemeinwesen auf dem später sogenannten Monte
Verità auskundschafteten, das ganz auf freiwilliger Mitarbeit
und „ohne Zwang“ aufbauen sollte. Denn also hatte schon der Bund
geheißen, den Carl Gräser in der Langeweile der galizischen Garnison
Przemysl gegründet hatte. Sein Vorgesetzter, der Erzherzog
Leopold von Toskana,
war bald dazugestoßen, weil ihm die Antwort Carl Gräsers, die als
vorschriftswidrig beanstandete Barttracht sei naturgewollt und
keinesfalls wolle er in ihr Walten eingreifen, gar sehr imponiert
hatte. Nach der Familientradition war es Gusto, der den älteren,
gesell-schaftlich umgänglicheren
aber auch schwermütigen Bruder Carl zum Naturmenschentum bekehrte.
Wenn er also mittelbar zu einem der Katalysatoren des Standesverzichts
des Erzherzogs, des späteren Leopold
Wölfling, wurde, der auch eine Zeitlang auf dem Monte Verità
lebte, so hat er sichtlich in das Rad der Geschichte eingegriffen.
Die Atmosphäre dieser anarchistischen Siedlung, in der man,
wohl von G. Landauer
angeregt, die Ansicht verfocht, daß man
alles, was man zum Leben brauche, selbst erzeugen müsse, an der Natur
so wenig wie möglich verändern dürfe und das Geld nicht gebrauchen
solle, hat Erich Mühsam
prächtig eingefangen. Nicht unkritisch gegen die einzelnen Teilnehmer,
hielt er offensichtlich etwas von der Idee, die sich nicht realisieren
ließ. Ödenkoven war so vorsichtig
gewesen, das Grundstück auf seinen Namen eintragen zu lassen und
betrieb in der Folge das Unternehmen als eine nicht eben billige
Naturheilanstalt, die zahlreiche berühmte Gäste anzog. Die Gräsers
aber lebten weiter konsequent nach dem Prinzip des Tauschhandels, sodaß die Lebensgefährtin Carl Gräsers den
unbedingt nötigen Zahnarzt einmal mit dem Gesang einiger Lieder
bezahlen mußte.
…
Auch Gusto hielt es sein Leben lang ähnlich. Bis ans Ende
seiner Tage dankte er für jede erwiesene Gastlichkeit mit dem Vortrag
seiner Gedichte. Aber ist das so ganz abwegig? Hat nicht Schiller
einmal gesagt, daß gemeine Naturen mit
dem zahlen, was sie tun, edle mit dem, was sie sind? Die Schwierigkeit
ist nur, daß man sich über den Tauschwert
geistiger Güter, über die Gaben der Persönlichkeit, aber auch über
Spruchkarten und Steinzeichnungen weniger leicht einigt als über den
Wert von Gartenfrüchten. Gustav betonte immer wieder, daß
er auch „ohne Geld gedeihe“,
die Anekdote aber, die ein Stuttgarter Freund von ihm berichtet, daß er einmal einen größeren Geldschein, den
er auf der Straße gefunden, mit den Worten „Das
Geld,
das schnöde Geld“ wieder fortgeworfen habe, hat sich wohl kaum
zu der Zeit zugetragen, da er für eine Familie sorgen mußte.

Es war um das Jahr 1908, als Gräser anläßlich
einer Vortragsreihe, die er in Wien hielt, auf seine um ein paar Jahre
ältere Lebensgefährtin Elisabeth
Doerr traf, die Tochter eines
Mainzer Redakteurs, von der es im Roman „Aufstieg“ heißt, „daß
sie schon länger so lebe als er.“ Aus dem selbstgebauten Haus in
Siebenbürgen, das sie planten, ist wohl nichts geworden, dafür zog er
eine Zeitlang mit einem selbstgebauten Reisewagen, zeisiggrün
angestrichen und mit Sprüchen versehen, durch die Lande, wie das J.
Schlafs Erzählung „Fruchtmahl“ beschreibt, die auch seine vielfachen
Beziehungen zur Wandervogelbewegung erwähnt und seine Gewandtheit in
der Diskussionsführung sichtbar werden läßt,
mit der es ihm gelang, das Gespräch immer wieder an sich zu reißen.
Als Familienvater hat Gräser wohl die meisten Kämpfe mit den
Behörden ausfechten müssen, denn natürlich hatte er die Familie „ohne
Zwang“ und ohne Standesamt gegründet, selbstverständlich schickte er
die Kinder nicht in die Schule, die dennoch Lesen und Schreiben
lernten, und ebensowenig kümmerte er sich
um einen Gewerbeschein, wenn er seine Gedichte, Spruchkarten und
Steinzeichnungen vertrieb, „man
gibt, was man gibt“. Und die Polizei, in der wie in jeder
Behörde etwas von einer Primitivperson steckt, die also wie ein
kleiner Junge zum Angriff übergeht, wenn sie etwas nicht versteht und
sich nicht fürchtet, wies ihn aus, sobald sie eine Handhabe fand. So
wurde er 1911[richtig:1912] aus Leipzig wegen Verbreitung unzüchtiger
Schriften ausgewiesen, weil er eines seiner Kinder als kleinen
Nackedei auf dem Pferd reitend photographiert
hatte. Freunde aus der Jugendbewegung behängten daraufhin den zeisiggrünen
Reisewagen mit Korsetten, Büstenhaltern, Modellpuppen und ähnlichen
Attributen und gaben ihm so unter Klampfenbegleitung
das Geleit bis zur Stadtgrenze.
Es ging wohl nicht immer so spektakulär und glimpflich
zugleich ab, immer wieder aber fand er Fürsprecher, die für ihn
eintraten, und es waren darunter wahrhaftig auch solche, die dabei
nicht einmal an die eigene „Publicity“ dachten, wie Richard
Dehmel, Gerhart Hauptmann, Max
Klinger, Thomas Mann und Hans
Thoma. In solcher Situation [tatsächlich in der Nazizeit] ist
vermutlich auch das folgende Gedicht entstanden …
Gebührt nicht diesem Dichtersmann
Ein Freipaß
durch das Land?
Sonst fällt, wie jüngst schon
wieder,
Er, doch getreu und bieder,
Er, Mund der Heimatlieder,
Dem Büttel in die Hand.
Wer tilgt die Schand?
Wer löst Urheimatsohnes Pein,
Daß er sein Herzwerk
wirke
Uns alln
zum Frohgedeihn?
Kolkrab, Bussard ziehn
frei im Land,
Weil sie zu sterben drohten.
Wer hält ob diesem Boten
Des Wildheils seine Hand?
Während des ersten
Weltkriegs wurde Gräser von Stuttgart aus nach Ungarn ausgewiesen,
doch scheint ihm keine Uniform gepaßt zu
haben oder kein geeigneter Feldwebel für ihn verfügbar gewesen zu sein
[er verweigerte den Kriegsdienst], denn eine Notiz der Schweizer
Zeitung „Der Bund“ vom 19. Januar 1917 brachte einen Gabenaufruf von Hermann Hesse für den mit
seiner Familie in Askona lebenden Gräser
und belegt damit sein ziviles Dasein. Von einem selbstgebauten
Einbaum, mit dem er über den Langensee gefahren sei, ist anderswo die
Rede. J. Flach erwähnt die ihr Kind auf der Straße stillende Frau Gräser
als seinen ersten Eindruck von Ascona, und die Freiheit, welche die
Kinder „ohne Zwang“ genossen, ist ebenfalls in die Erinnerungen an
dieses Idyll eingegangen.
Es ging 1919 schnell
zu Ende, als ihn die Schweizer Fremdenpolizei in einem Aufwasch mit
anderen, die sich lästig gemacht hatten, des Landes verwies. Gräser
lebte nacheinander in München, Berlin und Dresden und man sah ihn als
einen der vielen, die um 1920 die „Messiasseuche“
ausmachten. Er pflegte sich damals Arthur
Siebenbürger zu nennen, hielt als „Volkwart“ allwöchentlich Gesprächsabende
in der Aula des Königstädter Gymnasiums am Alexanderplatz ab, und die
Lokalreporter bemerken, daß er mit seinen
Appellen „Zurück zur Natur und
zum deutschen Volkstum“ auch Eindruck auf die „verbittertsten Kreise des Proletariats“ machte, die mit dem
Abzeichen der Kriegsdienst-verweigerer gekommen waren.
„Er schreitet in selbstverfertigtem Gewand, er geht mit
wallendem Haupthaar, er verteilt Sprüche und verbreitet eine
Atmosphäre um sich, die halb achtung-gebietend,
halb komisch wirkt. Seine biblischen Prophetenzüge gehen ins
Altgermanische, ins Wotanspriesterhafte.
Immer gewaltiger tönt sein sonorer Baß
durch den Raum, die rollenden Rs passen
gut zu dem kindlichen Wald- und Naturmenschenpathos mit den ein
wenig skurrilen Wortbildungen, den Assonanzen, den plötzlich
eingestreuten schwerfälligen Verszeilen“. …
Mitte der zwanziger
Jahre [richtig: 1918] trennte sich sein Weg von dem seiner Frau und
seiner Töchter, die wohl mehr in bürgerliche Bahnen einbogen, auch
sollen weltanschaulich-religiöse Gründe eine Rolle gespielt haben.
Gräser wandte sich [1926] erneut nach München, das ihn zur Zeit der
Räterepublik ausgewiesen hatte. Thomas Mann bestätigte ihm im Dezember
1926: „Dieser Mann ist reinen Herzens und liebt Deutschland. Er meint es gut
und freundlich mit uns, und gut und freundlich sollte man ihm
begegnen“. Ob es Erfolg hatte steht dahin [es hatte Erfolg: die
Ausweisung aus Deutschland wurde in eine solche aus Bayern
abgemildert], eine geplante Feierstunde für Michael Georg Conrad, den
„wackeren Achtziger“, wurde jedenfalls verboten, auch saß er wieder
einmal im Arrest.
Er hatte vielerorts
Freunde. 1929 soll er den Vagantenkongreß
in Stuttgart besucht haben [er trat dort als Redner auf]. In der Zeit
vor dem zweiten Weltkrieg steuerte er einmal auf die Wohnung eines
Münchner Schriftstellers zu, der ihn gerade noch kommen sah und sich
verleugnen ließ. Der Naturmensch zeigte sich der Lage gewachsen, rief
den Hausherrn von der nächsten Telefonzelle an und ermahnte ihn mit
sonorer Stimme, das nächste Mal doch mehr bei der Wahrheit zu bleiben.
Dann warf er dem Schriftsteller noch ein Gedicht in den Briefkasten,
in dem die Verse standen: „Sieh, du willst den Mensch beschreiben; kommt er, muß
er draußen bleiben.“ Er tauchte noch in mancher Stadt
Deutschlands auf, bevor er um 1940 [richtig: 1938] ein altes Hausboot
auf der Havel [richtig: auf dem Langen See bei Berlin-Eichwalde]
erwarb, behielt aber auch diese Bleibe nicht lange. Die letzten Jahre
seines Lebens verbrachte er, von den Zeitläuften verhältnismäßg
unangefochten, in einer Dachkammer im Münchner Stadtteil Freimann.
Vielleicht hat der Name den Ausschlag gegeben.
In dieser Zeit ist
auch eine Bilderserie entstanden, die das Münchner Stadt-museum von
ihm, dem „Einsiedler“, anfertigen ließ. Eine Illustrierten-Abbil-dung
aus
den fünziger Jahren zeigt ihn, einen
strahlenden bukolischen Alten, von Blumengirlanden und Früchtekörben
umrankt, zwischen Maiskolben und Weintrauben auf der selbstgezimmerten
Lagerstatt. Ein fröhliches Bild, das nachdenklich stimmt. Gut, daß wir es haben. Denn … ihm nur die Position
der lächerlichen Person zuzuweisen, ohne welche die Gesellschaft
freilich nicht auskommen kann, wäre lediglich eine verfeinerte Form
der Ablehnung, mit der man sich die Einsicht in dieses Leben verbauen
muß. Uns scheint zwar, als ob dieses sein
reibungsreiches Leben einen großen Teil seiner schöpferischen Kräfte,
seiner zweifellos vorhandenen künstlerischen Begabung verbraucht und
vergraben habe. Auch schließt die Notwendigkeit, alles selbst zu tun,
wohl die Spitzenleistung auf einem oder wenigen Gebieten aus, so wie
der freistehende Baum sich kugelförmig allseits ausbreitet, aber
niemals so hoch wird wie der im Kronenschluß
gewachsene. Doch bei diesen negativen Aspekten allein darf es nicht
bleiben! Auch Diogenes hat ähnlich gelebt und die Welt dennoch
bereichert. In des bedürfnislosen Gustav
Gräsers Dachkammer standen die Bleistifte in den Löchern eines
zerbrochenen Hohlziegels und die Stopfnadeln waren in dem Gefilz
eines Vogelnestes untergebracht.

Gräsers Schreibtisch in Freimann
Es ist wohl nicht
überliefert, welches Verhältnis Diogenes zu diesen Gebrauchs-gegenständen
hatte, wenn er dergleichen überhaupt verwendete, aber einfacher hätte
auch er das Problem ihrer Aufbewahrung nicht lösen können. Vielleicht
hat ihn sein selbstgewähltes Leben vor Manchem bewahrt, hat ihn seine
Kutte getragen wie das Ordenskleid einen Mönch. Es könnte sein, daß sich sein Unbewußtes
mit Traumsicherheit die einzig für ihn zuträgliche Lebensform gewählt
hatte.
Was bedeutete er der
Mitwelt? Auch hier empfiehlt sich Aufgeschlossenheit! Gräser, der so
manchen Zug eines alttestamentlichen Propheten aufweist, hat sich in
seiner Bedürfnislosigkeit von dem genährt, was die Bücher Leviticus
und Deuteronomium für die Witwen, Waisen und Fremdlinge an den
Feldecken und in den Weinbergen aus Vergeßlichkeit
übrig zu lassen befahlen. Die Biologen meinen, daß
diese leichte Verschwendung, auf eine Milderung des Konkurrenz-kampfes
zielend, letztlich gute Früchte bringe…
Und wer will sicher
sagen, ob der Archetypus, den Gräser verkörperte, nicht doch auf die
Menschen einwirkte? Ob nicht bei dem einen oder anderen der stumme
Protest des Diogenes gegen den Kult des äußeren Wohlstands Widerhall
fand? Ob die Medizin, die er der Menschheit in allopathischer Form
reichen wollte, nicht doch in homöopathischer Dosis genommen wird?
Aus Martin Müllerott: Gusto Gräser – Prophet auf Spruchkarten.
In: Südostdeutsche Vierteljahresblätter, München 1964, Folge 4, S. 193-198