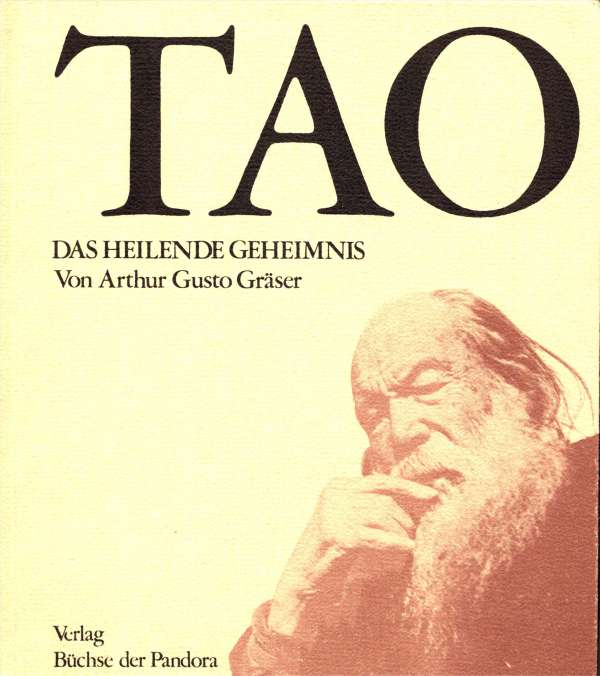Zurück |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alexander Ulars „Weg des Lao Tse“ Eine Vorlage für Gräsers Tao-Dichtung
Wir
wissen darüber nichts Konkretes, wie können nur Wahrscheinlichkeiten
rekonstruieren. Seine
erste Besprechung chinesischer Literatur lieferte Hermann Hesse im November
1907 ab, also ein halbes Jahr nach seinem Zusammensein mit Gräser
in der Grotte von Arcegno. Das lässt aufmerken. Er schreibt darin: „Aus China
hat der Verlag früher eine schöne Übersetzung der Sprüche des Lao Tse
gebracht“. Adrian Hsia kommentiert in ‚Hermann Hesse und China’:
„Dies ist Hesses erste Rezension eines chinesischen Buches. … Für die Datierung
der ersten Begegnung Hesses mit China ist der erste Satz wichtig. Der dort
erwähnte Verlag ist der Insel Verlag, der 1903 – also noch vor 1907 – nur
Alexander Ulars Nachdichtung von Lao Tses Tao Te King
unter dem Titel Die Bahn und der rechte Weg des Lao Tse
herausgebracht hatte“ (Hsia: HH und China, S.14). Damit
ist nicht gesagt, dass Hesse dieses Buch schon 1903 gelesen hätte. Eher sieht
es danach aus, dass er sich erst seit 1907 mit chinesischer Literatur befasste
und dabei auch auf die Nachdichtung von Ular stieß. Oder umgekehrt: Dass Gräser
ihn auf Ular aufmerksam machte und Hesse sich zunächst mit der ihm näher
liegenden Lyrik von Li Tai Pe beschäftigte. Als sicher anzunehmen ist
jedenfalls, dass beiden zur Zeit ihres Zusammenseins Laotse bekannt war oder
bekannt wurde. Gräser möglicherweise schon früher durch die Auszüge aus Laotse
des Theosophen Franz Hartmann, der 1901 auf dem Monte Verità gastiert hatte. Ob nun seit 1901, 1903 oder 1907 – soviel
ist klar, dass Gräser lange vor 1911 mit Laotse und speziell mit der
Nachdichtung von Ular bekannt gewesen sein muss. Damals, in den Jahren seiner
Einspännerei und Einsiedelei bei Arcegno und auf dem Monte Verità, hatte er
sowohl die Muße wie die Mittel, sich in die Sprüche Laotses zu versenken. In
der Behausung seines Bruders stand ihm eine umfangreiche Bibliothek
reformerischer und esoterischer Literatur zur Verfügung, die sowohl die
Schriften von Franz Hartmann wie das Buch von Ular enthalten haben dürfte.
(Hesse erwähnt staunend diese Bücherei!) Waren doch diese rebellischen
„Wahrheitssucher“ dringend darauf angewiesen, Zeugen zu finden, die ihr Anderssein
und Anderswollen unterstützen konnten. Die Upanishaden konnten ihnen helfen und
eben auch Laotse. In der Zeit zwischen etwa 1906 und 1913, also in einer siebenjährigen Schwangerschaft, dürfte die Frucht von Gräsers Dichtung herangereift sein. Ular und nicht Wilhelm war ihm wohl die früheste und auch die zusagendste Quelle. Hesse nennt sie „poetischfrei“ – und eben diese poetische Freiheit war es, die Gräser anzog, während mehr akademisch-philologisch ausgerichtete Geister bedenkenvoll die Stirn runzelten. Ular war ihnen zu frei (in mehrfachem Sinne) – und Gräser auch.
Es
ist offensichtlich – die zum Teil wörtlichen Übernahmen belegen es -, dass Ulars Übersetzung für Gräser die
wesentliche Vorlage war, weit mehr als die von Richard Wilhelm. Sie ist auch
die weit poetischere, Wilhelm wirkt im Vergleich steif, schwerfällig, abstrakt
und trocken. Schwer begreiflich, warum Hesse die wilhelminische besonders
schätzte. Noch unbegreiflicher, dass er die von Gräser nie erwähnt. Verdrängt
wurde auch Ular aus dem deutschen Geschichtsbewusstsein. Obwohl er ein
hochbegabter Sinologe war, der schon als Zwanzigjähriger chinesische Gelehrte
über Laotse belehren konnte, obwohl er wichtige kulturvergleichende Werke über
Russland und China verfasste, die heute
- nach hundert Jahren! - wegen ihrer unerloschenen Aktualität wieder neu
aufgelegt werden, ist er selbst in der Fachliteratur weitgehend vergessen oder
wird verschwiegen. Ular emigrierte um 1900 nach Frankreich, vermutlich
abgestoßen von der dumpfen Servilität der Deutschen, dem frankophilen Geschmack
des bewunderten Nietzsche folgend. Schon 1903 hat er in einem Aufsatz auf die
überraschenden Übereinstimmungen in den Gedankenwelten von Nietzsche und Laotse
hingewiesen. Er starb, erst 43jährig, 1919 in Marokko. Im Unterschied zu
Nietzsche, so schrieb er 1903, habe Laotse nicht „in erschütterndem Kampf,
sondern in lächelnder Überlegenheit den Prachtbau unserer albern
zusammengeträumten Geistesgröße dem Staube“ gleichgemacht. So dachte sicher
auch Gusto Gräser, an den Ular auch in seiner hochgemuten, offenen,
unerschrockenen Redeweise erinnert. Die fast Gleichaltrigen könnten sich im Sommer
1900 in Paris begegnet sein. Die Wiederkehr des Alexander Ular
1976
1923
2012
1905
1906 und 2009
2009
Aus dem
Nachwort von Alexander Ular: "(Die)
Europäer ... machten sich mit dem ganzen Dünkel philologischen und
philosophischen Besserwissens über den alten toten Meister her. Sie unterwarfen
ihn wissenschaftlicher Analyse; sie sezierten ihn philologisch, reduzierten ihn
zum bloßen linguistischen Präparat, wickelten ihn in unzählige Fußnoten,
Varianten, angeblich kritische Bemerkungen und chinesische Kommentare, und
verleibten ihn so den Totenkammern der Literatur, den Bibliotheken, ein. Und
dann geschah das Furchtbare - der von den Philologen ganz falsch sezierte
Lao-Tse wurde von angeblichen Philosophen, die von jener Anatomenarbeit nichts
verstanden, wieder zusammengesetzt und nun als Zerrbild seiner selbst in
hahnebüchenen Formen dem achselzuckenden Publikum vorgef'ührt. Stanislaus
Julien, der große französische Sinologe, versuchte sich als erster am Texte des
Tao-Te-King, dem schwierigsten Texte, den die Chinesen kennen. Seine Arbeit
ist, als erste, großartig; bloß strotzt sie von Irrtümern und gefährlichen
Interpretationen, die damals unvermeidlich waren. Weniger entschuldbar ist
jedoch, daß ausnahmslos alle späteren Sinologen, die den chinesischen Originaltext
zu übertragen suchten, den grundsätzlichen Fehler des großen Franzosen und der
chinesischen Kommentatoren des Lao-Tse wiederholten. Dieser Fehler
besteht darin, daß man ganz die Zeit der Wirksamkeit des alten Meisters vergaß.
Lao-Tse hat vor fünfundzwanzig Jahrhunderten gelebt, und man liest seine
Schrift, als wäre sie gestern geschrieben. Sicherlich: nirgends ist ein solcher
Irrtum verführerischer als im Chinesischen. Denn heute werden dieselben
Hieroglyphen benutzt wie zur Zeit Lao -Tses. Das Schriftzeichen, welches damals
Pferd bedeutete, bedeutet es heute noch. Und ein Kochtopf wird schriftlich
heute noch mit dem Schriftbild bezeichnet, das Lao-Tse verwandte. Aber was vor
fünfundzwanzig Jahrhunderten ein Pferd war, ist auch heute noch ein Pferd; und ein
Topf bleibt in alle Ewigkeit ein Topf. Abstrakta dagegen ändern ihren Sinn,
wenn sich die Menschen ändern. Sie werden stets im Anfang durch sinnliche
Symbole oder durch Analogien mit menschlichen Verhältnissen ausgedrückt. Diese
Symbole werden in der Sprache beibehalten, während ihr Inhalt sich mit der
Geistesverfassung der Menschen ändert. Und so trifft schließlich der
ursprüngliche Sinn des symbolischen Ausdrucks nicht mehr den Sinn, der später
ausgedrückt werden sollte, ja verkehrt ihn oft in sein Gegenteil. Und man
versteht die alten Texte ganz falsch, wenn man ihren sprachlichen Ausdrücken
für Abstrakta den Sinn beilegt, den sie jetzt haben, anstatt festzustellen,
welchen Sinn sie zur Zeit der Niederschrift des Textes wirklich gehabt haben. Was bedeutet
z. B. das lateinische Wort virtus,
und was das französische vertu
und das deutsche Tugend? Das
französische hat, im Singular gebraucht, fast ausschließlich den Sinn
weiblicher geschlechtlicher Enthaltsarnkeit. Es ist das genaue Gegenteil des
lateinischen virtus geworden, das nichts anderes bedeutet als Mannhaftigkeit,
oder Typisches am Manne. Das deutsche Tugend bedeutet
sprachlich eigentlich nichts weiter als Tauglichkeit, Tüchtigkeit, Fähigkeit
zur Tat, während es gerade umgekehrt nunmehr die Fähigkeit bezeichnet, Triebe
zur Tat zu inhibieren. Wer die virtus eines Mucius Scävola mit der vertu einer
Pariser Arbeiterin verwechselt oder die Tugend Siegfrieds für dasselbe hält wie
die Tugend einer treuen Gattin, macht sich lächerlich. Ebenso
lächerlich ist es, einer chinesischen Hieroglyphe, die unverändert durch die
Jahrtausende gegangen ist, in einer Schrift des grauen Altertums denselben Wert
und dieselbe Bedeutung beizulegen, die der moderne Chinese ihr zuschreibt.
Diesen Fehler haben die Philologen an Lao-Tse begangen. Sie haben
vernachlässigt, festzustellen, welchen Sinn die Hieroglyphen, die den
Tao-Te-King zusammensetzen, im sechsten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung
besessen haben. Sie haben vor allem vergessen, daß die chinesische Schrift eine
Bilderschrift ist, in der im Altertum natürlich der Sinn jedes Bildes dem
Gegenstande, den es darstellt, viel näher stand als jetzt. Zur Zeit des Lao-Tse
war der bildliche Sinn aller der Schriftzeichen, die nicht unmittelbar als
phonetische Eselsbrücken erkennbar sind, viel weniger abgeschwächt als jetzt,
und der ursprüngliche Sinn des Bildes ist bei dem hohen Alter des Textes der
einzig annehmbare. Die
Hieroglyphe "Tao" z. B., die von Lao-Tse zur Bezeichnung des Prinzips
seines Systems gebraucht wird, stellt einen ausgetretenen Weg, eine Bahn dar,
und wer das Wort mit "Allvernunft" oder gar Gott übersetzt, begeht
eine schauderhafte Umdeutung auf der Grundlage modern infizierter und noch dazu
indoeuropäischer Vorurteile. Ebenso hat die Hieroglyphe "Te" niemals
Tugend bedeutet, als welche sie beharrlich übersetzt wird; sie setzt sich
zusammen aus dem Bilde des Geradeausgehens und dem Bilde des Herzens; sie
bedeutet also das seelische Geradeausgehen, den Rechten-Weg des Lebens, oder in
beschränkterem Sinne allerhöchstens die "Geradheit". Diese beiden,
wirklichen Begriffe von "Bahn" und "Rechtem Wege" haben mit
dem, was wir uns gemeiniglich unter "Allvernunft" und
"Tugend" oder gar unter "Gott" und "Sittenreinheit"
vorstellen, absolut nichts zu tun. Meine Übertragung des Tao-Te-King behandelt
jede Hieroglyphe des Textes in ähnlicher Weise. Und ich habe hiermit zu
meiner Freude an vielen Stellen klaren Sinn und tiefe Weisheit gefunden, wo die
chinesischen Kommentatoren Unverständlichkeit und die westländischen Philologen
nur zu oft blödes Geschwätz fanden. Es ist hinzuzufügen, daß die auf uns
gekommenen chinesischen Kommentatoren, die zum philologischen Studium des
Textes als Autoritäten nur zu oft herangezogen worden sind, sämtlich zu einer
Zeit geschrieben haben, da die Philosophie des Lao-Tse längst verloren war und
der Sinn der Hieroglyphen für Abstrakte, sowie die Syntax, sich stark geändert
hatten, so daß sie zum Verständnis des Textes ebensowenig in Betracht kommen,
wie beispielsweise die mittelalterliche Scholastik zur Exegese von Bibeltexten.
Das Schlimmste aber für Lao-Tse war die vielfache Überarbeitung der falschen
philologisch sezierten Übertragungen des Tao-Te-King durch Juristen,
Philosophen, Orientalisten und Schriftsteller, die das Chinesische nicht beherrschten.
Solche Bearbeitungen, Kritiken und Darstellungen gibt es fast nur in
Deutschland. Wir haben Lao -Tses in volkstümlichen gereimten Versen, ja wir
haben sogar einen in Knittelversen, dessen sich einer der berühmtesten
deutschen Juristen schuldig gemacht hat. Lao-Tse ward zugleich eine leichte
Beute der Indianisten, die mit Vergnügen in den ihnen vorliegenden irrtümlichen
Übertragungen Wörter wie "Allvernunft", "Askese", ja sogar
"Nirvana" feststellten und nunmehr von hoher Warte herab dozierten, Lao-Tse
sei eine Art Buddhist (obwohl er vor Buddha lebte), oder seine Philosophie sei
die des Vedânta oder der Upanishaden (die fast das genaue Gegenteil der Ideen
des Lao-Tse lehren). Aber Lao-Tse interpretiert das Leben, während die
Inder immer nur das Hinter-dem-Leben interpretieren. Und es ist nichts als
unberechtigtes Ausdehnenwollen der Macht der indoeuropäischen Gedankenwelt,
wenn man in Lao-Tse Indisches hineinliest. Es ist so weit gekommen, daß selbst
der große Deussen, der ganz im Indischen aufgeht, vermeint, der Tao-Te-King sei
eine (indoeuropäische) Palme über dem Gestrüpp des (echtchinesischen)
Konfuzianismus, während in Wirklichkeit Lao-Tse womöglich chinesischer ist als
Kong-Tse, nur daß jener sich zu diesem verhält wie etwa Kants "Kritik der
reinen Vernunft" zu Knigges ‚Umgang mit Menschen’. Manche
dieser Gelehrten, die Lao-Tses Stellung in der Geschichte der menschlichen
Ideen haben feststellen wollen, ohne selbst den Text des Tao-Te-King bearbeiten
zu können, haben natürlich in meiner zum ersten Male vor Jahren in
französischer Sprache erschienenen Übertragung ihren Lao-Tse nicht
wiedergefunden und vergnüglicherweise aus diesem und dem weiteren Umstande, daß
ich philologische Fußnoten, Varianten und Kommentare in meinen Arbeitsheften
behalte, geschlossen, daß ich ebensowenig das Chinesische beherrsche wie sie,
und daß daher meine Arbeit für sie nicht in Betracht kommt. Aber jedenfalls
habe ich den Beifall der chinesischen Gelehrten, denen ich an Ort und Stelle
die wesentlichen Stellen des Textes, den sie nicht verstanden, in dem nach der
oben beschriebenen Methode gefundenen Sinne ins Neuchinesische zurückübersetzt
habe, und denen es dabei wie Schuppen von den Augen fiel. ... Meine Übertragung ist
für Leser, nicht für Philologen, für Menschen, die den Geist des Werkes, nicht
für Gelehrte, die die Kritik des Buches suchen.“
Alexander Ular: Die Politik. Hg. von Martin Buber in der Reihe 'Die Gesellschaft', 1906. Neu herausgegeben und kommentiert von Gunter Schubert, 2009. Besprechung: Eine Untersuchung über die "völkerpsychologischen
Bedingungen gesellschaftlicher Organi-sation" nennt Alexander Ular seinen
kulturvergleichend angelegten Essay über das Wesen der Politik und ihre
Funktion in der modernen Gesellschaft. Was sich in Ulars Text entfaltet, ist
jedoch weniger eine Theorie des Politischen als eine allgemeine Kulturtheorie. Bei Ular steht die Politik der Kultur feindlich gegenüber: Sie
zwingt den Menschen unter eine oligarchische, autoritäre Herrschaft, die jedoch
nichts anderes ist als die Inkarnation seiner ureigenen religiösen Bedürfnisse.
Kultur ist gegenüber der Politik subversiv,
begehrt gegen ihr Diktat auf und kündet von der individuellen Freiheit. Alle Politik, so Ular, ist Religion, und alle Politik
gewordene Religion führt zur Entmündigung des Individuums. In Politik und
Gesellschaft Chinas, so Ular, zeigt sich eine neue Zeit. Gunter Schubert kommentiert den Band von Ular aus einer heutigen
politikwissenschaftlichen Sicht und kontrastiert Ulars Thesen mit der
historischen Entwicklung Chinas. Nationalismus und Religion, so Schubert,
spielen in China bis heute eine Rolle, ihre von Ular vorhergesagte Überwindung
ist in dieser Form nicht geschehen - mit entscheidenden Folgen für den Begriff
des Politischen. Zeitschrift für Politikwissenschaft, HR 5.46; NR 5.42, 2.2, 2.68 2009 Ular als
Prophet
ECONOMIC
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zurück |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||