Ein Wanderer im Gebirge
Es gibt ein Gedicht von Hauptmann, in dem eine Erinnerung an Gräser festgehalten sein könnte. Das Gedicht hat den Titel 'Legende' (CA IV, 163). Es wurde am 8. Dezember 1909 niedergeschrieben.
 |
 |
 |
Wie
eine Bestätigung dieser Vermutung erscheint nun, dass Hauptmann ein
halbes Jahr
später ein Gedicht niederschreibt, das die Begegnung mit einem Wanderer
erzählt, einem Wanderer von ungewöhnlicher Art. Hauptmann legt die
Begegnung
ins Dämmerlicht der Legende, offenbar um dem
Wunderbaren, Märchenhaften, ja "Überirdischen" der Erscheinung
gerecht zu werden.
Das Gedicht ist mit 'Legende' überschrieben und erzählt von einem armen Holzfäller, der in stürmischer Nacht Schritte vor seiner Hütte hört.
Da draußen ist einer, ärmer als ich!
Und sieh: des Kienspans Flackerlicht
leuchtet einem ins Angesicht.
Der war halbnackt und schwieg und stand
und regete weder Fuß noch Hand.
Aber er war von solcher Statur,
daß unser Holzfäller bei sich schwur:
hier winke ein weidlicher Gotteslohn,
er sei ein verirrter Königssohn! -
Die Wasser tosten zu Tale hinab.
Der Fremde kratzte die Sohlen ab,
schritt durch den holprigen Flur so leis
wie einer, der alle Wege weiß,
saß nieder am qualmigen Herde zur Rast
und ward des armen Konzen Gast. ...
Was ist das Besondere an diesem Wanderer und Gast? - Wie erfahren nicht mehr als: er ist arm, ärmer als ein Holzknecht, der immerhin seine eigene Hütte hat; er ist halbnackt, aber er wirkt wie ein verirrter Königssohn. Er lässt sich nicht herab zu bitten, er steht nur und schweigt. Er ist offenbar von großer Statur, alles andere als kümmerlich. Und er hat eine Art sich zu bewegen, die ebenfalls königlich ist: er schreitet auch dort noch, wo es holprig ist, und sein Gehen ist ein wissendes, ein bewusstes, ein tänzerisches Gehen: ein "Wandeln" fast.
Gräser ist ein besitzloser Wanderer, der allenthalben darauf angewiesen ist, an den Türen anzuklopfen und um ein Nachtlager zu bitten. Er ist hoch gewachsen und er geht halbnackt, wie gerade ein Dokument aus dem Sommer 1909 bezeugt. Am 24. Juli meldet die 'Tessiner Zeitung':
„Gusto Gräser in Locarno verhaftet.
In der Via Romagna wurde gestern nachmittag der bekannte Propagandist der Nacktkultur Gustav Gräser verhaftet. Er trug eine allerdings im höchsten Grade auffällige "Bekleidung", die einen großen Teil des Körpers unbedeckt ließ. Obwohl wir für eine zweckmäßige Körperkultur und Natürlichkeit sehr eingenommen sind, eine derartige Herausforderung der Sitte empfinden wir als sinnlos und unmoralisch.“
Auch das Feuilleton von Schlaf erwähnt die nackten Arme Gräsers, der offenbar kein Hemd trägt, sondern lediglich einen gelblichbraunen Chiton sich über die Schultern geworfen hat. Und auch Schlaf betont, wie Hauptmanns Gedicht, die "hohe, schlanke, stattliche Gestalt von tadellos freier und ansprechender Haltung", hebt die "anmutigen Bewegungen" seines Gastes hervor und nennt sein Gehen ein "Schreiten".
„Und die hohe Gestalt schreitet mit schönstem und ungezwungenstem Anstand freischrittig und freundlich in mein Arbeitszimmer hinein; schreitet bis mitten ins Zimmer, schwingt schnell, mit einer sicheren und anmutigen Bewegung das netzförmige Bündel von der Schulter, und halb wirft, halb legt er es ohne weiteres auf die Chaiselongue.“
Johannes Schlaf: Gusto Gräser. In:
Frankfurter
Zeitung vom 25. April 1909
Gräsers
Auftreten hatte ohne Zweifel etwas Königliches, auch in der Sicht von
Schlaf.
Gräser selbst sieht sich so:
Freih wie der Wind, wie der Sonnenschein,
so - tritt - er - ein.
Wir fragen woher, wir fragen wohin? Von hier,
heisst es heiter, gradher wo ich bin!
Gibt frisch uns ein Lied, einen Ohrenschmaus -
Wahrhaftig - sind wir oder er hier zu Haus?...
Selbstbewusst tritt er auf,
nicht
wie ein Bettler sondern wie einer, der zu geben hat:
da sehn wir schon ferne den Wonnigen gehen.
Doch in uns fühlen wir uns selber bewährt –
uns Alle hat seine Nähe genährt.
Er, der "Wonnige", ist der Schenkende, der Nährende, tritt auf in der Gewissheit, dass er, weil "ichverloren, Urlebens König ist"!
Alle Schilderungen Gräsers stimmen auch darin überein, dass sie von seinem tänzerischen Schreiten berichten. So auch Hermann Hesse in der 'Morgenlandfahrt' von dem "Diener Leo", dessen Gestalt zweifellos auf Gusto Gräser zurückgeht. Die Szenerie von Hauptmanns Gedicht zeigt den Gast aber nicht nur als eine königliche, Ehrfurcht gebietende Erscheinung, sie deutet ihn geradezu als einen Sohn des Allerhöchsten, als den wandernden Gottessohn Jesus. So nämlich spricht des armen Conzen Gast:
Viel reiner strahlt deines Herzens Schrein.
Du hast mich an Leib und Seele erquickt,
Gott selber hat dir ins Auge geblickt.
Nun muß ich weiter, gedenke mein,
es soll dir, Bruder, vergolten sein!
Denn siehe, ich schreite durch Nacht und Graus
In meines Vaters goldenes Haus."
Die bescheidene Bewirtung, die
der arme Hüttler und Holzfäller dem Wanderer bieten konnte, wandelt
sich, wenn
auch unausgesprochen, durch die Gegenwart des verborgenen Gottessohns
zum
heiligen Abendmahl von Brot und Wein. Es ist ein Geschehen, das nicht
von
ungefähr an ein Gedicht von Trakl erinnert, im Geschehnis sowohl wie in
seiner
Deutung: 'Ein
Winterabend'. Denn auch dieses
Gedicht dürfte durch einen Besuch Gräsers inspiriert worden sein. Dass
Gräser
Georg Trakl besucht hat, wissen wir von ihm selbst. Und dieser Besuch
in oder
bei Innsbruck ist von den Umständen her am ehesten in jenem Jahr 1913
zu
denken, in dem 'Ein
Winterabend' entstanden ist.
Kommt ans Tor auf dunklen Pfaden ...
So
auch nach Schlesien. Aber auch abgesehen von einer solchen (möglichen)
Parallele: Es bedarf kaum einer Begründung, dass das Anklopfen eines
Armen, der
um Kost und Nachtlager bittet, bei jedem christlich erzogenen Menschen
sofort
die Erinnerung an den anklopfenden Jesus wachruft - selbst dann, wenn
es sich
um einen gewöhnlichen Bettler handelt. Wieviel mehr in dem Falle, wenn
einer
sichtlich vom Geist getrieben umherwandert, eintritt, spricht und
auftritt mit
der Würde eines solchen? Dass Gräser als ein Nachbild des wandernden
Jesus
erlebt werden musste und erlebt wurde, ist gar keine Frage und auch
vielfach
ausdrücklich bezeugt.
Wir
haben allen Grund, auch in Hauptmanns Gedicht den Niederschlag einer
solchen
Erfahrung zu sehen - auch wenn dies, wie immer bei poetischen
Schöpfungen,
nicht bis ins Letzte beweisbar ist. Zumindest einen bestätigenden
Hinweis in
dieser Richtung können wir darin sehen, dass Hauptmann innerhalb
vierzehn Tagen
nach jener Niederschrift eine Planskizze zu 'Quint'
entwirft, dem Roman eines Wanderers, der Jesus nachfolgt und als
"Kohlrabiapostel"
verspottet wird (siehe CA XI, 298-301; vgl. Sprengel 198). In den
ersten
Niederschriften zu dieser Erzählung findet sich die Notiz: „Die Kolonie von Locarno“. Gemeint ist die
Gründung Gusto Gräsers, der Monte Verità.
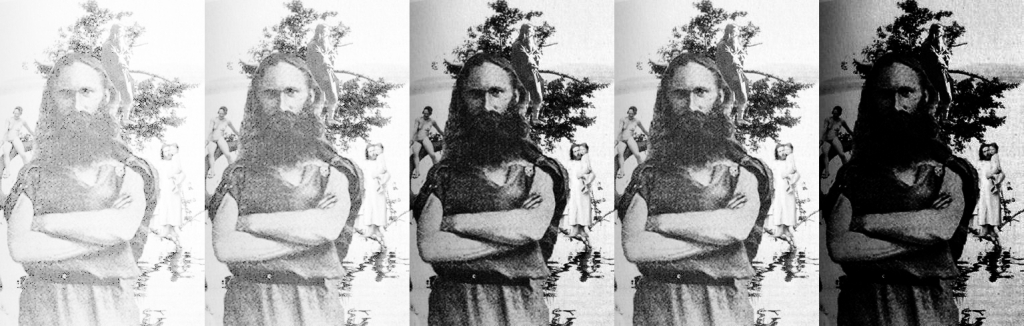
Variationen einer Collage von Ulrich Holbein
„Am ersten Pfingstfeiertag
[1888], wo bekanntlich die Jünger
Jesu mit Zungen redeten, promenierte bei herrlichem Sonnenschein ganz
Zürich
auf den Kaipromenaden. Hier tauchte plötzlich in härenem Gewand,
Sandalen an
den Füßen, mit auf den Schultern wallendem rötlichem Haar eine Art
Apostel auf.
So hätte Jesus aussehen können. ... Als sich die Leute um ihn stauten,
hielt
dieser Heilige seine Pfingstpredigt. Etwas vom Pfingstgeist der
Apostelgeschichte lag in der Luft.“ (GH: DEW VII; 296f.)
Johannes Guttzeit, der Schüler
„des Naturmenschen und
Anachoreten Diefenbach“ (GH: SW VII; 1059), predigt die engste
Verbindung mit
Natur und Gott. Der Jesus-und-Natur-Sucher Gerhart Hauptmann ist im
Tiefsten
angerührt.
In
seiner Erzählung ‚Der Apostel’, erschienen 1890, hat er seine
Erinnerung an den
Naturprediger Guttzeit zu einer psychologischen Studie verarbeitet. Er
beschreibt recht zuverlässig dessen Art, Denken und Auftreten und fragt
sich
zugleich, was in einem solchen Menschen seelisch vorgehen mag. Was er
sich
vorstellt, entspringt seiner einfühlenden Phantasie und muss mit der
Wirklichkeit des Porträtierten nichts zu tun haben. Dennoch ist sein
Versuch
hochinteressant, weil er ebensogut Gusto Gräser gegolten haben könnte,
der in
mancher Hinsicht von Guttzeit angeregt
war. Beiden, Guttzeit wie Gräser, mag die Versuchung nahegekommen sein,
sich als
„neuer Heiland“ zu gebärden, wie Hauptmann seinem „Apostel“ unterstellt
- auch
wenn es dafür keine Belege gibt. Wesentlich ist – und eben das
unterscheidet
sie von üblichen „Aposteln“ und Jesus-Nachahmern -
,
dass sie dieser Versuchung (so es sie denn gegeben hat) widerstanden
haben.
Hauptmann zeigt mit Scharfsicht eine Gefährdung auf, die letztlich
phantasievoller Verdacht bleibt, von der Wirklichkeit widerlegt.
Inhaltsangabe:
Zu
der Erzählung schreibt der Hauptmann-Biograph Peter Sprengel:
Diefenbach-Schüler
ist die Hauptfigur in Hauptmanns „Apostel“.
Intensiver als die Endfassung des „Abenteuers meiner Jugend“ schildert
die
unveröffentlichte Vorstufe von 1930 das Auftreten Johannes Guttzeits,
der das
Modell abgegeben hat, am Pfingstsonntag 1888: Kleidung und Gestalt
(durchaus in
Übereinstimmung mit der Novelle), die am Limmatquai um ihn gestaute
Menge,
seine Predigt gegen den Luxus, die erregte Frage des Patriziersohns
(wie
Benjamin Glasers im Roman): „Was soll ich tun, daß ich selig werde?“
Niemals
habe ich jedenfalls eine so
augenfällige, gegenwartsstarke Illustration evangelischer Vorgänge
vorher und
nachher erlebt. Es war eine wahrhaft heilige Szene, die durch kein
Oberammergau
zu erreichen ist.
Wenig später hat
Hauptmann wahrscheinlich einem Treffen
beigewohnt, zu dem ein Kreis junger Intellektueller Guttzeit einlud;
möglich,
daß er dabei die Broschüre des Predigers erworben hat, die sich heute
noch im
Nachlaß (unter den Vorarbeiten zu „Quint“) befindet.
Auf eine derartige
Einladung bezieht sich Guttzeit in der
erregten Zuschrift, zu der ihn das Erscheinen der Novelle in „Moderne
Dichtung“
veranlaßt:
O
welche schaurige Glaubenslosigkeit
gegenüber dem Menschen und der Zeit mus in einem Geiste herschen, der
die
erhabensten Empfindungen und Wünsche als aus einer heuchlerischen,
gelbsüchtigen Sele hervorgegangen auch nur darstellen kann!
Mit welchem Recht
leugnet Hauptmanns Antwort jede persönliche
Beziehung? „Ich verspüre auch nie in meinem Leben sozusagen bloß
photographische Gelüste.“
Die Wirklichkeit der Mythen. Untersuchungen zum Werk Gerhart Hauptmanns aufgrund des handschriftlichen Nachlasses. Berlin 1982., S. 88f.
Die Frage von Peter Sprengel ist voll berechtigt. Denn es handelt sich zweifellos um eine naturnahes Porträt des Johannes Guttzeit.
Hier die Erzählung:
Der Apostel
Spät
am Abend war er in Zürich angelangt. Eine Dachkammer in der
»Taube«, ein wenig Brot und klares Wasser, bevor er sich niederlegte:
das
genügte ihm.
Er
schlief unruhig
wenige Stunden. Schon kurz nach vier erhob er sich. Der Kopf schmerzte
ihn. Er
schob es auf die lange Eisenbahnfahrt vom gestrigen Tage. Um so etwas
auszuhalten mußte man Nerven wie Seile haben. Er haßte diese Bahnen mit
ihrem
ewigen Gerüttel, Gestampf und Gepolter, mit ihren jagenden Bildern; –
er haßte
sie und mit ihnen die meisten anderen der sogenannten Errungenschaften
dieser
sogenannten Kultur.
Durch
den Gotthard allein … es war wirklich eine Tortur, durch den
Gotthard zu fahren: dazusitzen, beim Scheine eines zuckenden Lämpchens,
mit dem
Bewußtsein, diese ungeheure Steinmasse über sich zu haben. Dazu dieses
markerschütternde Konzert von Geräuschen im Ohr. Es war eine Tortur, es
war zum
Verrücktwerden! In einen Zustand war er hineingeraten, in eine Angst,
kaum zu
glauben. Wenn das nahe Rauschen so zurücksank und dann wieder daherkam,
daherfuhr wie die ganze Hölle und so tosend wurde, daß es alles in
einem
förmlich zerschlug … nie und nimmer würde er nochmals durch den
Gotthard
fahren!
Man
hatte nur einen
Kopf. Wenn der einmal aufgestört war – der Bienenschwarm da drinnen –
da mochte
der Teufel wieder Ruhe schaffen: alles brach durch seine Grenzen,
verlor die
natürlichen Dimensionen, dehnte sich hoch auf und hatte einen eigenen
Willen.
Die
Nacht hatte es ihn noch geplagt, nun
sollte es damit ein Ende haben. Der kalte, klare Morgen mußte das
seinige tun.
Übrigens würde er von hier ab nach Deutschland hinein zu Fuße reisen.
Er
wusch sich und zog die Kleider über. Als er die Sandalen unterband,
tauchte ihm flüchtig auf, wie er zu dem Kostüm, das er trug und das ihn
von
allen übrigen Menschen unterschied, gekommen war: die Gestalt Meister
Diefenbachs ging vorüber. – Dann war es ein Sprung in frühe Jahre: er
sah sich
selbst in der sogenannten Normaltracht zur Schule gehen – der Glatzkopf
des
Vaters blickte hinter dem Ladentische der Apotheke hervor, die Tracht
des
Sohnes milde bespöttelnd. Die Mutter hatte doch immer gesagt, er sei
kein
Hypochonder. Der Glatzkopf und das junge Frauengesicht schoben sich
nebeneinander. Welch ein ungeheurer Unterschied! Daß er das früher nie
bemerkt
hatte.
Die
Sandalen saßen
fest. Er legte den Strick, der die weiße Frieskutte zusammenhielt, um
die
Hüften und eine Schnur rund um den Kopf.
Auf
dem Hausflur der Herberge war ein alter
Spiegel angebracht. Einen Augenblick im Vorübergehen hielt er inne, um
sich zu
mustern. Wirklich! – er sah aus wie ein Apostel. Das heilige Blond der
langen
Haare, der starke, rote, keilförmige Bart, das kühne, feste und doch so
unendlich milde Gesicht, die weiße Mönchskutte, die seine schöne,
straffe
Gestalt, seinen elastischen, soldatisch geschulten Körper zu voller
Geltung
brachte.
Mit
Wohlgefallen spiegelte er sich. Warum sollte er es auch nicht?
Warum sollte er sich selbst nicht bewundern, da er doch nicht aufhörte,
die
Natur zu bestaunen in allem, was sie hervorbrachte? Er lief ja durch
die Welt
von Wunder zu Wunder, und Dinge, von anderen nicht beachtet, erzeugten
in ihm
religiöse Schauer. Übrigens nahm sie sich gut aus – die Neuerung dieses
Morgens: man konnte ja denken, diese Schnur um den Kopf habe den Zweck,
das
Haar zusammenzuhalten. Daß sie einem Heiligenscheine ähnelte, hatte
nichts auf
sich. Heilige gab es nicht mehr, oder besser: der Heiligenschein kam
jedem
Naturerzeugnis, auch dem kleinsten Blümchen oder Käferchen zu, und
dessen Auge
war ein profanes Auge, der nicht über allem solche Heiligenscheine
schweben sah. – –
Auf
der Straße war
noch niemand: einsamer Sonnenschein lag darauf; hie und da der lange,
ein wenig
schräge Schatten eines Hauses. Er bog in ein Seitengäßchen, das bergan
stieg,
und klomm bald zwischen Wiesen und Obstgärten hin aufwärts.
Bisweilen
ein hochgiebliges, altväterisches
Häuschen, ein enges, mit Blumen vollgepfropftes Hausgärtchen, dann
wieder eine
Wiese oder ein Weinberg. Der Ruch des weißen Jasmins, des blauen
Flieders und
des dunkelbrennenden Goldlacks erfüllte stellenweise die reine und
starke Luft,
daß er sie wohlig in sich sog wie einen gewürzten Wein.
Er
fühlte sich freier nach jedem Schritt.
Wie
wenn ein Dorn
aus seinem Herzen sich löste, war ihm zu Sinn, als es ihm das Auge so
still und
unwiderstehlich nach außen zog. Das Dunkel in ihm ward aufgesogen von
all dem
Licht. Die Köpfchen des gelben Löwenzahns, gleich unzähligen, kleinen
Sonnen in
das sprießende Grün des Wegrandes gelegt, blendeten ihn fast. Durch den
schweren Blütenregen der Obstbäume schossen die Sonnenstrahlen schräg
in den
wiesigen Grund, ihn mit goldigen Tupfen überdeckend. So honigsüß
dufteten die
Birken. Und so viel Leben, Behaglichkeit und Fleiß sprach aus dem
verlorenen
Sumsen früher Bienen.
Sorgfältig
vermied er im Aufsteigen irgend etwas zu
beschädigen oder gar zu vernichten, was
Leben hatte. Das kleinste Käferchen wurde umgangen, die zudringliche
Wespe
vorsichtig verscheucht. Er liebte die Mücken und Fliegen brüderlich,
und zu
töten, – auch nur den allergewöhnlichsten Kohlweißling – schien ihm das
schwerste aller Verbrechen.
Blumen,
halbwelk, von Kinderhänden ausgerauft, hob er vom Wege auf, um
sie irgendwo ins Wasser zu werfen. Er selbst pflückte niemals Veilchen
oder
Rosen, um sich damit zu schmücken. Er verabscheute Sträuße und Kränze;
er
wollte alles an seinem Ort.
Ihm
war wohl und
zufrieden. Nur, daß er sich selbst nicht sehen konnte, bedauerte er. Er
selbst
mit seinem edlen Gange, einsam in der Frühe auf die Berge steigend: das
hätte
ein Motiv abgegeben für einen großen Maler –: und das Bild stand
vor
seiner Phantasie.
Dann
sah er sich um, ob nicht doch vielleicht
irgendeine menschliche Seele bereits wach sei und ihn sehen könne.
Niemand war
zu erblicken.
Übrigens
fing das merkwürdige Schwatzen – im
Ohr oder gar im Kopf drinnen, er wußte nicht wo – wieder an. Seit
einigen
Wochen plagte es ihn. Sicherlich waren es Blutstockungen. Man mußte
laufen,
sich anstrengen, das Blut in schnelleren Umlauf versetzen –
Und
er beschleunigte seine Schritte.
Allmählich
war er so über die Dächer der Häuser hinausgekommen. Er stand
ruhend still und hatte alle Pracht unter sich. Eine Erschütterung
überkam ihn.
Ein Gefühl tiefer Zerknirschung brannte in ihm angesichts dieser
wundervollen
Tiefe. – Lange ließ er das verzückte Auge umherschwelgen: – über alles
hin, zu
der Spitze des jenseitigen Berges, dessen schründige Hänge zartes,
wolliges
Grün umzog. – Hinunter, wo die veilchenfarbne Fläche des Sees den
Talgrund
ausfüllte, wo die weichen, grasigen Uferhügel daraus hervorstiegen,
grüne
Polster, überschüttet, soweit die Sehkraft reichte, mit Blüten und
wieder
Blüten. Dazwischen Häuschen, Villen und Dörfer, deren Fenster
elektrisch
aufblitzten, deren rote Dächer und Türme leuchteten.
Nur
im Süden, fern,
verband ein grauer, silberiger Duft See und Himmel und verdeckte die
Landschaft; aber über ihm, fein und weiß leuchtend, auf das blasse Blau
der
Luft gelegt, schemenhaft tauchten sie auf – einem ungeheuren
Silberschatz
vergleichbar – in langer sich verlierender Reihe: die Spitzen der
Schneeberge.
Dort
haftete sein Blick – starr – lange. Als
es ihn los ließ, blieb nichts Festes mehr in ihm. Alles weich,
aufgelöst.
Tränen und Schluchzen.
Er
ging weiter.
Von
oben her, wo die Buchen anfingen, traf
das Geschrei des Kuckucks sein Ohr: jene zwei Noten, die sich
wiederholen,
aussetzen, um dann wieder und wieder zu beginnen. Er ging weiter,
nunmehr für
sich und grüblerisch.
Mysteriöse
Rührungen waren ihm angesichts der Natur nichts
Ungewöhnliches, so stark und jäh wie diesmal indes hatten sie ihn noch
niemals
befallen. – Es war eben sein Naturgefühl, das stärker und tiefer wurde.
Nichts
war begreiflicher, und es tat nicht not, sich darüber hypochondrische
Gedanken
zu machen. Übrigens fing es an, sich in ihm zu verdichten, zu
gestalten, zu
erbauen. Kaum daß Minuten vergingen, und alles in ihm war gebunden und
fest.
Er
stand still,
wieder schauend. Nun war es die Stadt unten, die ihn anzog und abstieß.
Wie ein
grauer, widerlicher Schorf erschien sie ihm, wie ein Grind, der weiter
fressen
würde, in dies Paradies hineingeimpft: Steinhaufen an Steinhaufen,
spärliches
Grün dazwischen. Er begriff, daß der Mensch das allergefährlichste
Ungeziefer
sei. Jawohl, das stand außer Zweifel: Städte waren nicht besser als
Beulen,
Auswüchse der Kultur. Ihr Anblick verursachte ihm Ekel und Weh.
Zwischen
den Buchen angelangt, ließ er sich nieder. Lang ausgestreckt,
den Kopf dicht an der Erde, Humus- und Grasgeruch einziehend, die
transparenten, grünen Halme dicht vor den Augen, lag er da. Ein Behagen
erfüllte ihn so, eine schwellende Liebe, eine taumelnde Glückseligkeit.
Wie
Silbersäulen die Buchenstämme. Der wogende und rauschende,
sonnengolddurchschlagene, grüne Baldachin darüber, der Gesang, die
Freude, der
eifrige und lachende Jubel der Vögel. Er schloß die Augen, er gab sich
ganz
hin. – –
Dabei
stieg ihm der
Traum der Nacht auf: eine fremde Stimmung zuerst, ein Herzklopfen, eine
Gehobenheit, die eine Vorstellung mitbrachte, über deren Ursprung er
grübeln
mußte. Endlich kam die Erinnerung –: zwischen Tag und Abend. Eine
endlose,
staubige, italienische Landstraße, noch erhitzt, flimmernde Wärme
ausströmend.
Landleute kommen vom Felde, braun, bunt, zerlumpt. Männer, Weiber und
Kinder
mit schwarzen, stechenden und glaubenskranken Augen. Ärmliche Hütten
schräg
drüben. Über sie her einfältiges, katholisches Aveglockengebimmel. Er
selbst
bestaubt, müde, hungernd, dürstend. Er schreitet langsam, die Leute
knien am
Wegrand, sie falten die Hände, sie beten ihn an. Ihm ist weich, ihm ist
groß.
Er
lag und hing an dem Bilde. Fieber,
Wollust, göttliche Hoheitsschauer wühlten in ihm. Er erhob sich Gott
gleich.
Nun
war er bestürzt, als er die Augen auftat. Wie eine Säule aus Wasser
brach es zusammen und verrann.
Sich
selbst fragend
und zur Rede stellend, drang er ins Waldinnere. Er machte sich Vorwürfe
über
sein verzücktes Träumen; es kam wider seinen Willen und Entschluß. Die
Wucht
seiner Gefühle machte ihm bange, dennoch aber: es konnte sein, daß
seine
nagende Angst ohne Grund war.
Übrigens
wuchs die Angst, obgleich es ihm
jetzt gerade ganz klar wurde, daß sie grundlos war.
Sie
hatten ihn wirklich verehrt, die
Italiener, deren Dörfer er zu Fuß durchzogen hatte. Sie waren gekommen,
um ihre
Kinder von ihm segnen zu lassen. Warum sollte er nicht segnen, wenn
andere
Priester segnen durften? Er hatte etwas – er hatte mehr mitzuteilen als
sie. Es
gab ein Wort, ein einziges wundervolles Wortjuwel: Friede! Darin lag
es, was er
brachte, darin lag alles verschlossen – alles – alles.
Blutgeruch
lag über der Welt. Das fließende Blut war das Zeichen des
Kampfes. Diesen Kampf hörte er toben,
unaufhörlich, im
Wachen und Schlafen. Es waren Brüder und Brüder, Schwestern und
Schwestern, die
sich erschlugen. Er liebte sie alle, er sah ihr Wüten und rang die
Hände in
Schmerz und Verzweiflung.
Mit
der Stimme des
Donners reden zu können wünschte er glühend. Angesichts der tosenden
Schlacht,
auf einem Felsblock, allen sichtbar, stehend, mußte man rufen und
winken. Zu
warnen vor dem Bruder- und Schwestermord, hinzuweisen auf den Weg zum
Frieden
war eine Forderung des Gewissens.
Er
kannte diesen Weg. Man betrat ihn durch
ein Tor mit der Aufschrift: Natur.
Mut
und Eifer hatte die Angst seiner Seele allmählich wieder verdrängt.
Er ging, nicht wissend wohin, predigend im Geiste und bei sich selbst
zu allem
Volke redend: ihr seid Fresser und Weinsäufer. Auf euren Tafeln prangen
kannibalisch Tierkadaver. Laßt ab vom Schlemmen! Laßt ab vom ruchlosen
Morde
der Kreaturen! Früchte des Feldes seien eure Nahrung! Eure seidnen
Betten, eure
Polster, eure kostbaren Möbel und Kleider, tragt
alles
zusammen, werft die Fackeln hinein, daß die Flamme himmelan schlage und
es
verzehre! Habt ihr das getan, dann kommt – kommt alle, die ihr mühselig
und
beladen seid und folgt mir nach! In ein Land will ich euch führen, wo
Tiger und
Büffel nebeneinander weiden, wo die Schlangen ohne Gift und die Bienen
ohne
Stachel sind. Dort wird der Haß in euch sterben und die ewige Liebe
lebendig
werden.
Ihm
schwoll das
Herz. Wie ein reißender Strom stürzte der Schwall strafender,
tröstender und
ermahnender Worte. Sein ganzer Körper bebte in Leidenschaft. Mit
hinreißender
Stärke überkam ihn der Drang, seine ganze Liebe und Sehnsucht
auszuströmen. Als
müsse er den Bäumen und Vögeln predigen, war ihm zumut. Die Kraft
seiner Rede
mußte unwiderstehlich sein. Er hätte das Eichhorn, welches in
Bogensprüngen
zwischen den Stämmen hinhuschte, mit einem einzigen Worte bannen und zu
sich
rufen können. Er wußte es, wußte es sicher, wie man weiß, daß der Stein
fällt.
Eine Allmacht war in ihm: die Allmacht der Wahrheit.
Plötzlich
hörte der Wald auf. Fast
erschreckt, geblendet, wie jemand, der aus einem tiefen Schacht
aufsteigt, sah
er die Welt. Aber es hörte nicht auf in ihm zu wirken. Mit eins kam
Richtung in
seine Schritte. Er stieg niederwärts, den abschüssigen Weg laufend und
springend.
Wie
ein Soldat, der stürmt, das Ziel im Auge, kam er sich nun vor.
Einmal im Laufen, war es schwer sich aufzuhalten. Die schnelle, heftige
Bewegung aber weckte etwas: eine Lust, eine Art Begeisterung, eine
Tollheit.
Das
Bewußtsein kam,
und mit Grausen sah er sich selbst in großen Sätzen bergab eilen. Etwas
in ihm
wollte hastig hemmen, Einhalt tun, aber schon war es ein Meer, das die
Dämme
durchbrochen hatte. Ein lähmender Schreck blieb geduckt im Grunde
seiner Seele
und ein entsetztes, namenloses Staunen dazu.
Sein
Körper indes, wie etwas Fremdes, tobte
entfesselt. Er schlug mit den Händen, knirschte mit den Zähnen und
stampfte den
Boden. Er lachte – lachte lauter und lauter, ohne daß es abriß.
Als
er zu sich kam, zitterte er. Fast gelähmt
vor Entsetzen, hielt er den Stamm einer jungen Linde umklammert. Nur
mit
Vorsicht und stets in Angst vor der Wiederkehr des Unbekannten,
Fürchterlichen
ging er dann weiter. Aber er wurde doch wieder frei und sicher, so daß
er am
Ende über seine Angst lächeln konnte.
Nun,
unter dem festen Gleichmaß seiner Schritte, angesichts der ersten
Häuser, kam die Erinnerung seiner Soldatenzeit. Wie oft, das Herz mit
dem
tauben Hochgefühl befriedigter Eitelkeit zum Bersten gefüllt, hatte er
als
Leutnant, an der Seite der Truppe, unter klingendem Spiele Einzug
gehalten. Er
dachte es kaum, und schon hatte in seinem Kopfe die markige, feurige
Marschmusik eingesetzt, durch die er so oft fanatisiert worden war. Sie
klang
in seinem Ohr und bewirkte, daß er die Füße in Takt setzte und Kopf und
Brust
ungewöhnlich stolz trug. Sie legte das sieghafte Lächeln um seine
Lippen und
den lebendigen Glanz in seine Augen. So marschierend lauschte er
zugleich in
sich hinein, verwundert, daß er so jeden Ton, jeden Akkord, jedes
Instrument
scharf unterschied, bis auf das Nachschüttern des Zusammenschlags von
Pauke und
Becken. Er wußte nicht, sollte ihn die Stärke seiner Vorstellungskraft
beunruhigen oder erfreuen. Ohne Zweifel war es eine Fähigkeit. Er hatte
die
Fähigkeit zur Musik. Er würde sicher große Kompositionen geschaffen
haben. Wie
viele Fähigkeiten mochten überhaupt in ihm erstickt worden sein!
Übrigens war
das gleichgültig. Alle Kunst war Unsinn, Gift. Es gab andere,
wichtigere Dinge
für ihn zu tun.
Ein
Mädchen in blauem Kattun, mit einem rosa
Brusttuch, eine Kanne aus Blech in der Hand, welches augenscheinlich
Milch
austrug, kam ihm entgegen. Er hatte sie mit dem Blick gestreift und
bemerkt,
wie sie erstaunt über seinen Anblick still stand und groß auf ihn
blickte. Sie
grüßte dann kleinlaut mit ehrfürchtiger Betonung, und er ging gemessen
und
ernst dankend an ihr vorüber.
Sofort
war alles in
ihm verstummt. Weit hinaus wuchs er im Augenblick über seine bisherigen
kleinen
Vorstellungen. Wenn er noch etwas wie Musik in seinem Ohre trug, so war
es
jedenfalls keine irdische Melodie. Mit einer Empfindung schritt er, wie
wenn er
trockenen Fußes über Wasser ginge. So hehr und groß kam er sich vor,
daß er
sich selbst zur Demut ermahnte. Und wie er das tat, mußte er sich an
Christi
Einzug in Jerusalem erinnern und schließlich der Worte: Siehe, dein
König kommt
zu dir, sanftmütig.
Noch
eine Zeitlang fühlte er den Blick des
Mädchens sich nachfolgen. Aus irgendwelchem Grunde hielt er im Gehen
möglichst
genau die Mitte des Fahrdamms inne, auch als er eine Biegung machte in
eine
breite, weiße, sich abwärts senkende Straße hinein. Dabei wie unter
einem
Zwange stehend, mußte er immer und immer wiederholen: Dein König kommt
zu dir.
Kinderstimmen
sangen diese Worte. Sie lagen ihm noch ungeformt zwischen
Gaumen und Zunge. Aus dem unartikulierten Geräusch seines Atems konnte
er sie
heraushören. Dazwischen Hosianna, rauschende Palmenwedel, Jauchzen,
bleiche,
verzückte Gesichter. Dann wieder jähe Stille – Einsamkeit.
Er
sah auf, voll
Verwunderung. Wie leere Kulissen alles. Häuser aus Stein rechts und
links, stumm,
nüchtern, schläfrig. Nachdenklich prüfte er. Allmählich, da es
feststand,
begann sein Inneres sich daran zu ordnen. So wurde er klein, einfach,
und fing
an nüchtern zu schauen.
Hier
und da war ein Fenster geöffnet. Der
Kopf eines Hausmädchens wurde sichtbar, man klopfte einen Betteppich
aus. Ein
Student, schwarzhaarig, mit wulstigen Lippen, augenscheinlich ein
Russe, drehte
auf dem Fensterbrett seine Frühstückszigarette. Und schon wurde es
lebendiger
auf der Straße. Die Augen auf den Boden geheftet, unterließ er es doch
nicht,
verstohlen zu beobachten. Oft sah er mitten hinein in ein breites,
freches
Lachen. Oft bemerkte er, wie Staunen den Spott bannte. Aber hinter
seinem
Rücken befreite sich dann der Spott, und dreiste Reden, spitz und
beißend,
flogen ihm nach.
Mit
jedem Schritt unter so viel Stichen und Schlägen wurde ihm
alltäglicher zu Sinn. Ein Krampf saß ihm in der Kehle. Der alte
bittere,
hoffnungslose Gram trat hervor. Wie eine Mauer, dick, unübersteiglich,
richtete
sie sich auf vor ihm, die grausame Blindheit der Menschen.
Nun
schien es ihm
auf einmal, als ob alles Leugnen unnütz sei. Er war doch wohl nur eine
eitle,
kleine, flache Natur. Ihm geschah doch wohl recht, wenn man ihn
verhöhnte und
verspottete. So empfand er minutenlang die Pein und Scham eines
entlarvten
Hochstaplers und den Wunsch, von aller Welt fortzulaufen, sich zu
verkriechen,
zu verstecken, oder auf irgendeine Weise seinem Leben überhaupt ein
Ende zu
machen.
Wäre
er jetzt allein gewesen, würde er den
Strick um seinen Kopf, der wie ein Heiligenschein aussah,
heruntergerissen und
verbrannt haben. Wie unter einer Narrenkrone aus Papier, halb
vernichtet vor
Scham, ging er darunter.
In
enge, labyrinthische Gäßchen ohne Sonne hatte er eingelenkt. Ein
kleines Fensterchen voller Backware zog ihn an. Er öffnete die Glastür
und trat
in den Laden. Der Bäcker sah ihn an – die Bäckersfrau – er wählte ein
kleines
Brot, sagte nichts und ging.
Vor
der Tür hatte
sich eine Schar Neugieriger angesammelt: eine alte Frau, Kinder, ein
Schlächtergesell, die Mulde mit roten Fleischstücken auf der Schulter.
Er
überflog ihre Gesichter, es war nichts Freches darin, und ging mitten
durch sie
hin seines Weges.
Mit
welchem Ausdruck sie ihn alle angeblickt
hatten! Erst die Bäckersleute. Als ob er des kleinen Brotes nicht zum
Essen
bedürfe, sondern vielmehr, um damit ein Wunder zu tun. Und weshalb
warteten die
Leute auf ihn vor den Türen? Es mußte doch einen Grund haben. Und nun
gar das
Getrappel und Geflüster hinter ihm drein. Weshalb lief man ihm nach?
Weshalb verfolgte
man ihn?
Er
horchte gespannt und wurde bald inne, daß
er ein Gefolge von Kindern hinter sich hatte. Durch Kreuz- und
Quergehen über
kleine Plätze mit alten Brunnen darauf, absichtlich umkehrend und die
Richtung
wechselnd, vergewisserte er sich, daß der kleine Trupp nicht von ihm
abließ.
Warum
verfolgten sie ihn und ließen sich nicht genügen an seinem
Anblick? Erwarteten sie mehr von ihm? Hofften sie in der Tat von ihm
etwas
Neues, Außergewöhnliches, Wundervolles zu sehen? Es kam ihm vor, als
spräche
aus der eintönigen Hast der Geräusche ihrer Füße ein starker Glaube, ja
mehr
als dies: eine Gewißheit. Und plötzlich ging es ihm hell auf, weshalb
Propheten, wahrhaftige Menschen voll Größe und Reinheit, so oft am
Schluß zu
gemeinen Betrügern werden. Er empfand auf einmal eine brennende Sucht,
einen
unwiderstehlichen Trieb, etwas Wundervolles zu verrichten, und die
größte
Schmach würde ihm klein erschienen sein im Vergleiche zu dem
Eingeständnis
seiner Unkraft.
Bis
an den
Limmatquai war er inzwischen gelangt, und noch immer folgten ihm die
Kleinen.
Einige trabten, die größeren machten unmäßig lange Schritte, um ihm
nachzukommen. In abgebrochenen Worten, mit dem feierlichen Flüsterton
der
Kirche vorgebracht, bestand ihre Unterhaltung. Es war ihm bisher nicht
gelungen, etwas von dem, was sie sprachen, zu verstehen. Plötzlich aber
– er
hatte es ganz deutlich gehört – wurden die Worte »Herr Jesus«
ausgesprochen.
Die
Wirkung eines Zaubers lag in diesen
Worten. Er fühlte sich aufgehoben durch sie, gestärkt,
wiederhergestellt.
Jesus
war verhöhnt worden: man hatte ihn geschlagen, angespien und ans
Kreuz genagelt. In Verachtung und Spott bestand der Lohn aller
Propheten. Sein
eigenes bißchen Leiden kam nicht in Betracht. Kleine, feige Nadelstiche
hatte
man ihm versetzt. Ein Zärtling, der daran zugrunde ging!
Zum
Kampf war man
da. Wunden bewiesen den Krieger. Spott und Hohn der Menge … wo gab es
höhere
Ehrenzeichen?! Die Brust damit geschmückt, durfte man stolz und frei
blicken.
Und überdies: aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir
dein Lob
zugerichtet.
Vor
einer Frau, die Orangen feilbot, blieb er
stehen. Sogleich hielten auch die Kleinen im Laufen inne, und ein Haufe
Neugieriger staute sich auf dem Bürgersteig. Er hätte seine Früchte
gern ohne
alles Reden gekauft. Mit einer Spannung warteten die Leute auf sein
erstes
Wort, die ihn befangen und scheu machte. Ein sicheres Gefühl sagte ihm,
daß er
eine Illusion zu schonen hatte, daß es von der Art, wie er sprach,
abhing, ob
seine Hörer ihm weiter folgten oder enttäuscht davonschlichen. Aber es
war
nicht zu vermeiden, die Hökerfrau fragte und schwatzte zu viel, und so
mußte er
endlich reden.
Er
war beruhigt und zufrieden, sobald er seine eigene Stimme vernahm;
etwas Singendes und Getragenes lag darin, eine feierliche und gleichsam
melancholische Würde, die, wie er überzeugt war, Eindruck machen mußte.
Er
hatte sich kaum je so reden hören, und indem er sprach, wurde ihm das
Reden
selbst zum Genuß, wie dem Sänger der Gesang. Auf der Brücke, unter die
hinein
der blaugrüne See seine Wellen schlug, hielt er abermals an. Über das
Geländer
gebeugt, nahm er aufs neue Licht, Farbe und Frische des Morgens in sich
auf.
Der ungestüme, stärkende Wind, der den See herauffuhr, wehte ihm den
Bart über
die Schulter und umspülte ihm Stirn und Brust wie ein kaltes Bad.
Und
nun aus der
mutigen Aufwallung seines Innern stieg es auf als ein fester Entschluß.
Die
Zeit war gekommen. Etwas mußte geschehen. In ihm war eine Kraft, die
Menschheit
aufzurütteln. Jawohl! und sie mochten lachen, spotten und ihn
verhöhnen, er
würde sie dennoch erlösen, alle, alle!
Nun
fing er an, tief und verschlossen zu grübeln. Daß
es geschehen würde, stand nun fest; wie es geschehen würde, mußte
erwogen
werden. Man feierte heute Pfingsten, und das war gut. Um Pfingsten
hatten die
Jünger Jesu mit feurigen Zungen geredet. Die Feierstimmung bedeutete
Empfänglichkeit. Einem erschlossenen Acker gleichen die Seelen der
Menschen an
Feiertagen.
Tiefer
und tiefer
ging er in sich hinein, bis er in Räume eindrang, weit, hoch,
unendlich. Und so
ganz versunken war er mit allen Sinnen in diese zweite Welt, daß er wie
ein
Schlafender nur willenlos sich fortbewegte. Von allem, was ihn umgab,
drang
nichts mehr in sein Bewußtsein außer dem Getrappel der Kinderfüßchen
hinter ihm.
Gleichmäßig
eine Zeitlang, schwoll es
allmählich an, wie wenn den Wenigen, die ihm folgten, andere sich
angeschlossen
hätten. Und stärker und stärker immer, als ob aus Einzelnen Hunderte,
aus
Hunderten Tausende geworden wären.
Ganz
plötzlich wurde er aufmerksam, und nun
war es, als ob hinter ihm drein Heeresmassen sich wälzten.
In
seinen Füßen bis in die Knöchel hinauf
spürte er ein Erzittern des Erdreiches. Er vernahm hinter sich starkes
Atmen,
heißes, hastiges Geflüster. Er vernahm Frohlocken, kurz abgerissen,
halb
unterdrückt, das sich weit zurück fortpflanzte und erst in tiefen
Fernen
echohaft erstarb.
Was
das bedeutete, wußte er wohl. Daß es so überraschend schnell kam,
hatte er nicht erwartet. Durch seine Glieder brannte der Stolz eines
Feldherrn,
und das Bewußtsein einer unerhörten Verantwortung lastete nicht
schwerer auf
ihm wie der Strick auf seinem Kopfe. Er war ja der, der er war. Er
wußte ja den
Weg, den er sie führen mußte. Er spürte ja aus dem Lachen und Drängen
seiner
Seele, daß es ihm nahe war, jenes Endglück der Welt, wonach die blinden
Menschen mit blutenden Augen und Händen so viele Jahrtausende vergebens
gesucht
hatten.
So
schritt er voran
– er – er – also doch er! und in die Stapfen seiner Füße stürzten die
Völker
wie Meereswogen. Zu ihm blickten sie auf, die Milliarden. Der letzte
Spötter
war längst verstummt. Der letzte Verächter war eine Mythe geworden.
So
schritt er voran, dem Gebirge entgegen.
Dort oben war die Grenze, dahinter lag das Land, wo das Glück im Arme
des
Friedens ewig ruhte. Und schon jetzt durchdrang ihn das Glück mit einer
Wucht
und Gewalt, die ihm bewies, daß man athletische Muskeln nötig hatte, um
es zu
ertragen.
Er
hatte sie, er hatte athletische Muskeln. Sein Leben, sein Dasein war
jetzt nur ein wollüstiges, spielendes Kraftentfalten.
Eine
Lust kam ihn
an, mit Felsen und Bäumen Fangball zu spielen. Aber hinter ihm
rauschten die
seidenen Banner, drängte und dröhnte unaufhaltsam die ungeheure
Wallfahrt der
Menschen.
Man
rief, man lockte, man winkte; schwarze,
blaue, rote Schleier flatterten; blonde offene Frauenhaare; graue und
weiße
Köpfe nickten; Fleisch bloßer, nerviger Arme leuchtete auf; begeisterte
Augen,
zum Himmel blickend, oder flammend auf ihn gerichtet, voll reinen
Glaubens: auf
ihn, der voranschritt.
Und
nun sprach er es aus, ganz leise, kaum
hörbar, das heilige Kleinodwort: – Weltfriede! Aber es lebte und flog
zurück
von einem zum andern. Es war ein Gemurmel der Ergriffenheit und
Feierlichkeit.
Von ferne her kam der Wind und brachte weiche Akkorde beginnender
Choräle.
Gedämpfte Posaunenklänge, Menschenstimmen, welche zaghaft und rein
sangen; bis
etwas brach, wie das Eis eines Stromes, und ein Gesang emporschwoll wie
von
tausend brausenden Orgeln. Ein Gesang, der ganz Seele und Sturm war und
eine
alte Melodie hatte, die er kannte: »Nun danket alle Gott.«
Er
kam zu sich. Sein Herz hämmerte. Er war nahe am Weinen. Vor seinen
Augen schwammen weiße Punkte durcheinander. Seine Glieder waren wie
zerschlagen.
Er
setzte sich auf
eine Bank nieder, die am See stand, und fing an, das Brot zu essen, das
er sich
gekauft hatte. Dann schälte er die Orange und drückt die kalte Schale
an seine
Stirn. Mit Andacht, wie der Christ die Hostie, genoß er die Frucht.
Noch war er
damit nicht zu Ende, als er müde zurücksank. Ein wenig Schlaf würde ihm
willkommen gewesen sein. Ja, wenn das so leicht wäre: ausruhen. Wie
soll man
ruhen, wenn es im Kopfe drinnen endlos wühlt und gärt? Wenn das Herz
heraus
will, wenn es einen zieht ins Unbestimmte, – wenn man eine Mission hat,
die
verlangt, daß man sich ihr unterziehe – wenn die Menschen draußen
warten und
sich die Köpfe zerbrechen? Wie soll man ruhen und schlafen, wo es not
tut zu
handeln?
Es
war ein peinigender Zustand, wie er so
dalag. Fragen und Fragen und nie eine Antwort. Graue, quälende Leere,
mitunter
schmerzende Stockungen. An einen Ziehbrunnen mußte er denken. Man
steht, zieht
mit aller Kraft am Seil, aber das Rad, worüber es geht, dreht sich
nicht mehr.
Man läßt nicht nach mit Zerren und Stemmen. Der Eimer soll herauf. Man
dürstet
zum Verschmachten. Das Rad gibt nicht nach. Weder vor- noch rückwärts
schiebt
sich das Seil. – Eine Plage war das, eine Qual – beinahe ein physisches
Leiden.
Als er Schritte vernahm, freute er sich der Ablenkung. Ja, du lieber
Gott! Was
war das überhaupt für ein Gedanke gewesen, jetzt schlafen zu wollen! Er
stand
auf, verwundert, daß er sich in seiner Kammer befand, und öffnete die
Tür nach
dem Flur. Seine Mutter, wie er wußte, stand auf dem Gange, und er mußte
sie
hereinlassen. Sie kam, sah ihn an mit strahlender Bewunderung, ihre
Lippen
zitterten, und sie faltete in Ehrfurcht ihre Hände. Er legte ihr die
Hände aufs
Haupt und sprach: stehe auf! – und – die Kranke erhob sich und konnte
gehen.
Und wie sie sich aufrichtete, erkannte er, daß es nicht seine Mutter
war,
sondern er, der Dulder von Nazareth. Nicht nur geheilt hatte er ihn; er
hatte
ihn lebendig gemacht. Noch wehten die Grabtücher um Jesu Leib. Er kam
auf ihn
zu und schritt in ihn hinein. Und eine unbeschreibliche Musik tönte,
als er so
in ihn hineinging. Den ganzen geheimnisvollen Vorgang als die Gewalt
Jesu in
der seinigen sich auflöste, empfand er genau. Er sah nun die Jünger,
die den
Meister suchten. Aus ihnen trat Petrus auf ihn zu und sagte: Rabbi! –
»Ich bin
es,« gab er zur Antwort. Und Petrus kam
näher, ganz
nahe, berührte seinen Augapfel und begann ihn zu drehen: der Jünger
drehte den
Erdball. Die Stunde war da, sich dem Volke zu zeigen. Auf den Balkon
des
Saales, den er bewohnte, trat er hinaus. Unten wogte die Menge, und in
das
Brausen und Wogen sang eine einzige dünne Kinderstimme: »Christ ist
erstanden.«
Sie
hatte kaum
begonnen, als das Eisen des Balkons nachgab. Er erschrak heftig, wachte
auf,
rieb sich die Augen und wurde inne, daß er auf der Bank eingeschlafen
war. –
Gegen
Mittag mochte es sein. Er wollte wieder
hinauf in den Buchenwald, um seine Zeit abzuwarten Die Sonne sollte ihn
weihen,
dort oben.
Noch
immer kühle
und reine Luft, wie er den Berg hinanstieg. Hymnen der Vögel. Der
Himmel wie
eine blaßblaue, leere Kristallschale. Alles so makellos. Alles so neu.
Auch
er selbst war neu. Er betrachtete seine Hand, es war die Hand
eines Gottes; und wie frei und rein war sein Geist! Und diese
Ungebundenheit
der Glieder, diese völlige innere Sicherheit und Skrupellosigkeit.
Grübeln und
Denken lag ihm nun weltfern. Er lächelte voll Mitleid, wenn er an die
Philosophen dieser Welt zurückdachte. Daß sie mit ihrem Grübeln etwas
ergründen
wollten, war so rührend, wie wenn etwa ein Kind sich abmüht, mit seinen
zwei
bloßen Ärmchen in die Luft zu fliegen.
Nein,
nein – dazu
gehören Flügel, breite Riesenschwingen eines Adlers – Kraft eines
Gottes!
Er
trug etwas wie einen ungeheuren Diamanten
in seinem Kopfe, dessen Licht alle schwarzen Tiefen und Abgründe hell
machte:
da war kein Dunkel mehr in seinem Bereich … Das große Wissen war
angebrochen. –
Die
Glocken der Kirchen begannen zu läuten.
Ein Gewühl und Gebrause von Tönen erfüllte das Tal. Mit einer erznen
Zunge
schien die Luft zu sprechen.
Er
beugte sich vor und lauschte, als es zu
ihm heraufkam. Er senkte das Haupt nicht, er kniete nicht nieder. Er
horchte
lächelnd wie auf eines alten Freundes Stimme, und doch war es
Gottvater, der
mit seinem Sohne redete.
*
Wir wollten fliehen,
wollten ein neues Leben anfangen, am liebsten auf einer entlegenen Insel im Ozean.
Bei dem, was wir planten, wären wir im Bereiche der christlichen Zivilisation gestört,
ja verfemt worden. Ich erinnere mich, dass wir die Ehe nicht dulden wollten,
ebenso, dass wir die Weltverneinung des Christentums mit ihrer Verachtung des Leibes
und der natürlichen Triebe als verderblichen Wahnsinn bekämpften.
Unter "die Meinen" also verstand ich Freunde, verstand ich schöne junge Frauen,
die, einem Liebes- und Schönheitskult hingegeben,
meine Insel bevölkern sollten.
Er (Hauptmann) sah aus wie das unverdorbene Kind der Berge und Wälder, das schon durch sein äußeres Erscheinen allein Widerspruch gegen die Sitten der Weltstadt zu erheben schien. Er war ausgesprochener Natur- und Gesundheitsapostel und hatte in Zürich ein heiliges Gelöbnis abgelegt, seine Seele und seinen Leib
nie wieder mit tierischer Kost und spirituösen Getränken zu beflecken.
 |
Die Brissago-Inseln im Lago Maggiore Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs dachte Hauptmann daran, sie zu erwerben. |
Denn wir sind übereingekommen ...
auf jungfräulichem Land einen Staat,
eine Siedlung zu gründen
und in ihr die größtmögliche Summe
von Glück allbereits hier
auf der Erde den Bürgern der Kolonie
zu vermitteln.
Ikarien hieß die Kolonie, die Kolonisten also Ikarier.
Der lichtbegierige Ikarus wollte mit Flügeln aus Wachs die Sonne erreichen.
So verstanden, waren auch wir Ikarier.
Was uns verbindet und verband, ist eine gemeinsame Utopie. …
Jeder, er sei, wer er wolle, arbeitet täglich an seiner Utopie. ….
Und ebenso arbeitet die Masse, die Nation, die Menschheit an ihrer Utopie ….
Über jedem Dorf, wieviel mehr über jeder Stadt, schwebt millionenfältig die Utopie.
Wir waren jung, wir waren glückselig.
Auf Grund dieses Umstandes, auf Grund der Neigung, die uns zusammenschloß,
erstrebten wir eine noch höhere, ja die höchste Glückseligkeit.
Der Leitsatz, der immer wiederkehrte, hieß: Rückkehr zur Natur. …
Wir stellten dem Heiligen Geiste den heiligen Leib gegenüber, weil wir der Ansicht waren,
dass ein heiliger, reiner Leib allein für den Heiligen Geist bewohnbar sei ...
Wir dürsteten alle nach Schönheit! Wir lechzten danach ...
Wir schwärmten für nackte Spiele und Ringkämpfe in der Palästra und dachten dabei
an das heitere Wohlgefühl, das den nackten, klaren Leib überkommt,
sofern er die Kleider, Lumpen und Fetzen von sich geworfen.
Schönheit!
Schon im Suchen danach empfanden wir Glück.
Gerhart Hauptmann auf dem Berg der Wahrheit
Im Januar 1919 ist Gerhart Hauptmann verzweifelt. Seit Tagen toben in Berlin blutige Straßenkämpfe. Der Dichter sieht nur noch "Brand, Mord, Raub, Diebstahl, Vergewaltigung" (Diarium 1917 bis 1933, S. 35). Er flüchtet sich nach Ascona, besteigt den Monte Verità.
Warum Ascona? Was oder wen sucht der Dichter auf dem „Berg der Wahrheit“?
Hauptmann sieht den Untergang der abendländischen Werte vor Augen. Er vermerkt dazu in seinem Tagebuch am 8. Januar 1919: "Schöpfer dieser Werte sind freilich zumeist Besitzlose. ... Arm waren, um nur wenige der reichsten aller Menschen zu nennen, Gotamo Buddho, Sokrates, Jesus von Nazareth" (Diarium S. 32). Die Parole des Zeitgeistes aber scheint ihm zu sein: "Nichts sei euch heilig, etwas Heiliges gibt es nicht" (Diarium 35). Dieses verlorene Heilige sucht er in Ascona, bei den reichen Armen des Monte Verità.
"Der nackte Leib und seine Reinheit und Kultus, wie ich ihn mit siebzehn Jahren trieb", notiert sich Gerhart Hauptmann, etwas wehmütig, im Jahre 1906 (GH und Ida Orloff, S. 52). Als Schüler hatte er mit Kameraden einen Bund gegründet. "Der Jünglingsbund, den wir bildeten, mußte, durch Sympathie geschaffen, naturgemäß kommunistisch sein. Da gab es nichts, materiell oder ideell, was wir uns gegenseitig nicht mitteilten. ... Das Chaos, das uns umgab, schien uns seelenlos und überlebt zu sein. Wir wollten fliehen, wollten ein neues Leben anfangen, am liebsten auf einer entlegenen Insel im Ozean. Bei dem, was wir planten, wären wir im Bereiche der christlichen Zivilisation gestört, ja verfemt worden. Ich erinnere mich, dass wir die Ehe nicht dulden wollten, ebenso, dass wir die Weltverneinung des Christentums mit ihrer Verachtung des Leibes und der natürlichen Triebe als verderblichen Wahnsinn bekämpften. Unter die "Meinen" also verstand ich Freunde, verstand ich schöne junge Frauen, die, einem Liebes- und Schönheitskult hingegeben, meine Insel bevölkern sollten. (SW VII, 207)
Hauptmann entwarf einen Tempelbau und reiste sogar nach Amerika in der Absicht, dort "eine neue Gesellschaftsordnung auf einer natürlichen Grundlage zu errichten" (SW X, 93). Er zog aufs Land, grub die Erde um, trug Jägersche Reformtracht, schlief im Jägerschen Wollsack. Auch war er unter dem Einfluss von Auguste Forel zum Alkoholgegner geworden.
Kurz: Bevor es einen Monte Verità gab, gab es schon einen heimlichen Monteveritaner - Gerhart Hauptmann. Wovon er jahrelang geträumt, was er über Jahrzehnte geplant und dann doch nicht geschaffen hatte, das verwirklichten die Siedler von Ascona. Es versteht sich von selbst, dass dieses Unternehmen ihn brennend interessieren musste.
Schon 1888 hatte er in Zürich den Naturapostel Johannes Guttzeit kennengelernt; um 1904, wenn nicht schon früher, lernte er Gusto Gräser kennen. Seit diesen Begegnungen zieht die Gestalt eines wandernden, sonnenanbetenden, eines jesuanischen Naturpredigers durch seine Dichtung. Er erscheint zunächst als christlich-dionysischer "Apostel", dann als "Narr in Christo Emanuel Quint" und wandelt sich schließlich im "Ketzer von Soana-Ascona" zum offenen Verkünder des Dionysos. Alle drei sind sie Sonnenanbeter - wie Hauptmann selbst.
Freilich, die Zweifel und Ängste, die ihn schon an der Verwirklichung seines Siedlungsprojekts gehindert hatten, bleiben Hauptmann treu. Sinnbildlich dafür erfriert sein Emanuel Quint im Schnee der Alpen, auf dem Weg ins Tessin. Als dann aber im revolutionären Deutschland für Hauptmann die tradierten Werte untergehen, da leuchtet ihm umso heller das Licht seiner Sonnen-Leib-Liebes-und Natur-Utopie – im fernen Ascona. Er besteigt den Monte Verità, sucht den Mann, der dieses Licht wie kein anderer verkörpert, sucht Gusto Gräser. Er findet ihn nicht. Wie später der Till seiner Dichtung brütet Hauptmann in einer Taverne von Locarno, verzweifelnd und hoffend. Sein Till, im Epos, hat am selben Ort eine Vision: Ein von Wunden befreiter, ein apollinischer Heiland lädt ihn ein, ihn auf seinem Berg, den Almen über der Maggia, zu besuchen, "wo still meine Lämmer Jahrtausende weiden". Till sucht ihn, findet ihn nicht, versinkt in den Strudeln der Maggia.
Für Hauptmanns Ascona-und-Locarno-Zeit gibt es einen Zeugen. Ein Schweizer Student aus berühmter Familie, der spätere Gelehrte Christoph Bernoulli erzählt, wie er Hauptmann im März 1919 im Zug kennengelernt hat und ihm dann im Hotel in Locarno wieder begegnet:
„Als ich am Abend des Ankunftstages beschloß, einen Orientierungsgang durchs ganze Hotel zu tun, stieß ich im Kellergeschoß in der Taverne auf den Dichter, der alleine hinter einer Flasche Chianti Platz genommen hatte und mit einer einladenden Handbewegung mich fragte, ob ich nicht ein Glas Wein mit ihm trinken wolle, worauf ich unbeholfen und zögernd antwortete: ‚Doch, sehr gerne.’ In diesem Augenblick stand Hauptmann auf, verbeugte sich leicht ironisch und sagte zu meinem nicht geringen Erstaunen: ‚Ich heiße Dr. Hauptmann.’ (218) ...
In den kommenden Wochen gingen wir manchen Vormittag spazieren, an den Nachmittagen unternahm man en famille Ausfahrten in die Locarneser Täler, nicht selten aßen wir gemeinsam in einer Trattoria des Centovalli, und manchmal bat mich der Dichter am Abend in sein Kellerrefugium, um zu plaudern. Zu Hauptmanns gestoßen waren inzwischen ihr jüngster Sohn Benvenuto, zusammen mit Martin Bodmer. Eugen d'Albert, der mit seiner wienerischen Frau ebenfalls in unserem Hotel wohnte, war oft mit von der Partie. ... Hin und wieder erschien der in der Nähe lebende Emil Ludwig und las aus seinem neugebackenen ‚Goethe’ vor. (219) ...

Auf dem Monte Verità lebten damals die letzten Vertreter jener ‚Zurück-zur-Natur-Bewegung’, die zivilisationsfeindlich einem Troglodysmus huldigten, Milch vom Euter der Ziegen tranken, ihr Brot selber buken, Früchte vom Baum und Zweig aßen und in weltanschaulichen Lufthemden herumgingen. Sie hatten ungeschnittenes Haupthaar, lange Bärte und sahen aus wie Propheten oder wilde Männer und waren die lebendigen Vertreter eines organisierten Fluchtversuches, die den Gleichgewichtszustand mit den heiligen Gesetzen der Natur auf gewaltlosem Wege erreichen wollten.
Bei einem unserer Spaziergänge auf dem ‚Hügel der Wahrheit’ begegneten wir einem schönen bärtigen Greise in härenem Gewande und Schlapphut und kamen mit ihm ins Gespräch. Er betonte, wie glücklich er hier lebe, und sagte, daß er niemals mehr sein geruhsames, naturverbundenes Leben mit dem eines Bürgers der geschäftigen Welt tauschen würde. Ich fragte ihn dann höflich, ob er wisse, mit wem er spreche, und als ich den Namen Gerhart Hauptmann aussprach, verneigte er sich leicht und sagte: ‚Ich grüße den Schöpfer der Weber.’ Und dieser Herr, ich wies auf d'Albert, sei der Komponist der Oper Tiefland. Herr Emil Ludwig dagegen sei ein bekannter Schriftsteller und ein Nachbar aus Ronco. Der schöne Alte hob nur die Achseln und meinte, in die Oper gehe er prinzipiell nicht, sie sei für ihn das Denaturierteste, was er kenne, und neuere Bücher lese er auch nicht - und mit einer weltmännischen Verbeugung gegen uns alle und einem freundlichen ‚Ich bedaure’ ließ er uns stehen und ging seines Weges. Zwei Welten hatten sich kurz berührt.“ (220)
(Aus: Christoph Bernoulli: Erinnerungen an Gerhart Hauptmann. In: Derselbe, Ausgewählte Vorträge und Schriften. Hg. von Peter Nathan. O. O., o. J., S. 217-220.)
In der Tat: zwei Welten, die sich da berührten. Auf der einen Seite die Welt von Besitz, Kultur und Männermoral, kurz: der Zivilisation, auf der andern Seite die Welt der Natur, des Mythos und der weiblich-mütterlichen Urmoral. Denn unverkennbar und vermutlich ungewollt vom Verfasser schleichen sich mythische Züge in seine Darstellung. Dass die Bewohner des Berges troglodytisch in Höhlen gewohnt und Milch vom Euter der Ziegen getrunken hätten, kann nicht auf Augenschein beruhen. Vielmehr schlagen hier mythische oder zumindest archaisch-antikische Urmuster durch. Auch glaubt man die Stimme Gerhart Hauptmanns durchzuhören, der das Wort "troglodytisch" gern im Munde führte und in der Gestalt des Hirten so etwas wie einen menschlichen Archetypus erblickte.1 Sein "Ketzer von Soana" wird vom Priester zum Ziegenhirten; sein Till ist bei Locarno auf der Suche nach einem göttlichen "Hirten". Und den schönen Alten vom Berg umgibt in der Darstellung Bernoullis der freundlich-prophetische Glanz des "edlen Wilden".
Wem sind die Wanderer auf dem Berg damals begegnet? Die kecke Freimütigkeit des Alten, sein gelassener Stolz scheinen ganz auf Carlo Vester zu passen, der damals mit der Verwaltung des Anwesens betraut war. Er war der Herr in diesem Revier. Doch konnte man ihn als Greis bezeichnen? Vester, im gleichen Jahr wie Gräser geboren, war damals vierzig Jahre alt. Seine zottelige Mähne und sein von Falten durchfurchtes Gesicht ließen ihn allerdings älter erscheinen.
 |
 |
| Carlo Vester | Carlo Vester mit Sohn |
Doch wie auch immer: Hier sollte nur darauf aufmerksam gemacht werden, dass Bernoullis Bild der Bergbewohner durch seine Gespräche mit Hauptmann geprägt erscheint. Er sieht sie mit den Augen des Dichters, und der projiziert seinen eigenen Mythos in die Landschaft: den des urtümlichen Hirten, der durch seine Verwobenheit in Natur den "metaphysischen Keim" in sich zu kraftvoller Blüte entfaltet hat. Hauptmann sucht den "göttlichen Hirten", den dionysischen Naturheiligen, den heidnischen Heiland. Er sucht ihn dort, wo Gräser seine Felshöhle hatte: in einer Steilwand hoch über den Strudeln der Maggia bei Ponte Brolla.
Im Krieg hatte er die Novelle 'Der Ketzer von Soana' geschrieben, die schon im Titel, anagrammatisch, das Wort AS(C)ONA enthält. Sobald die Grenzen geöffnet waren, fuhr er dorthin. In seinem 1928 veröffentlichten Epos verarbeitet er seine vergebliche Suche nach dem "Ketzer von Ascona".
sehn. Es trieb ihn, den Ort seines nahenden Tods zu erreichen. ...
Ponte Brolla! hier raset das Kind, und es tobet heraklisch
durch das zwängende Tor ...
Till verbrachte die Zeit bis zum Abend ...
Wo verschlaf ich die Nacht? sinnt er endlich. Der Herbergen bieten
viele sich, und sie haben vertrauenerweckende Schilder: ...
Eine nennet sich: Sprung in den Himmel und eine: Zum Heiland.
Nun, der Sprung in den Himmel hat Zeit, denkt der Pilgrim und bückt sich
allbereits in der Tür, die ins Wirtshaus Zum Heiland hineinführt. ...
Und Till schläfert's ... Denn er sah einen Mann, einen Hirten, der schweigend hereintrat.
Er allein, niemand sonst sah den Gast. ... Es umgab ihn ein Lichtschein. ...
"Ich bin der, den du kennst", sagt der Fremdling,
"dessen Name dich lud, hier im Hause dein Nachtmahl zu essen.
Wunden weis' ich dir nicht oder Narben an Händen und Füßen,
kein zermartertes, blutendes Haupt, das, von Dornen zerrissen,
eitrig starrt, noch den schwarzen, von Striemen geborstenen Rücken.
Alles dieses ist lange verheilt und verharscht und vergessen.
Bester, sei mir willkommen, und morgen dann gehst du den Weg wohl
nach der Klamm deines Stroms, nach den brausenden Schnellen der Maggia,
wenig Schritte von hier. Und darüber hinaus in die Höhen,
eines Tages, wo still meine Lämmer Jahrtausende weiden.
Sieh, es geht ein Gerücht, ich sei nicht am Balken gestorben,
sondern lebend von liebenden Händen heruntergenommen. ...
Willst du mehr von mir wissen, besuche mich, Till!"
... Till erreichte die Tobel der Maggia
und erquickete Augen und Herz. ...
"Hört", so fragt er den Landmann, der tief seine Hacke hineinschlägt
in den knirschenden Grund, "hört und sagt mir, wo ist hier ein Hirte,
so und so von Gestalt? Und wo weidet der Hirt seine Herden?" -
... Ach, es war in dem Narren ein Wille
aufgebrochen, womöglich am Feuer des Hirten zu schmelzen
und sein heitres und letztes Geheimnis von ihm zu erfahren.
Und zu trinken begehrete er aus demselbigen Quellbrunn,
der die Herden des Hirten mit ewiger Wonne beglückte.
(Aus
Gerhart Hauptmann: Till Eulenspiegel.
In: Das erzählerische
Werk. Frankfurt/M. 1964, Bd. 4, S. 452-457)
Hauptmann zitiert einmal zustimmend ein Wort von Balzac: "Vor Gott gehöre ich der Religion des heiligen Johannes an" (SW VIII, 1054). Die Gestalt des Vaters Johannes zieht sich durch eine ganze Reihe von Werken bis hin zu seinem letzten unvollendeten Roman 'Der neue Christophorus'. Er ist "der Jünger, den der Herr am meisten liebte, / und der den Tod nicht sah noch sehen sollte" (in Gregor 423), der also auch in unseren Tagen unterwegs ist. Ein Wanderer wie der ewige Jude, aber ein Schuldloser, ein Lichtbringer. Ihm glaubt Hauptmann begegnet zu sein:
Er ging vorüber nur, und doch: es blieb in mir
unsterblich, was in seiner Seele Umkreis,
durch den ich schritt, in meine Seele drang:
es wahrhaft nennen - das vermag kein Wort.
(Zit. n. Gregor 423)
Dieser Pater Johannes liebt "mit allem Gut und Böse die Welt" (SW X, 860). Er ist ein Weltfrommer, ein Weltfreund. Er trägt Rübezahlzüge und, wie Till, die Schellen eines Narren. Im Epos 'Till Eulenspiegel' erscheint er als Naturapostel mit den bekannten Zügen Gusto Gräsers. In seinem unvollendeten Spätwerk wird er so etwas wie der leitende Schutzgeist des neuen Heilands namens Erdmann, von dem der Dichter sagt: "Das wäre also meine Absicht mit diesem Merlin-Erdmann: den Menschen mit der Erde inniger und auf religiöse Art zu verbinden" (SW X, 1088).
In 'Till' hatte Hauptmann den Naturapostel Johannes noch mit mildem Spott behandelt; von seiner Wiederkehr im 'Neuen Christophorus' sagt er: "Der sogenannte neue Christophorus läßt mich nicht los. Was er erstrebt, habe ich zu verspotten nicht angestanden, heut aber bin ich für die Erlösung der Menschheit umgestimmt" (SW X; 860). Der immer zweifelnde und schwankende Dichter hat sich am Ende für die Utopie des "Narren" entschieden, für die Hoffnung, "den Menschen mit der Erde inniger und auf religiöse Art zu verbinden".
|
Tills
letzte Landschaft  Dies ist eine historische Aufnahme, etwa um 1900: Blick vom Monte Verità auf Losone und das Maggiatal. Ziemlich genau in der Bildmitte sieht man den Kirchturm von San Giorgio aufragen. Hinter San Giorgio beginnt ein Fußweg, hinauf in die bewaldeten Hügel und Hänge, der zur Grotte Gusto Gräsers führt. Hermann Hesse ist diesen Weg oft gegangen, er nannte ihn seinen „Eremitensteig“. Auch Gerhart Hauptmann ist auf den Höhen über Losone gewandert, als er im Frühjahr 1919 sich monatelang in Locarno aufhielt. Auch sein Ziel, wie Hesses, muss die „Pagangrott“ gewesen sein, die sich in den Abhängen am linken Bildrand befindet. Dafür und davon spricht seine Dichtung. Von seinem Hotel in Locarno hatte er in etwa diesen Blick, freilich aus einer anderen Perspektive. Am rechten Bildrand sind in halber Höhe in der Verlängerung die in Hauptmanns ‚Till’ erwähnten „brausenden Schnellen“ (455) oder „Tobel der Maggia“ (457) zu denken: der Felsgrotte Gräsers genau gegenüber. Es handelt sich also um die Landschaft, in der Tills letztes Abenteuer spielt, wo er sein „Grab an den Schnellen der Maggia“ findet (462).
Ein Jahr vor Hauptmann hielt sich auch Hesse in der Gegend von Locarno auf. Auch er war, und dies schon seit vielen Jahren, auf der Suche nach dem seltsamen „Hirten“, auch er ließ die Blicke kreisen über den Talgrund, „wo der Ort für ein Hüttchen sich böte, die kleine Behausung“, wo er finden könnte, was er suchte: „den seligen Stillstand“ (457). Schon 1916 hatte er seinen Freund Gustav Gamper beauftragt, ein Häuschen in Waldnähe für ihn zu suchen, und 1918 schrieb er an Emil Molt, er würde gern in Ascona sich ankaufen. So auch Gerhart Hauptmann 1919. Er hatte ein Auge auf das „Castello San Materno“ geworfen, „ein altes Schloß langobardischen Ursprungs“, das dann die Eltern der Tänzerin Charlotte Bara kauften. „Das Schloß gehörte damals dem französischen Grafen de Loppinot, der sich geweigert hatte, es einem anderen Interessenten – dem Dichter Gerhart Hauptmann – zu verkaufen, weil dieser ihm – man schrieb das Jahr 1919! – als ‚boche’ nicht genehm war“ (Riess 1964, S. 116).
Das Castello
San Materno in Ascona Früher schon, noch vor seiner Abreise in den Süden, hatte Hauptmann eine andere, noch attraktivere Ansiedlungsmöglichkeit im Blick gehabt: die große Brissago-Insel im Lago Maggiore. Offenbar wollte er bewusst dort seinen seit Jugendtagen geträumten Sonnenstaat verwirklichen, seine matriarchale „Insel der Großen Mutter“. Immer wieder schwebt Hauptmann in diesen Jahren das Bild einer einsamen Insel vor. Einer Ozeaninsel mit südlicher Vegetation galt schon ein Traum von 1898; letztlich ist es, wie Hauptmann selbst bemerkt, die Robinson-Crusoe-Begeisterung seiner Kindheit, die in ähnlichen Äußerungen seines „Isolierungsdrangs“ fortlebt. 1918 oder 1919 erkundigt sich Hauptmann nach der Möglichkeit, die Brissago-Inseln im Lago Maggiore käuflich zu erwerben; glücklicherweise kommt er bald von dem Plan ab … Was sich im Leben nicht verwirklichen läßt, wird Literatur. (Sprengel: Mythen, S. 118f.) Aus beiden Hoffnungen oder Absichten ist also nichts geworden. Nicht er, der hamburgische Kaufhausbesitzer Emden konnte auf dem subtropischen Eiland im See seine erotischen Wünsche sich erfüllen. Hauptmann fand einen bescheideneren Ankerplatz für seine Utopie dann auf einer anderen Insel, hoch im Norden, auf Hiddensee.
|
|
Quellen
und Literatur |
|
|
Behl, C. F. W. |
Zwiesprache mit Gerhart Hauptmann.
Tagebuchblätter. München
1949. |
|
Behl, C. F. W. und Voigt, Felix A. |
Chronik von Gerhart Hauptmanns
Leben und Schaffen. Bearbeitet
von Mechthild Pfeiffer-Voigt. Würzburg 1993. |
|
Bernhardt, Rüdiger |
"Steigerung bis ins Unendliche".
Utopien in Gerhart
Hauptmanns Denken und Werk. In: Krysztof A. Kuczynski (Hg.), GH.
Internationale Studien. Lodz 1966, S. 25-47. |
|
Bernoulli, Christoph |
Erinnerungen an Gerhart Hauptmann.
In: Derselbe, Ausgewählte
Vorträge und Schriften. Hg. von Peter Nathan. o. O., o. J. S. 217-224. |
|
Bollenbeck, Georg |
Till Eulenspiegel - der dauerhafte
Schwankheld. Stuttgart
1985. |
|
Brescius, Hans von |
Gerhart Hauoptmann. Zeitgeschehen
und Zeitbewußtsein in
unbekannten Selbstzeugnissen. Eine politische Biographie. Bonn 1976.
|
|
Chapiro, Joseph |
Gespräche mit Gerhart Hauptmann.
Berlin 1932. |
|
Cowen, Roy C. |
Gerhart Hauptmann. Kommentar zum
nichtdramatischen Werk.
München 1981. |
|
Daiber, Hans |
Gerhart Hauptmann oder der letzte
Klassiker. München-Wien
1971. |
|
Fick, Monika |
Sinnenwelt und Weltseele. Der
psychophysische Monismus in der
Literatur der Jahrhundertwende. Tübingen: Max Niemeyer, 1993.
|
|
Gohar, Soheir |
Der Archetyp der Großen Mutter in
Hermann Hesses ‚Demian’ und
Gerhart Hauptmanns ‚Insel der Großen Mutter’. Peter Lang, Frankfurt am
Main etc. |
|
Gregor, Josef |
Gerhart Hauptmann. Das Werk und
unsere Zeit. Wien 1951. |
|
Guthke, Karl S. |
Gerhart Hauptmann. Weltbild im
Werk. 2. Auflage. München:
Francke, 1980. |
|
Hauptmann, Gerhart |
Der Apostel. In: Sämtliche Werke,
hg. von Hans-Egon Hass,
Bd.. 6, S. 69-84. |
|
Hauptmann, G.erhart |
Sämtliche Werke.
(Centenar-Ausgabe.) Hrsg. von Hans-Egon
Hass, fortgeführt von Martin Machatzke. Frankfurt a. M./Berlin/Wien
1969ff. |
|
Hauptmann, Gerhart |
Das erzählerische Werk in zehn
Einzelbänden. Hrsg. und mit
Nachworten versehen v. Ulrich Lauterbach. Frankfurt a. M./Berlin/Wien
1981ff. |
|
Hauptmann, Gerhart |
Briefe an Emil Ludwig. Im
Deutschen Literatur Archiv Marbach. |
|
Hauptmann, Gerhart |
Diarium 1917 bis 1933. Berlin 1980. |
|
Hauptmann, Gerhart |
Der neue Christophorus. 1965.
|
|
Hauptmann, Gerhart |
Gesammelte Werke in acht Bänden.
Berlin 1922.
Jubiläumsausgabe im S. Fischer Verlag. |
|
Heuser, Frederick W. J.
|
Gerhart Hauptmann. Zu seinem Leben
und Schaffen. Tübingen
1961. |
|
Hensel, Monica |
Die Gestalt Christi im Werk
Gerhart Hauptmanns. Diss. Berlin
1957. |
|
Heynen, Walter (Hg.)
|
Mit Gerhart Hauptmann.
Erinnerungen und Bekenntnisse aus
seinem Freundeskreis. Berlin 1922. |
|
Hilscher, Eberhard |
Gerhart Hauptmann. Berlin 1969.
|
|
Hörner, Unda |
Auf nach Hiddensee! Die Bohème
macht Urlaub. Berlin 2004. |
|
Honsza, Norbert u. Koczy, Karol
|
Gerhart Hauptmann an Wilhelm
Bölsche. In: Weimarer Beiträge.
Zeitschrift für Literaturwissenschaft, 11. Jg., 1965, S. 593. |
|
Hülsen, Hans von |
Freundschaft mit einem Genius.
München 1947. |
|
Joachimsthaler, Jürgen |
Dichtung oder Plädoyer? Gerhart
Hauptmann, Max Bernstein und
das "Naturalismus"-Problem. In: Krysztof A. Kuczynski (Hg.), Gerhart
Hauptmann. Internationale Studien. Lodz 1996, S. 116ff. |
|
Jofen, Jean |
Das letzte Geheimnis. Eine
psychologische Studie über die
Brüder Gerhart und Carl Hauptmann. Bern 1972. |
|
Leonhardt-Aumüller, Jacqueline |
"Narren um Christi willen". Eine
Studie zu Tradition und
Typologie des "Narren in Christo" und dessen Ausprägung bei Gerhart
Hauptmann. München 1993. |
|
Leppmann, Wolfgang |
Gerhart Hauptmann. Leben, Werk und
Zeit. Bern, München, Wien:
Scherz, 1986. |
|
Ludwig, Emil |
Geschenke des Lebens. Ein
Rückblick. Berlin 1931. |
|
Ludwig, Emil |
Gerhart Hauptmann. Studie über
Talent und Charakter. In:
Centaur, 2, 1946, S. 78-88. |
|
Machatzke, Martin (Hg.) |
Gerhart Hauptmann. Tagebuch 1892
bis 1894. Berlin 1985. |
|
Meinert, Dietrich |
Hirte und Priester in der Dichtung
Gerhart Hauptmanns. In:
Acta Germanica. Jahrbuch. des südafrikanischen Germanistenverbandes.
Bd. 4, Kapstadt 1969, S. 39-49. |
|
Michaelis, Rolf |
Der schwarze Zeus. Gerhart
Hauptmanns zweiter Weg. Berlin
1962. |
|
Müller, Hermann |
Propheten und Dichter auf dem Berg
der Wahrheit. Gusto
Gräser, Hermann Hesse, Gerhart Hauptmann. In: Kai Buchholz u. a. (Hg.):
Die Lebensreform. Entwürfe zur Neugestaltung von Leben und Kunst um
1900. Darmstadt 2001, Band 1, S. 321-324. |
|
Requardt, Walter u. Machatzke,
Martin |
Gerhart Hauptmann und Erkner.
Studien zum Berliner Frühwerk.
Berlin 1980. |
|
Ribbat, Christoph |
Religiöse Erregung.
Protestantische Schwärmer im Kaiserreich.
Frankfurt: Campus, 1996. |
|
Rosteutscher, J. H. W.
|
Die Wiederkunft des Dionysos. Bern
1947. |
|
Schrimpf, Hans Joachim |
Gerhart Hauptmann. Wege der
Forschung. Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, Darmstadt 1976. |
|
Schwede, Reinhild |
Wilhelminische Neuromantik. Flucht
oder Zuflucht?
Ästheti-zistischer, exotistischer und provinzialistischer Eskapismus im
Werk Hauptmanns, Hesses und der Brüder Mann um 1900. Frankfurt/M. 1987.
|
|
Sprengel, Peter |
Die Wirklichkeit der Mythen.
Berlin 1982. |
|
Sprengel, Peter |
Gerhart Hauptmann. Epoche - Werk -
Wirkung. München 1984. |
|
Tank, Kurt L. |
Gerhart Hauptmann in
Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.
Reinbek: Rowohlt Taschenbuch, 1959. |
|
Wende-Hohenberger, Waltraud
|
Gerhart Hauptmanns 'Der Narr in
Christo Emanuel Quint'. Eine
religions- und gesellschaftskritische Romananalyse. Frankfurt/M. etc.:
Peter Lang, 1990. |
|
Wille, Bruno |
Aus Traum und Kampf. Mein
60jähriges Leben. Berlin 1920. |
1 "Hier ist an die außerordentlich hohe Wertung zu erinnern, die das Hirtendasein im Hauptmanns Griechischem Frühling erfährt: als ursprünglichste Lebensform und 'beste Ernährung für den metaphysischen Keim im Menschen‘ (CA VII 78), Grundlage somit aller Mythen- und Religionsbildung." (Peter Sprengel: Gerhart Hauptmann. Epoche - Werk - Wirkung. München 1984, S. 219)













